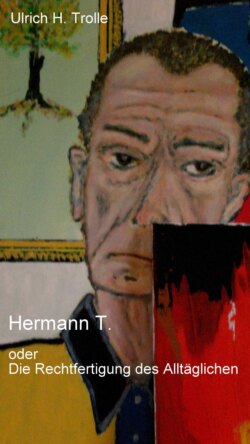Читать книгу Hermann T. - Ulrich Hermann Trolle - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеFünfzehn Meter entfernt
von der verputzen Außenwand mit den weißen Fenstern glitzert im Garten auf dem rosafarbenen Blütenblatt des Phlox’ ein Tautropfen in der kühlen Morgenluft. Es scheint, als habe er geduldig auf den ersten Lichtstrahl der aufgehenden Frühsonne gewartet, um im Moment ihrer Berührung vom Blatt herab zu fallen und zwischen den Grashalmen hindurch mit einem leisen Seufzer Hermanns flüchtigem Blick zu entschwinden. Die zwei Sätze werden Hermann noch lange Zeit beschäftigen. Aber jetzt steht Hermann erst einmal am geöffneten Fenster seines Badezimmers. Er sieht hinaus in den beginnenden Tag und lächelt. Er fühlt sich wenige Augenblicke lang wie ein arrivierter Gutsbesitzer, der von der erhöhten Terrasse seines ansehnlichen Landsitzes gemächlichen Blickes über die Weiten der Ländereien schaut und eine gute Ernte erwartet. Im realen Leben aber hat Hermann weder einen Gutshof noch Ländereien. Worauf Hermann schaut, ist der ihm vertraute Hausgarten. Hermann weiß darin alle Bäume zu unterscheiden und die meisten Sträucher benennt er sowohl mit ihrem botanischen als auch mit ihrem gebräuchlichen Namen. Das Strauchwerk steht breit und dicht und gibt den Sperlingen gute Deckung. Die Bäume sind schlank und hoch gewachsen. Manche von ihnen stehen eigenwillig schräg, als wollten sie den Nachbargrundstücken ausweichen. Mit ihrer Neigung aber deuten sie auf die ungefähre Trennung der Grundstücke hin, deren mit Efeu überwachsene Grenzen vor mehr als einem Jahrhundert vermessen wurden, und die sichtbar zu erhalten sich niemand in den darauf folgenden zwei, drei Generationen wohl sorgfältig gekümmert haben muss und an deren erneuter Markierung heute weder Hermann noch irgendjemand in der aktuellen Nachbarschaft bisher deutliches Interesse gezeigt hat. Und Hermann selber weiß auch von keinem Grenzstein, auf den er Bezug nehmen könnte. Die Sommerblumen prangen an den lichten Stellen des Gartens und im Unterholz wuchern Bodendecker. Auf der Seite mit dem einfallenden gleißenden Sonnenlicht des Nachmittags, blüht die Staude jenes rosafarbenen Phlox’, auf deren einer Blüte eben noch der Tautropfen glitzerte und der Hermanns Aufmerksamkeit heute früh für einen kurzen Augenblick anzog. An der Staude führt ein schmaler und mit alten quadratischen in Beton gegossenen Platten befestigter Weg vorbei und endet unvollendet im Rasen, als hätte der Bauherr von einst die Lust oder die Orientierung verloren oder vergessen, wohin der Weg einmal führen sollte. Das kurze unfertige Wegstück ist die einzige Pflasterung in dem Garten, für Hermann eine stete Lockung, Hand anzulegen. Jedoch weiß Hermann einzuschätzen, dass er den Weg auch nur ein paar Meter verlängern würde, ohne ein sinnvolles Ende für den Weg zu finden. Der Weg hat keinen Sinn. Hermann sieht auf das Rasengrün und auf die hie und da am Rand verstreut und halb eingegraben liegend rötlichfarbenen Feldsteine. Der Rasen fällt mit seiner von Gänseblümchen und flach wachsendem Klee durchzogenen weichen Fläche besonders auf. Er gibt dem Garten eine lässige, wenn auch mäßige Weite. Man möchte sofort dorthin laufen, alle Kleidung abwerfen und sich nackt auf dem Grün ausstrecken. Am Fuß der niedrigen und nur provisorisch erhaltenen Einzäunung im hinteren Gartenteil wächst jedes Jahr das gelb blühende Schöllkraut. An den Zaunpfosten, zwischen Büscheln von Gräsern, hält sich der Schwarze Nachtschatten. Eine Kolonie grüner Nesseln mit ihren dicken Stängeln und Blütendolden lockt die Schmetterlinge an. In diesem Garten haben Hermanns Kinder gespielt und unbeschwerte Zeiten erlebt. Davon gibt es Fotos, die Hermann sorgsam aufbewahrt. Durch das satte dichte Grün der Blätter dringen nur wenige neugierige Blicke in Hermanns Garten hinein. Eine Idylle, wären da nicht die Verkehrsgeräusche von der nahen vierspurigen Straße, die zwischen den Fahrbahnen der Autos auch noch zwei Gleise für die Straßenbahn aufnimmt und damit von Nord nach Süd verlaufend durch den östlichen Teil der Hauptstadt Berlin eine breite und schmerzlich trennende Schneise schlägt. Das Laut und Leise, das sich von der Straße her über die Häuser des siedlungsartigen Stadtteils legt, wechselt ununterbrochen, und nur hin und wieder verstummt es für zwei bis drei Sekunden, wenn der zeitliche Zufall in der Ampelschaltung an der weitflächigen Straßenkreuzung jegliche Fahrzeuge zum Stehen zwingt. Die eintretende unfassbare Stille verwirrt dann einen Lidschlag lang die Sinne der Empfindsamen, weckt ihre Wünsche nach völliger Vertreibung aller Fahrzeuge aus dem irdischen Leben, bis der erdrückende Motorenkrach wieder anschwillt und die Menschen schneller laufen, als könnten sie so dem Gebrüll der Straße entfliehen. Von den großzügig bemessenen Grundstücken links und rechts seiner direkten Nachbarschaft sieht Hermann über die Baumkronen hinweg die Ziegeldächer mit den schlanken Schornsteinköpfen auf den zwei- und dreistöckigen, stuckverzierten Häusern aus der Kaiserzeit des beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts. Jeden Morgen entschwinden über breite, fachkundig gepflasterte und sorgsam gepflegte Auffahrten dunkle Limousinen aus diesen Grundstücken und folgen der Spur zu einem für Hermann unbekannten Ziel. Schräg gegenüber, auf der anderen Seite der Straße, steht ein Neubau aus den deutschen Wendejahren des vergangenen zweiten Jahrtausends nach Christus. Von diesem deplatzierten Steinprotz wird noch zu reden sein. Hermann schläft morgens ab der fünften Stunde meist nur oberflächlich und etwas unruhig. Es durchfahren ihn Traumbilder, durch die er seine eigenen tiefen Atemzüge vernimmt. Manchmal dringt sogar das Kratzen seiner Bartstoppeln am Bettbezug in den Halbschlaf ein wie ein fremdes sich näherndes und dann wieder sich entfernendes Geräusch, das den Spuk des letzten Schlaftraumes verdreifacht. Hermann empfindet diese schleichende Wach-Traum-Schlaf-Zeit am frühen Morgen nicht als lästig und nimmt sie nicht als entrissene Schlafzeit, nicht als Verlust wichtiger Erholphasen. Sein Aufstehen nach diesen Stunden ist weder gelähmt noch verlangsamt. Er fühlt sich genauso wie nach einer durchgeschlafenen Nacht. Hermann kommt sich mitunter sogar agiler vor, weil alle diese Geräusche, das laute Ticken der Uhr, das Beben der Holzbalkendecke, das Zanken der Elstern, die Schweißarbeiten an der Straßenbahnkreuzung ihm bewusst machen, immer noch im Leben zu sein und alle Gefühle zu haben wie ein Erdenwesen aus Fleisch und Blut. Die banalen Geräusche aus dem Dämmer des anbrechenden Morgens schaffen höchste Momente in ihm. Wie oft muss er sich eingestehen, dass die hellsten Bilder, die pfiffigsten Ideen und die gelungensten Wortgedanken für seine Geschichten gerade in diesen frühen Morgenzeiten geboren werden, ins Greifbare mitunter Erhabene aufsteigen. Hermann möchte alles in sich aufnehmen, was diese frühen Morgenstunden wie von selbst in ihm verschönern. Im Tiefschlaf werden ihm solche hebenden Gefühle nicht geboten. Im Tiefschlaf erfährt er nichts von dem Herzschlag in seiner Brust, als wäre der Tiefschlaf eine Auszeit vom Leben. Der Tiefschlaf kommt ihm wie ein Koma vor. Wenn er das Erleben des frühen Morgens nicht mehr spüren könnte, wäre er abgetrennt vom Leben, dann wäre er mausetot. Sagt Hermann. Später, etwa gegen ein halb sieben Uhr, verflüchtigt sich der seltsame Morgenzauber. Hermanns Gliedmaßen erschlaffen wieder, bleiben unbeweglich und bald erwacht er, wie ein Kind, das nach dem Schlaf die Augen öffnet. Hermann blinzelt dann auf das Weiß der Zimmerdecke, bis sich der Schleier des Halbschlafes über der Raufasertapete auflöst mit einem Geräusch weit hinten in seinem Ohr, als würde Wasser leise knisternd durch ein Leinentuch versickern. Hermann bleibt gewöhnlich noch einige Minuten nach dem Erwachen im Bett liegen, trotz des heftigen Dranges, auf die Toilette zu müssen. Er döst vor sich hin und versucht, diesen oder jenen Traumfetzen nun mit klarem Bewusstsein aus dem Dämmer des Morgens fest zu halten und nach einem Zusammenhang mit seinem täglichen Tun und Lassen abzutasten. Er streckt und dehnt noch seine Beine und knetet mit den Fingern vorsichtig, den Schmerz vermeidend, einen kleinen Gummiball, der immer griffbereit neben dem Bett auf den Nachttischchen liegt, bevor er dann die Bettdecke zurückschlägt, sich aufrichtet und noch einige Augenblicke auf dem Bettrand verharrt. Danach geht er im weit geschnittenen Schlafanzug über den Flur in sein Bad. Ja, eigentlich hat er da noch keinen festen Tritt. Die Badtür bleibt angelehnt. Dahinter hantiert Hermann mit Restschlaf in den Gliedern an einem deckellosen Kästchen aus verleimtem und braun gebeiztem Sperrholz, das auf dem breiten Fensterbrett seinen Platz hat. In dem Kästchen verstaut Hermann Krimskrams. Er sagt Krimskrams zu den Teilen, die sonst, wie er vor sich selber den Kauf des unscheinbaren Kästchens rechtfertigte, ungeordnet herum liegen würden: Pinzette, Sonnenschutzcreme, zwei Nagelfeilen, ein Ehering, eine winzige Tube Öl für den Rasierapparat, eine rote Massagekugel mit Noppen für die Füße, eine Cremedose, ein Minischraubenzieher für die Brille, ein Probierfläschchen mit Parfüm, eine angerissene Packung Tabletten. Das fremde Auge sucht im Bad vergeblich nach einem Schrank, nach einem Regal, nach einer Schublade. Es findet weder einen Haken für die Kleider noch eine Ablage für Wäsche. Es entdeckt statt der vermissten Möbelstücke drei verschieden große Bilder an der Wand und einen breiten Spiegel über dem Waschbecken, wie auch nur wenig Platz für eine Anzahl gewöhnlicher, für die Körperhygiene ausreichender Utensilien, sowie eine runde Uhr mit großen Ziffern. Das Bad ist hell, wirkt nüchtern, fast karg. Die Erwartung, in einem Bad zu sein, fordert noch etwas Verschönerndes. Sie möchte, wohl auch wegen des haftlosen Widerscheins von den Wänden, geradezu unhöflich tadeln, verkneift sich aber den Hinweis auf die Ähnlichkeit von Hermanns Badeinrichtung mit einer Kaue der Bergarbeiter im Schacht. Hermann nähme diesen Vergleich, würde er tatsächlich damit konfrontiert werden, mit einem freudigen Lächeln entgegen, weil ihm einst, als er noch Schüler in der Unterstufe war, während eines ganztägigen Klassenausfluges mit eingestreuter Besichtigung eines Bergwerkes, weil ihm nicht die Maschinenpistole der uniformierten Wachposten am Werktor, sondern das Schlichte und Zweckmäßige der Kaue der Schachtkumpel imponierte und derart als nachahmenswert in der Erinnerung geblieben ist, dass Hermann Jahrzehnte später die Nachahmung ausführte. Hermann würde, falls er sich zu seinem Bad äußern sollte, deshalb für Fremde etwas umständlich erklären und vielleicht auch nur zögernd hinzufügen: Diese Einrichtung habe ich gewollt. Alles im Bad soll ein wenig wie Kaue sein. Aber Hermann wird sich keinem fremden Auge gegenüber erklären müssen. Er wird nicht ohne einen zwingenden äußeren Grund sein kleines Badezimmer Dritten öffnen und sich dadurch eventuell dem Vorwurf aussetzen, es sei eigenwillig eingerichtet. Allein schon in den beiden und nur bei Bedarf zu äußernden knappen Worten ‚gewollt’ und ‚Kaue’ ist das eindeutig Unerschütterliche von Hermanns gestalterischer Badidee auszumachen. Die Sicherheit seiner eigenen Überzeugung, es richtig gemacht zu haben, hält jeden ablehnenden Widerspruch aus. Somit ist Hermann immun gegen jedes weitere nervende Argument zum Warum und Weshalb. Und auch für eine mögliche Bemerkung gelegentlicher fremder Benutzer seines Bades, denen er übrigens nur äußerst ungern ihre Verrichtung gestatten würde, die Bemerkung, die etwa so klingen könnte: „…wäre Dir nicht auch eine andere Raumlösung eingefallen auf den wenigen Quadratmetern…“, gibt es keine Gelegenheit geäußert zu werden, da kein Fremder Hermanns Bad bisher betreten hat und fernerhin auch nicht betreten soll, vor allem, weil Hermann sich nicht verkneifen würde, jeden Nutzer barsch anzuweisen, auf seinem Klo sauberer zu sein als bei sich zu Hause, auf deren Standort, von dem es Hermann übrigens völlig egal ist, ob man dort aufgefordert wird, im Sitzen zu pinkeln und die Bürste zu bedienen, solange Hermann nicht durch Umstände gezwungen wäre, mit seinen empfindlichen Sinnen durch die fremde Klotür zu treten und den fremden Ort widerwillig zu füllen. Überdies würde das fremde Auge in seinem Bad sowieso nicht auf die innewohnende Endgültigkeit der zwei gewichtigen Worte achten, sondern skeptisch auf die helle Eierschalenfarbe der Fliesen schauen und die Raum vergrößernde Wirkung des Spiegels vielleicht gerade noch akzeptieren, aus dem das Licht von der gläsernen Lampe in den Raum zurückfällt. Wahrscheinlich würde der fremde Blick die Beleuchtung lieber von einer Handvoll in die Decke eingelassener Strahler gespeist sehen wollen, als von der ein wenig ältlich wirkenden hängenden Lampe. Eine Lampe, das ist doch in der Empfindung immer etwas Baumelndes, wie ein schon lange nutzloser Gegenstand, der im Wind getrocknet wird. Hermann also will Niemandem eine Erklärung schulden. Sein Bad ist für ihn kein Raum zum Aufhalten. Es ist für ihn ein Raum zum Verschwinden. Es ist ein Raum der übergehenden Verrichtungen vom Schlaf in den Tag und vom Tag in den Schlaf. Der Zweck zählt hier und zu allererst. Wo hat es auf dem Plumpsklo seiner frühen Erziehungsjahre jemals mehr als nur den einen Zweck gegeben, schnell wieder von diesem Ort zu verschwinden? Also sind in Hermanns winzigem Badezimmer die drei abstrakten Bilder an der Wand, das Bidet gleich neben dem Klobecken und die wandhoch geflieste Duschecke vergleichsweise Zeiten überspringende Weiterentwicklungen und erleichternde Vorrichtungen angesichts der damaligen, weißkalkig getünchten Ziegelwände des Donnerbalkens auf dem kalten Hof, an denen die Kinder manchmal ihren Kot abschmierten, wenn entweder die teure Rolle Klopapier geklaut worden war und als Ersatz die regionale Tageszeitung, die den Namen „Freiheit“ trug, nicht seitwärts abgelegt, sondern provokant in Gänze im Loch steckte, unerreichbar für Kinderarme. Nur die zerknüllten Achtelstücken der „Freiheit“ oder die teure papierne Rolle hätten der braunen, fingerspurig grafischen Hinterlassenschaft an der gepinselten Wand einen Ausweg geboten. Nicht zu übergehen ist in Hermanns Bad außerdem das bequem zu bedienende Fenster, neu eingebaut, 16 mm Scheibenabstand, Licht durchscheinend doch blickdicht und schalldämpfend. Das Fenster hat einen handlichen Griff, ist schnell geöffnet und gut geeignet für den morgendlichen entspannenden Blick in den Garten. Das frühere Örtchen, jenes aus der eben angedeuteten vaterstädtischen Rückerinnerung, besaß für die Lüftung und für einen Blick nach draußen in den Garten, so man ihn überhaupt von dieser Stelle aus tun wollte, weil die hölzern harte Kante des rund eingesägten Sitzloches sich schmerzhaft ins Fleisch kerbte und zum schnellen Handeln aufforderte, jenes Örtchen also besaß statt eines Fensters eine rüde Öffnung im Format von zwei kreuzweise im Mauerverband ausgelassenen Ziegelsteinen an der rechten Wandseite. Da strich der Wind das ganze Jahr hindurch. Egal aus welcher Richtung er über das Land kam, mal als heulender Ostwind, mal als lauer Hauch aus der Ebene, immer traf er auf die dünnen Wände des schmalen kalten Abtritts und fand immer seinen zugigen Weg durch das heilige Kreuz hindurch. Bei diesem Gedanken huscht ein seliges Lächeln über Hermanns Gesicht und er gibt einen Eindruck von sich, so wie er da am Fenster steht, mit dem Handtuch lose über der Schulter, ein wenig nach vorn gebeugt schon, ohne Brille, als komme er langsam zurück aus der Erinnerung und prüfe jetzt die Klarsicht seiner Augen, schätze die Regenschwere der Wolken ab und suche am Himmel nach dem Greifvogel, dessen Schrei er soeben aus der Höhe vernommen hat, wie zu den Zeiten des Abtritts, hinten am Ende des Hofes. Noch heute ist es so, und vor Jahrmillionen bereits, seit dem aufrechten Gang des menschlichen Vorfahrens war es so, und zur Zeit des Neandertalers und des Mammuts vor vierzigtausend Jahren wird es mit dem ersten Blick nach dem Aufwachen am frühen Morgen schon so gewesen sein, denkt sich Hermann. Und seit Hermann diesen Blick bei seinem Vater beobachtet und von ihm übernommen hat und bei dessen Vater ihn ebenso bemerkt hatte, sagt er sich: Der erste Blick am frühen Morgen geht nach oben. Der erste Blick ist ein Reflex.