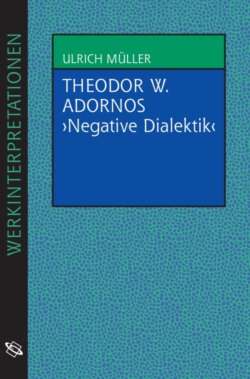Читать книгу Theodor W. Adornos "Negative Dialektik" - Ulrich Muller - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung: Der Begriff philosophischer Erfahrung
Оглавление„Die Kategorien der Kritik am System sind zugleich die, welche das Besondere begreifen“ (38).
Die Einleitung der ND beginnt mit den wohl meistzitierten Sätzen:
„Philosophie, die einmal überholt schien, erhält sich am Leben, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt ward. Das summarische Urteil, sie habe die Welt bloß interpretiert, sei durch Resignation vor der Realität verkrüppelt auch in sich, wird zum Defaitismus der Vernunft, nachdem die Veränderung der Welt mißlang. […] Praxis, auf unabsehbare Zeit vertagt, ist nicht mehr die Einspruchsinstanz gegen selbstzufriedene Spekulation, sondern meist der Vorwand, unter dem Exekutiven den kritischen Gedanken als eitel abzuwürgen, dessen verändernde Praxis bedürfte. Nachdem Philosophie das Versprechen, sie sei eins mit der Wirklichkeit oder stünde unmittelbar vor deren Herstellung, brach, ist sie genötigt, sich selber rücksichtslos zu kritisieren“ (15).
Die Anspielung auf Marxens 11. Feuerbachthese51 ist hier unüberhörbar. Dennoch bleibt offen, von welcher Philosophie Adorno eigentlich spricht. Die Marx’sche zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass sie die traditionelle Philosophie als theoretisch-idealistischen Überbau versteht und im Namen einer materialistisch definierten Praxis kritisiert. Diesen Primat der Praxis lässt Adorno nicht mehr gelten, weil er nur noch dazu diene, die im Lichte alternativer Praktiken erfolgende Kritik der bestehenden Praxis zu verhindern. Alternativen verlieren aber nicht schon deshalb ihr Recht und ihre Überzeugungskraft, weil sie zur Zeit nicht positiv umsetzbar oder gar ausformulierbar sind. Der Versuch einer praktischen Umstürzung oder gewaltsamen Veränderung der Gesellschaft jedoch, so lässt sich diese These erläutern, erzeugt noch stärkere Gegengewalt, die wiederum nur zu einer Verschlechterung der bestehenden Verhältnisse führt.
Eine solche Verschlechterung schließt Adorno nun an anderer Stelle keineswegs aus. Er scheint sogar die These zu vertreten, alles müsse erst noch viel schlechter, vielleicht sogar vollendet schlecht und dementsprechend auch der Leidensdruck der Menschen groß genug geworden sein, damit sich die Gesellschaft eines Besseren besinne – eine Auffassung, die seinerzeit der Sozialdemokrat Jochen Steffen vertrat. So jedenfalls ließe sich der Satz aus dem berühmten Schlussaphorismus der Minima Moralia, nach dem „die vollendete Negativität, einmal ganz ins Auge gefaßt, zur Spiegelschrift ihres Gegenteils zusammenschießt“52, auf nicht-metaphysische Weise verstehen. Wichtig ist hier allerdings, dass Adorno einer solchen Verschlimmerung des Bestehenden zum „ausweglos geschlossene[n] Immanenzzusammenhang“ (395) nicht gewaltsam in die Hände arbeiten will. Er setzt vielmehr seine gesamte Hoffnung auf dessen Unerträglichwerden, das dann zu seiner Veränderung nötigen könnte.
Über konkrete Schritte und Mittel in die Richtung der von ihm anvisierten Gewaltlosigkeit schweigt er sich hingegen aus. Stattdessen sucht er zunächst Schutz in einer Form von Dialektik, die er mit Hegel als „den organisierten Widerspruchsgeist“53 begreift. Was genauer damit gemeint ist, lässt sich in den Worten der ND als eine solche Dialektik erläutern, die sich nicht primär an der ‚Identität‘ ihres Gegenstandes als vielmehr an seiner Widersprüchlichkeit, Uneinheitlichkeit und Unversöhntheit interessiert zeigt: „denn die unversöhnte Sache, der genau jene Identität mangelt, die der Gedanke surrogiert, ist widerspruchsvoll und sperrt sich gegen jeglichen Versuch ihrer einstimmigen Deutung. Sie, nicht der Organisationsdrang des Gedankens veranlasst zur Dialektik“ (148).
So gesehen könnten wir Dialektik mit Adorno als in komplexer Sache zentriertes Verfahren widerspruchsfreier Erkenntnis ihrer Uneinheitlichkeit beschreiben. Eine solche Rekonstruktion seines Dialektikbegriffs liefe auf ein differenziertes, dezentriertes und sogar dekonstruierendes Denken hinaus, das dazu diente, das Spezifische und Besondere der Sache freizulegen. Diese Dialektik folgte dann aber keiner „Logik … des Zerfalls“, wie Adorno gerne sagt, sondern einer Logik der Dekonstruktion „der zugerüsteten und vergegenständlichten Gestalt der Begriffe“ (148). Das heißt, wir müssen uns von Adornos quasi-hegelischer Suggestion befreien, dass der Gang der Sache selbst bereits dialektisch organisiert sei, Dialektik mithin auch etwas ‚Reales‘ meine, nämlich den „Widerspruch in der Realität“ (ibid.). Stattdessen sollten wir uns vergegenwärtigen, welcher Sinn mit der vorgeschlagenen differenztheoretischen und dekonstruktivistischen Rekonstruktion des negativ-dialektischen Dialektikbegriffs verbunden werden kann.
Wer jemandem etwas Unbekanntes, Unverständliches oder Uneindeutiges beschreiben will, geht in der Regel so vor, dass er zunächst dessen Ähnlichkeiten mit bekannten Phänomen benennt und dann angibt, wie oder worin es sich davon unterscheidet. Bereits Platon entwickelte dieses Verfahren der dihaíresis und Aristoteles verwendete es als differentia specifica in der Definition: Innerhalb seines näheren Bereichs (seines genus proximum) wird etwas durch seine Verschiedenheit oder spezifische Differenz zu allem Anderen bestimmt. So ist jeder philosophische Text immer auch ein System verschiedenartiger Differenzen. Seine Eigenart lässt sich an der Außendifferenz zu anderen, auch nicht-philosophischen Texten ablesen, aber ebenso an der Binnendifferenz, die dieser Text, z. B. als moralphilosophischer Diskussionsbeitrag zum Thema Genmanipulation, zu anderen Beiträgen über dasselbe Thema aufweist. M. a. W.: Das produktive Verfahren der Differenzierung und Intertextualisierung ermöglicht Erfahrungen der Produziertheit von Texten, die auch ganz anders hätten produziert sein können. Überdies verweist es den Text, auf den es angewandt wird, positiv oder negativ auf andere Texte, andere Argumente und andere Sichtweisen. Dadurch wird eine Sensibilisierung für die Eigenarten eben dieses Textes ermöglicht.54
Hegel hingegen, so Adorno, habe sich primär für die Identität einer Sache und letztlich gegen ihre Differenzen, Brüche und Verschiedenartigkeiten interessiert, was zu revidieren sei. Darüber hinaus habe Philosophie gegen Hegel auf die Ineinssetzung von Identität und Positivität zu verzichten (145). Identität könne, außer im Prinzip ‚A = A‘ der formalen Logik, nur als partikulare und brüchige behauptet und müsse daher stets im Zusammenhang mit Nichtidentischem gesehen werden. Insbesondere die Ich-Philosophie des deutschen Idealismus habe sich die wechselseitige Bedingtheit von psychologischer und logischer, individueller und allgemeiner Identität unzureichend klargemacht (145f., Anm.). In diesem Zusammenhang führt Günter Figal treffend aus:
„Es ist offenbar, dass die kompakte Einheit des ›es selbst‹ […] ein Schein war – eine Oberflächenerscheinung, die nur zustande kam, weil im reinen Gedanken ›Identität‹ das ausgeschlossene und bestrittene Andere in der Verborgenheit blieb. Nur dadurch konnte der Gedanke ›Identität‹, wie Hegel ihn charakterisiert hat, sich behaupten. Nun aber, durch den Rückgang in die Vielheit, gibt es diese bruchlose und glatte Erscheinung nicht mehr. Das ›es selbst‹ … gibt es nicht ohne die Vielfalt, das Vielfältige gehört zum ›es selbst‹, ohne von ihm vereinnahmt werden zu können.“55
Andererseits, so Adorno, dürfe die Unzulänglichkeit der philosophischen Theorietradition hinsichtlich der Identitätsdifferenzierung, d. h. ihr ideologisches Moment, nicht dazu führen, auf Theorie und Reflexion zu verzichten und statt dessen nur noch der „Praxis, die immerzu verändern will“, (147) das Wort zu reden. Um auf unser Eingangszitat zurückzukommen: Was bei Hegel und Marx oder, je nach Interpretation, auch im Idealismus der Verwirklichung als wert erachtet, jedoch versäumt wurde – etwa Versöhnung oder soziale Gerechtigkeit –, ist nicht zugunsten der bestehenden Praxis aufzugeben, sondern „theoretisch erneut zu reflektieren“ (ibid.).
Die Philosophie als ganze kann hinsichtlich des in dem Zitat angesprochenen Nicht-Verwirklichten kaum gemeint sein. Denn wie sollten sich Erkenntnistheorien, Logiken oder Metaphysiken ‚verwirklichen‘ lassen, da sie in der Regel gar keinen praktischen Charakter besitzen und nur als Interpretamente auf zu interpretierende Praktiken anwendbar sind? Dies gilt zumindest, sofern wir ‚anwenden‘ von ‚verwirklichen‘ unterscheiden wollen. Philosophien hingegen, die sich in die Tat umsetzen lassen oder eine praxisverändernde Bedeutung besitzen bzw. beanspruchen, müssen wenigstens wertimprägniert sein. Ethiken, Ästhetiken, Geschichtsphilosophien oder ökonomische Theorien, d. h. alle im weiteren Sinne praktischen Philosophien, können solche evaluativen und sogar normativen Disziplinen sein, insofern sie Werte, Ideale oder Normen als praktische Programme vertreten, die handelnd angesteuert, ‚verwirklicht‘ oder ‚versäumt‘ werden können. Karl-Otto Apel hat einmal mit dem ihm eigenen Hang zur theoretischen Überpointierung davon gesprochen, „daß in der Welt der Gegenwart, in der Lebenssituation der sogenannten Industriegesellschaft, genau drei Philosophien wirklich funktionieren, d. h. nicht: vertreten werden, sondern Theorie und Praxis des Lebens faktisch vermitteln: Marxismus, Existenzialismus und Pragmatismus“56. Mit dem Pragmatismus amerikanischer Herkunft hat sich Adorno nie ernsthaft eingelassen; lediglich John Dewey wird an einigen Stellen wohlwollend zitiert. Adornos Auseinandersetzung mit dem Existenzialismus hat sich in Büchern über Kierkegaard57 und Heidegger58 und einem Aufsatz über Sartre59 niedergeschlagen. Der Marxismus schließlich ist vor allem über die Transformationstationen Lukács, Benjamin, Kracauer und Bloch in die ND eingewandert. Deren Praxisphilosophien haben allerdings Adornos Kritik der philosophischen Tradition entscheidend beeinflusst.
Dass Adorno in unserem Eingangszitat die spekulativ-idealistische These Fichtes und Hegels von der letztendlichen Identität von Gedanke und Wirklichkeit als „Versprechen“ bezeichnet und damit einer positivmetaphysischen These einen moralischen Sinn gibt, muss allerdings befremden. Offenbar meint Adorno, der ideologische Charakter dieser Metaphysik komme in der Situation nicht ermöglichter, ‚verstellter‘ Praxis besser zum Vorschein, weil der Kontrast zwischen Philosophie und Wirklichkeit größer geworden sei. Dies jedoch würde wiederum voraussetzen, dass sich Philosophie an der Wirklichkeit, was immer diese genau sein möge, messen lassen müsse. Während Marx von einem positiv gewerteten Praxisbegriff ausgeht, angesichts dessen die Philosophie überflüssig wird, liegt Adornos Theorie ein negativ gewerteter Begriff gegenwärtiger, industriegesellschaftlicher Praxis zugrunde, wodurch Philosophie zwar als kritisches „Stellvertretungs“-Unternehmen rehabilitiert, ihr Sinn jedoch zugleich dahingehend verändert wird, dass sie jetzt nur noch als radikale Selbstkritik möglich ist. Diese kompensative Funktion in Bezug auf gesellschaftliche Praxis kommt der Philosophie jedoch nur insofern zu, als ihre Notwendigkeit auf die Bedingung der Unmöglichkeit gelungener Praxis gegründet ist. Nicht jedoch könnte Philosophie eine solche Praxis vollwertig ersetzen, da sie deren Aufgaben nie wird erfüllen können, weshalb sie für Adorno immer einen vorläufigen und in vielerlei Hinsicht defizitären Status behält. Sie bezeichnet die 1966 allein mögliche Form von ‚Praxis‘.
Im Grunde spricht Adorno in jenem Zitat also von seiner eigenen Philosophie, die ihre Daseinsberechtigung als „Platzhalterin“60 einst versäumter und derzeit gar nicht möglicher Verwirklichungen anderer, z. B. idealistischer Philosophien besitze. M. a. W.: Die in der ND entfaltete Philosophie wäre tatsächlich überflüssig, wenn sie sich erfolgreich in die Tat umsetzen ließe. Diese These bestätigt Adorno, indem er gegen Schluss des Buches im Zusammenhang der Diskussion metaphysischer Erfahrung bekennt, dass Dialektik „in einer letzten Bewegung sich noch gegen sich selbst kehren“ (397) müsse und „in einem dialektischen Schritt zu verlassen“ (398) sei. Die theoretische Figur einer Überwindung von Dialektik durch Dialektik erinnert an Adornos methodologische Forderung, Philosophie müsse „über den Begriff durch den Begriff“ hinausgelangen (27). Während letztere Intention jedoch ausdrücklich an die Sprache der Begriffskonstellationen gebunden bleibt, nur „aus dem Schein des Ansichseins des Begriffs als einer Einheit des Sinns hinaus“ und auf „seine Selbstbesinnung auf den eigenen Sinn“ (24) hinführen will, bleibt mehr als zweifelhaft, welches Organ nach der dialektischen Überwindung der Dialektik die für Adornos Philosophieren unabweisbare kritische Erkenntnisfunktion übernehmen soll, wenn nicht wiederum eine andere, geläuterte Form der Dialektik.
Von der fragwürdigen Option einer Selbstüberwindung von Dialektik unangetastet bleibt Adornos Verständnis von Philosophie als selbstkritisches Reflexionsmedium gegenwärtiger Wirklichkeitsverhältnisse. Als solche kann und darf sie nicht „vorweg einen Standpunkt“ (17) beziehen. Vielmehr muss sie sich auf ihre jeweilige Gegenwart konkret einlassen, ohne sich ihr lediglich anzupassen. Einerseits müssen daher die Kategorien philosophischer Kritik von denen des kritisierten Gegenstandes hinreichend unterschieden sein, um diesen distanziert beurteilen und kritisieren zu können; andererseits dürfen diese Kategorien nicht unangemessen abstrakt an den Gegenstand angelegt werden, weil dann nicht ersichtlich wäre, in welcher Weise die Kritik das Kritisierte konkret betrifft. Da zudem die kritisierte Gegenwart in stetem Wandel begriffen ist, müssen auch die Kategorien der Kritik immer neu konkretisiert werden. Es ist es sogar möglich, dass die angestrebte emanzipative Praxis in einem zukünftigen Zeitpunkt möglich und die vorherige Kritik somit überflüssig wird. In diesem Punkt ist auf Hoffnung statt auf Resignation zu setzen, wobei einzuschränken ist, dass jene nicht bloß auf Utopien gegründet sein darf. Aus diesen genannten Momenten erst bestünde wahrhafte kritische Flexibilität, die nicht in einer Anpassung der Theorie an die allgegenwärtigen Mechanismen des Marktes aufginge. Dies gilt heute noch mehr als zu Adornos Zeiten, weil die Marktmechanismen vielfältiger geworden und mit den globalisierten Kommunikationstechnologien unauflöslich und bis zur Ununterscheidbarkeit verquickt sind.
Ein solches Verständnis von Philosophie beruhigt sich daher auch nicht mit „begriffliche[r] Ordnung“ (17). Dialektisch ist es in Übereinstimmung mit Hegel darin, dass es „der Philosophie Recht und Fähigkeit wiederverschafft, inhaltlich zu denken, anstatt mit der Analyse leerer und im emphatischen Sinn nichtiger Formen von Erkenntnis sich abspeisen zu lassen“ (19). Es begreift sich nicht primär als logisch-explikativ, sondern als geschichtlich-verstehend oder, wie wir heute sagen würden, weniger als formale Wissenschaftstheorie denn als materiale Hermeneutik. Aber solche Einordnungen sind für Adornos Denken noch zu unspezifisch. Denn sein Philosophieren dient weniger der Stabilisierung eines bestimmten Welt- und Menschenbildes, als vielmehr der kritischen Diskussion und Infragestellung einer jeden positiven Lehrmeinung, gleich welcher Herkunft.
Adornos Kritik an apriorischer Begriffskonstruktion knüpft an Hegels Kritik der kantischen Kategorienlehre an. Zuzustimmen sei Hegels Auffassung, die durch Kant in der Kritik der reinen Vernunft deduzierten Kategorien seien weder als letztgültig noch vollständig zu betrachten, sondern aufgrund ihrer Restriktion „auf die Methodik der Wissenschaften“ unfähig, „Inhaltliches und Wesentliches zu erkennen“ (19).
Gegen Adorno – und ebenso gegen Hegel – muss an dieser Stelle jedoch daran festgehalten werden, dass Kants idealistische Philosophie inhaltliche und wesentliche Erkenntnis keineswegs ausschließt, sondern lediglich an die konstitutiven Formen von Kausalität, Wechselwirkung, Einheit, Möglichkeit usw. rückbindet. Die in seinem Hauptwerk vorgenommene thematische Beschränkung auf die Rechtfertigung der Kategorien als Erfahrungsvoraussetzungen erlaubt somit nicht per se deren Denunzierung als „leerer und im emphatischen Sinne nichtiger Formen von Erkenntnis“ (ibid.). Ein solches Urteil könnte erst angesichts des Prozesses der Kategorienanwendung gefällt werden. Jedoch ist Kant in der Tat dafür zu kritisieren, die von ihm aufgestellten Kategorien als ausschließliche und endgültige Bedingungen jedweder Erfahrung behauptet und verteidigt zu haben. Kants Fehler besteht hierbei darin, von einer nur für seine Zeit gültigen Forschungspraxis der Naturwissenschaften auszugehen, diese jedoch unreflektiert als Paradigma für Erfahrung überhaupt zu hypostasieren. Dass dieser Schritt tatsächlich unzulässig ist, zeigt sich u. a. daran, dass z. B. historisches Denken heute ganz offensichtlich nicht einmal mehr die Kausalitätskategorie benötigt, um etwa historische Erfahrungen artikulieren zu können. Die kantischen Kategorien sind nur dann für uns unbedingt notwendig, wenn wir, wie Kant, beweisen wollen, dass Metaphysik als Wissenschaft möglich ist.61
Gegenüber Kant jedoch, so Adorno, befinde Hegel sich insofern im Unrecht, als bei ihm das inhaltlich bestimmte Einzelne „nichts anderes als Geist sein sollte“ (19). Ein solcher absoluter Idealismus sei samt der von ihm behaupteten „Versöhnungen“ weder logisch noch politisch-historisch jemals „stichhaltig“ gewesen (ibid.). Mehr noch als der transzendentale Idealismus Fichtes wird Hegels Dialektik von Adorno als Paradigma einer Philosophie des verabsolutierten und hypostasierten Subjekts gedeutet (18). Weil für diese Philosophie ihre Denk- und Erfahrungsergebnisse von vornherein feststehen, ist ihr Resultat im Grunde ein einziges tautologisches Urteil. Entgegen dieser Abgeschlossenheit des Hegel’schen Systems konzipiert Adorno seine eigene Dialektik explizit als negative, was bedeutet, dass ihr Ausgang offen bleibt. Sie ist damit weder wie bei Kant an letztgültige Kategorien und Definitionen gebunden, noch wie bei Hegel durch irgendein System vorbestimmt: „Prinzipiell kann sie stets fehlgehen; allein darum etwas gewinnen“ (25). In ihrer Insistenz auf Negativität hat Philosophie im Sinne Adornos
„ihr wahres Interesse dort, wo Hegel, einig mit der Tradition, sein Desinteressement bekundete: beim Begriffslosen, Einzelnen und Besonderen; bei dem, was seit Platon als vergänglich und unerheblich abgefertigt wurde und worauf Hegel das Etikett der faulen Existenz klebte. Ihr Thema wären die von ihr als kontingent zur quantité négligeable degradierten Qualitäten. Dringlich wird, für den Begriff, woran er nicht heranreicht, was sein Abstraktionsmechanismus ausscheidet, was nicht bereits Exemplar des Begriffs ist“ (20).
Weder Platon noch Hegel waren Empiriker, sondern Metaphysiker, die sich nur für die allgemeinsten Aspekte der Welt interessierten. Darin besteht ihr Defizit. Der später im Positivismus gipfelnde radikale Empirismus eines David Hume oder John Locke wiederum ist begriffs- und reflexionslos. Indem er das subjektive Erkenntnismoment künstlich auszuschalten und ganz auf die Objektivität der Erkenntnis abzustellen versucht, unterliegt er ihm nur desto stärker. Der empiristische Erfahrungsbegriff ist für Adorno genauso erfahrungsverkürzend und -entstellend wie der von der idealistischen Metaphysik konstruierte. Weder lassen sich die begriffenen Dinge in den Text der Erkenntnis gewissermaßen hineinkleben, noch lassen sie sich in konstanter Zeitlosigkeit begrifflich entwerfen. Beide erkenntnistheoretischen Extrempositionen verkennen die spezifische Bedeutung des erkennenden und Begriffe verwendenden individuellen Subjekts, das auf der Seite der Metaphysik entweder überhaupt noch kein Thema ist (Platon) oder systemphilosophisch diskreditiert wird (Hegel), während es auf der Seite des Positivismus zwar methodologisch neutralisiert werden soll, aber nicht wirklich ausgeschaltet werden kann.
Gegen beide Positionen führt nun Adorno „das individuelle Bewußtsein“ als „Schauplatz der geistigen Erfahrung“ (55) ins Feld und besteht auf der „Kontingenz individueller Erfahrung“ (56). Diese jedoch
„hätte keine Kontinuität ohne die Begriffe. Durch ihre Teilhabe am diskursiven Medium ist sie der eigenen Bestimmung nach immer zugleich mehr als nur individuell. Zum Subjekt wird das Individuum, insofern es kraft seines individuellen Bewußtseins sich objektiviert, in der Einheit seiner selbst wie in der seiner Erfahrungen: Tieren dürfte beides versagt sein. Weil sie in sich allgemein ist, und soweit sie es ist, reicht individuelle Erfahrung auch ans Allgemeine heran. Noch in der erkenntnistheoretischen Reflexion bedingen logische Allgemeinheit und die Einheit individuellen Bewußtseins sich wechselfältig“ (56).
Hegels Werk, so Adorno, sei von solcher Erfahrung beseelt gewesen, habe sie aber inkonsequenterweise als zu vernachlässigende Zufälligkeit behandelt und abgetan. Gegen diesen Vorwurf der Inkonsequenz jedoch ist Hegel gegen Adorno zu verteidigen. Denn vom Standpunkt des Hegel’schen Systems aus gesehen, das die Genese des Absoluten auf allen Stufen und in allen Formen betrachten will, sind die Individuen als solche ganz folgerichtig von untergeordneter Bedeutung. Relevanz kommt ihnen nicht in Hinblick auf sie selbst zu, sondern lediglich insofern, als das Absolute ihrer als Zwischenstationen zu seiner Selbstverwirklichung bedarf. Neben dem Vorwurf des Desinteresses Hegels für das Individuelle und Kontingente ist dessen Philosophie nach Adorno überdies vorzuwerfen, am Ende auf einen wissenschaftshörigen Logizismus hinauszulaufen; indem Hegel alles für Geist erklären wolle, glaube er, der Sprache nicht zu bedürfen, „während der einfachste Wortsinn von Dialektik Sprache postuliert“ (165).
Den Vorwurf der Sprachlosigkeit bei gleichzeitiger Logikorientiertheit hätte Adorno nun auch gegen Kant richten können, was dessen Zeitgenossen Hamann62 und Herder63 bereits getan haben, wenngleich mit großem Unverständnis für Kants transzendentalphilosophischen Ansatz. Stattdessen wiederholt Adorno im Wesentlichen die Kritik Hegels an Kant: Dessen Kategorienlehre kranke an ihrer formalistischen Leere. Dazu ist anzumerken, dass bei Kant ja erst die Abstraktheit der Kategorien ihre allgemeine Anwendbarkeit ermöglicht. Allgemein ist festzuhalten, dass eine Theorie, wenn sie sehr konkret formuliert ist, natürlich nur einen eingeschränkten Anwendungsbereich aufweist, jedoch deshalb oft dazu tendiert, dogmatisch zu werden. Ist sie hingegen abstrakt angelegt, bedarf sie zwar einer gesonderten Konkretisierung im Anwendungsfall, ist aber vor Einengungen und Ausschließungen gefeit.
Meiner Kant-Verteidigung unbeschadet kann Adorno natürlich geltend machen, dass sowohl der Vollständigkeitsanspruch, den Kant mit den Kategorien verbindet, als auch ihr Status der apriorischen, geschichtsresistenten Gültigkeit einer Begründung individueller historischer Erfahrung im Wege steht. Die Lösung dieses Problems sieht Adorno nun aber keineswegs in einer radikalen Verabschiedung des transzendentalen Subjekts. Kants Lehre kranke nicht an einem Zuviel, sondern einem Zuwenig an Subjektivität. Sein Subjektbegriff sei zu Recht als universaler konzipiert gewesen, aber zu Unrecht auf den naturwissenschaftlichen Forschungsstand des 18. Jahrhunderts eingeschränkt geblieben.
Adornos Forderung nach einer Revision der Kategorien lässt sich somit offenbar durchaus mit dem transzendentalphilosophischen Grundansatz vereinbaren. Denn Erkenntnis ist für beide Philosophen eigentlich keine, wenn sie nicht einerseits selbstreflexiv vollzogen wird und anderseits auf die Erfahrung von Wirklichem bezogen ist. Was Adorno also gegen Kant geltend macht, ist das Moment der Offenheit und Variabilität von Erfahrung. Seine Kritik der naturwissenschaftlich verengten Erkenntniskategorien betrifft auch die Begründung des gesamten, zu verändernden Erfahrungsansatzes der Kritik der reinen Vernunft:
„Denn eine solche Begründung in einem Starren und Invarianten widerstreitet dem, was Erfahrung von sich selbst weiß, die ja, je offener sie ist und je mehr sie sich aktualisiert, immer auch ihre eigenen Formen verändert. Die Unfähigkeit dazu ist die Unfähigkeit zur Erfahrung selber. Man kann Kant keine Erkenntnistheoreme hinzufügen, die bei ihm nicht ausgeführt sind, weil seiner Erkenntnistheorie deren Ausschluß zentral ist; ihn meldet der systematische Anspruch der Lehre von der reinen Vernunft unmißverständlich genug an. Kants System ist eines von Haltesignalen.“ (380).
Adornos Begriff einer unverkürzten, ungeschmälerten und lebendigen Erfahrung, eben „der Erfahrung Lebendiger“ (381), kann sich auf Kants Kritik der Urteilskraft stützen, in der weder die ästhetische, noch die naturteleologische Erfahrung den Kategorien der theoretischen Vernunft unterworfen wird. Kant selbst also relativiert die von ihm in der Kritik der reinen Vernunft verfochtene Unveränderlichkeit der Kategorienlehre, indem er sie dem Gegenstandsbereich entsprechend modifiziert. Daher geht Adornos Behauptung, Kants Erkenntnistheorie sei ein „System von Haltesignalen“, „Block“, „Schranke“ oder gar „Denkverbot“ (381) an der Sache vorbei. Denn Kant will die vorliegenden Denk- und Erfahrungsmöglichkeiten ja gerade analysieren und begründen, dabei jedoch ihre Anwendung weder verhindern, noch dogmatisch erweitern. Und wenn auf solche Begründungsversuche ein charakteristischer Begriff zutrifft, so ist es nicht der einer ‚Sperre‘, sondern der genuin kantische der ‚Grenze‘ oder ‚Grenzsetzung‘. In Kants Worten: „Erfahrung, welche alles, was zur Sinnenwelt gehört, enthält, begrenzt sich nicht selbst: sie gelangt von jedem Bedingten immer nur auf ein anderes Bedingte. Das, was sie begrenzen soll, muß gänzlich außer ihr liegen, und dieses ist das Feld der reinen Verstandeswesen“64.
Im Übrigen bindet auch Adorno Erkenntnis explizit an Begriffe, d. h. negativ-dialektische Kategorien wie ‚Sachhaltigkeit‘, ‚Selbstreflexion‘, ‚Begriffskonfiguration‘, ‚Wesen‘, ‚Besonderheit‘, die der Erkenntnis unvermeidbar in bestimmter Weise eine Orientierung geben und sie dadurch begrenzen. Adorno macht sich offensichtlich nicht klar, dass keine Begriffskonfiguration sämtliche Denk- und Erfahrungsmöglichkeiten initiieren kann, sondern eine jede irgendwelche anderen ausschließen muss. Vollkommene Offenheit käme einer Kategorien- und Begrifflosigkeit gleich. Gegen Bergson und Husserl, die jeweils auf mentalistische bzw. lebensphilosophische Weise aus dem Idealismus ausbrechen wollten und dabei nur in „einen Kultus irrationaler Unmittelbarkeit“ (20)65 verfielen, beharrt Adorno darauf, gegen beide und „gegen Wittgenstein zu sagen, was nicht sich sagen läßt“ bzw. „das Begriffslose mit Begriffen aufzutun, ohne es ihnen gleichzumachen“ (21). M. a. W.: Die anzustrebende, traditionskritisch veränderte Philosophie „wäre nichts anderes als die volle, unreduzierte Erfahrung im Medium begrifflicher Reflexion“ (25). „An ihr ist die Anstrengung, über den Begriff durch den Begriff hinauszugelangen“ (27).
Die begriffliche Relativierung und Korrektur eines Begriffs bezeichnet jedoch entgegen den Suggestionen Adornos keine besondere, sondern vielmehr alltägliche Leistung unserer Sprache. In komplizierten Verstehens- oder Erläuterungssituationen reicht ein Begriff niemals aus, um alles Nötige zu sagen. Ebenso ist die Betonung des Umstands trivial, dass wir Nichtbegriffliches immer nur begrifflich thematisieren können. Warum also diese Insistenz auf dem Begriffslosen? Will Adorno, der das Triviale immer verabscheute, davor warnen, das Begriffslose den Begriffen gleichzumachen, d. h. es fälschlicherweise mit ihnen zu identifizieren? An diesem Punkt hat die Adorno-Literatur inzwischen hinlänglich klargemacht, dass zwischen „etwas mit etwas identifizieren“ und „etwas als etwas identifizieren“ zu differenzieren ist.66 Dennoch sollten wir nicht unterstellen, Adorno wolle den meisten anderen Philosophen vorwerfen, philosophische Gegenstände mit ihren Begriffen für identisch zu halten. Sinnvollerweise kann sich sein Vorwurf wohl nur gegen eine unzulängliche Beschreibung und unzureichende begriffliche Erfassung der Gegenstände, anders gesagt: gegen den unangemessenen begrifflichen Ausdruck des Nichtbegrifflichen richten. Doch in welcher Hinsicht soll er unangemessen sein? Was ist denn eigentlich „das von den Begriffen Unterdrückte, Mißachtete und Weggeworfene“ (21), das Adorno anderen Philosophen gegenüber einklagt?
Einen Hinweis gibt die folgende Stelle: „In Wahrheit gehen alle Begriffe, auch die philosophischen, auf Nichtbegriffliches, weil sie ihrerseits Momente der Realität sind, die zu ihrer Bildung – primär zu Zwecken der Naturbeherrschung – nötigt“ (23). Hier scheint es, als verstehe Adorno unter der nichtbegrifflichen Dimension der Begriffe ihre praktische Funktion, die darin bestehen kann, ein Stück Wirklichkeit mitzugestalten und dabei notwendig auch zu verändern, worauf offenbar der Begriff der Naturbeherrschung hinweisen soll. Aber auch praktische Situationen in Gestalt bestehender Bedürfnisse oder Probleme nötigen dazu, neue, besser operationalisierbare Begriffe zu bilden, wie uns die Technik fast täglich vor Augen führt. Und Philosophie, so verstehe ich die zitierte Stelle, muss den Verwendungs- und Herkunftskontext auch philosophischer Begriffe mitbedenken. Sie darf sich nicht lediglich auf deren geistigen Gehalt, ihre Erkenntnisfunktion, verlassen, sondern muss auch ideologiekritisch danach fragen, welche politischen, sozialen, erzieherischen und sonstigen pragmatischen Funktionen philosophische Begriffe wie Bildung, Mensch oder Moderne besitzen.
Diese mögliche partielle Aufschlüsselung des Nichtbegrifflichen beantwortet aber noch immer nicht die Frage nach dessen angemessener Beschreibbarkeit. Will Adorno sagen, das Begriffslose dürfe nicht so behandelt werden, als sei es in Begriffen überhaupt adäquat, d. h. vollständig erschließbar? Oder will er sagen, das Begriffslose solle auf eine Weise begrifflich und möglicherweise auch vollständig erschlossen werden, die nicht den Einzelbegriffen folgt?
Die erste von beiden möglichen Lesarten zielt darauf, die Ansprüche philosophischer Erfahrung zu begrenzen. Da Adorno diese ausdrücklich an das Medium des Begriffs bindet67, bleibt die Philosophie dieser Interpretation zufolge notwendig hinter dem ihr zugemuteten Ziel einer zureichenden Erkenntnis des individuellen Gegenstandes zurück. Um die angestrebte Individualisierung zu erreichen, müsste das Erkennen daher, wie es scheint, auf nicht-begriffliche und somit auch nicht-philosophische Elemente wie Intuition, Einfühlung, Bilder, Gesten etc. zurückgreifen. Gerade dies weist Adorno jedoch letztlich als Rückfall in die Irrationalität zurück, was an seiner Einschätzung der Phänomenologie Husserls und der Lebensphilosophie Bergsons deutlich wird. Das bedeutet indessen nicht, dass eine Kapitulation der Philosophie vor dem ‚Begriffslosen, Einzelnen und Besonderen‘ für Adorno in Frage käme: Philosophie hat
„gegen Wittgenstein zu sagen, was nicht sich sagen läßt. Der einfache Widerspruch dieses Verlangens ist der von Philosophie selbst: er qualifiziert sie als Dialektik, ehe sie nur in ihre einzelnen Widersprüche sich verwickelt. Die Arbeit philosophischer Selbstreflexion besteht darin, jene Paradoxie auseinanderzulegen. Alles andere ist Signifikation, Nachkonstruktion, heute wie zu Hegels Zeiten vorphilosophisch“ (21).
Es liegt also nahe, der zweiten Interpretation zu folgen und das Defizit des ‚Sich-nicht-sagen-Lassens‘ lediglich auf die signifikative Funktion des Einzelbegriffs, aber nicht auf Begriffe überhaupt zu beziehen. Dann aber ist auch der Widerspruch, mit dem es Dialektik Adorno zufolge zu tun haben soll, kein echter. Vielmehr verdankt er sich dem Schein, dass nur das eindeutig zu Benennende ‚gesagt‘ werden könne, während die eigentlichen Lebensprobleme, einer Denkfigur des frühen Wittgenstein entsprechend, nur den Mitteln der Mystik zugänglich wären und sich damit einer begrifflichen Explikation entzögen. Gegen Adorno sollte daher darauf bestanden werden, dass das begriffliche Verfahren der negativen Dialektik nicht notwendig auf Paradoxien hinausläuft, weil sich eine zwar mit mathematischer Präzision nicht darstellbare Sache gleichwohl angemessen be- und umschreiben lässt. Das begriffstechnisch nicht oder nur schwer Fassbare soll nicht einfach in bestehende Begriffsformationen, -raster oder -systeme eingegliedert werden. Es muss so lange umschrieben werden, bis es wenigstens Elemente seines Wesens zu erkennen gibt.
Dass ein solches Vorgehen nicht auf Tische und Stühle anwendbar ist, leuchtet ein. Aber wie steht es mit so schwer fassbaren, begrifflich (noch?) nicht angemessen erfassten (erfassbaren?) Phänomenen wie Kollektivschuld, Globalisierung oder Schönheit? Für deren Erkenntnis nützen Schlagworte so wenig wie etablierte Begriffe. Denn, so Adorno, „Theorie und geistige Erfahrung bedürfen ihrer Wechselwirkung“ (41). Hier wäre also ein dauerreflexives Erproben verschiedener Begriffskonstellationen in Wechselwirkung mit empirischen Betrachtungen angebracht, wobei keines der Zwischen- bzw. Teilergebnisse als endgültiger Erkenntnisabschluss interpretiert werden dürfte. Mir scheint, dass Autoren wie Reinhart Koselleck im Bereich der Historik68, Hans Blumenberg in der Philosophie69 und Karlheinz Stierle in der Ästhetik und Kunstphilosophie70 Adornos Vorstellungen eines Wechselverhältnisses von Theorie und Empirie methodisch gefolgt sind, ohne deswegen jedoch seine Position im Ganzen zu teilen.
Ungeachtet dessen gilt es hervorzuheben, dass unsere zweite Lesart auf philosophische Konkretion zielt. Das Begriffslose soll nicht bloß mechanisch, technisch, mit Hilfe der Abstraktionsfunktion des Einzelbegriffs erfasst, sondern in seiner Einbettung in einen begrifflichen und sachlichen Zusammenhang erfahrbar gemacht werden. Genau dazu dient die Begriffskonstellation, die als zentrale Methode negativ-dialektischen Denkens im zweiten Teil des Buches („Begriff und Kategorien“) erläutert wird. Bereits in der Einleitung heißt es dazu:
„Der bestimmbare Fehler aller Begriffe nötigt, andere herbeizuzitieren; darin entspringen jene Konstellationen, an die allein von der Hoffnung des Namens etwas überging. Ihm nähert die Sprache der Philosophie sich durch seine Negation. Was sie an den Worten kritisiert, ihren Anspruch unmittelbarer Wahrheit, ist stets fast die Ideologie positiver, seiender Identität von Wort und Sache. Auch die Insistenz vorm einzelnen Wort und Begriff, dem ehernen Tor, das sich öffnen soll, ist einzig ein wenngleich unabdingbares Moment. Um erkannt zu werden, bedarf das Inwendige, dem Erkenntnis im Ausdruck sich anschmiegt, stets auch eines ihm Äußeren“ (62f.).
Die Unzulänglichkeit der Einzelwörter, historisch Individuiertes zu erschließen, macht weitere Beschreibungen erforderlich, die in ihrem Zusammenhang ein differenziertes Bild der beschriebenen Sache darstellen können. Die direkte Bezeichnungsfunktion des Namens erscheint als dafür ungeeignet, weil sie in ihrer naiven Unmittelbarkeit nicht hinreichend präzise und reflektiert ist. Allerdings kennt auch Adorno, ähnlich wie W. Benjamin, die mit der direkten Benennungsfunktion der Namen verbundene Hoffnung, der Wahrheit einer Sache schlagartig innewerden zu können. Und m. E. hat diese Hoffnung, verstanden als regulative Idee im kantischen Sinne, durchaus ihre Berechtigung: Sie orientiert die Erkenntnis an den Vorstellungen von Objektivität und Wahrheit, ohne sie bereits als objektive und wahre verbürgt zu wissen.71 Auf diese Weise sollen „Willkür und Relativität wie in der Wortwahl so in der Darstellung insgesamt“ (62) so gering wie möglich gehalten werden, wenngleich sie sich nicht völlig vermeiden lassen.
Wichtig ist dabei nun aber, dass die Philosophie wahre historische Erkenntnis nur auf indirektem Wege, nämlich über die Verwendung mehrerer aufgefächerter Begriffsformen, Beschreibungen, Erläuterungen, Erklärungen etc. erfolgreich anzusteuern vermag. Ihr utopisches Erkenntnisziel, Wort und Sache zur vollständigen Deckungsgleichheit, in eine gleichsam ‚seiende Identität‘ (63) zu bringen, muss scheitern. Vielleicht ließe sich Adorno hier durch das Lieblingswort Samuel Becketts korrigierend interpretieren, demzufolge es darauf ankomme, immer besser zu scheitern. Denn einer derartigen Verbesserung des letztendlichen Scheiterns aller philosophischen Sprechweisen in Bezug auf eine angemessene und wahrheitsgemäße Erkenntnis geschichtlicher Individualitäten arbeiten die Begriffskonstellationen zu. Das Konkrete und Einzigartige bedarf zu seiner rationalen Erschließung des Abstrakten und von ihm Verschiedenen. So wie sich das überwältigend nahe Gegenwartserlebnis nur in einer distanzierten begrifflichen Betrachtungs- und Beschreibungsweise philosophisch einholen lässt, kann das Individuelle nur mit Hilfe verschiedener einander korrigierender Abstraktionen und diese wiederum differenzierender Konkretionen72 erkannt werden. Der Versuch unmittelbarer philosophischer Einfühlung, Wahrnehmung oder Intuition ist naiv und zum Scheitern verurteilt.
Auch hierin zeigt sich, wie Adorno selbst eingesteht, die Unzulänglichkeit einer rein immanenten Erkenntnis. Das ‚Innere‘, der nichtbegriffliche Erkenntnisgegenstand, kann nur im Zusammenhang und unter Zuhilfenahme der ihm ‚äußeren‘ Begriffe erkannt werden. Zugleich gilt umgekehrt: Die Begriffe verwendende
„Philosophie schöpft, was irgend sie noch legitimiert, aus einem Negativen: daß jenes Unauflösliche, vor dem sie kapitulierte und von dem der Idealismus abgleitet, in seinem So-und-und-nicht-anders-Sein doch wiederum auch ein Fetisch ist, der der Irrevokabilität des Seienden. Er zergeht vor der Einsicht, daß es nicht einfach so und nicht anders ist, sondern unter Bedingungen wurde. Dies Werden verschwindet und wohnt in der Sache, so wenig auf deren Begriff stillzustellen, wie von seinem Resultat abzuspalten und zu vergessen. Ihm ähnelt zeitliche Erfahrung. Im Lesen des Seienden als Text eines Werdens berühren sich idealistische und materialistische Dialektik“ (62).
Das gegenwärtige Phänomen der Globalisierung, so ließe sich diese Textstelle beispielhaft erläutern, ist nicht als unausweichlich gegebene historische ‚Tatsache‘ zu akzeptieren, sondern vor dem Hintergrund ihrer sie ermöglichenden Bedingungen und begünstigenden Faktoren, wie Marktsättigung, Firmenkonzentration, Expansion von Binnenmärkten sowie der Entwicklung von Computer- und Telekommunikationstechniken zu betrachten. Auch die Fülle der täglich auf uns einströmenden Informationen in ihrer Verquickung mit ökonomischen Faktoren gehören hierher. Solche Bedingungen der Sache ‚Globalisierung‘ gelangen in deren Resultat – z. B. der Erfahrung, in allen europäischen Hauptstädten dieselben Supermarktketten mit genau den gleichen Waren anzutreffen – gar nicht mehr ins Bewusstsein. Der neue Begriff ‚Globalisierung‘ verdeckt die verschiedenen Entstehungszusammenhänge und -faktoren dieses allgegenwärtigen und übermächtig erscheinenden Phänomens. Darüber hinaus lenkt er davon ab, dass große Teile der Weltbevölkerung von der für uns selbstverständlichen, scheinbar weltweiten Vernetzung völlig abgeschnitten sind. Der afrikanische Kontinent etwa verarmt immer mehr und hat an den Vorteilen der neuen Kommunikationstechniken kaum Anteil. Der Begriff als solcher verschleiert also nicht nur die Ursachen, sondern auch die konkreten Folgen der mit ihm bezeichneten Sache.
Adorno zufolge dürften nun die Bedingungen und die Wirkungen im Sinne künftiger Bedingungen für die Weiterentwicklung der Globalisierung weder als deren unausgesprochene Voraussetzungen ignoriert, noch als von ihr abgetrennte Entstehungsfaktoren schlicht verdrängt werden. Vielmehr sind sie für die Relativierung und kritisch distanzierende Betrachtung des erfahrbaren Globalisierungsresultats sorgfältig auszubuchstabieren. Denn erst eine detaillierte historische Aufschlüsselung der Sache, die Freilegung ihrer Genese, ermöglicht deren differenzierte Erkenntnis: Sie verhindert die fraglose Akzeptanz der Globalisierung als historisch notwendige bzw. unausweichliche Entwicklung, weil sie den Blick für Alternativen öffnet und damit sowohl vereitelte oder versäumte, als auch gegenwärtig immer noch bestehende Möglichkeiten einer andersartigen Entwicklung vor Augen führt. „Womit negative Dialektik ihre verhärteten Gegenstände durchdringt, ist die Möglichkeit, um die ihre Wirklichkeit betrogen hat und die doch aus einem jeden blickt“ (62).
Zugleich beugt sie damit einer partikularistischen Zerstückelung des Phänomens in voneinander abgetrennte Einzelerfahrungen vor, die ihren Zusammenhang, z. B. ihre wechselseitige Bedingtheit, nicht mehr erkennen lassen. Indem die Einzelbedingungen und -stationen des Globalisierungsphänomens immer noch als Entwicklungsmomente desselben Gegenstandes ‚Globalisierung‘ behandelt werden, gewinnt dieser ein facettenreiches Gesicht, das sich von der gegenwärtigen Erfahrung des So-und-nicht-anders-Seins hinlänglich unterscheidet, ohne in zusammenhanglose Einzelheiten zu zerfallen.
Die durch den abstrakten Begriff Globalisierung ausgeübte Funktion der Zusammenfassung und Vereinheitlichung verschiedener Erfahrungen zu einem einheitlichen Erfahrungsstrang oder Erfahrungsbündel, kurz: einer Erfahrungsganzheit, bezeichnet den Anteil, den Adorno zufolge die idealistische Dialektik am philosophischen Erkenntnisprozess besitzt. Würde dieses idealistische Erkenntnismoment jedoch verabsolutiert, so reduzierten wir Globalisierung auf das, was der schneidig klingende Begriff als solcher suggeriert: weltüberspannende Vernetzung vom Menschen und Sachen, grenzenlose Kommunikation zwischen Personen und Systemen, beliebige Überwindung von Zeit- und Raumunterschieden. Dieser Begriff von Globalisierung ist natürlich ideologisch, sofern er vorgibt, der Globus sei eine von allen jederzeit herzustellende kommunikative Einheit, während er doch in Wirklichkeit immer noch und sogar zunehmend Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen, terroristischer Überfälle, ökonomischer Berg- und Talfahrten, von Umweltverseuchungen, Naturkatastrophen, Hungersnöten und sozialen Gegensätzen ist.
Um sich also nicht durch einen abstrakten Begriff der Globalisierung täuschen zu lassen, bedarf es des Momentes der materialistischen Dialektik. Dies bedeutet, dass die begriffliche Entzifferung des Seienden anhand der Rekonstruktion seiner Genese außer begriffsgeschichtlichen Elementen und erkenntnisanleitenden Begriffen wie Kommunikation, Vernetzung, Beschleunigung, Wirtschaftsliberalität, Informationsgesellschaft etc. auch phänomenale und sachgeschichtliche Elemente heranziehen muss, die die abstrakten Begriffe erläutern, veranschaulichen, differenzieren und damit erfahrungsbezogen korrigieren sollen. So gilt es, neben den Vorteilen auch die Kosten der Globalisierung vorzuführen und diejenigen zur Sprache kommen zu lassen, die sich davon ausgeschlossen oder sogar bedroht fühlen. Auch die Stimmen der Globalisierungsgegner sind zu berücksichtigen, die auf Globalisierungsgrenzen und -alternativen verweisen. „Alternativen“, schreibt Ulrich Brand,
„entstehen heute allerorten; dort wo es Herrschaft gibt, wehren sich Menschen immer wieder. Diese Kämpfe zunächst einmal zur Kenntnis zu nehmen, auf ihre praktischen Vorschläge von Kapitalismuskritik hin zu befragen und sie in einen weiteren Kontext zu stellen, das ist eine Aufgabe kritischer Gesellschaftstheorie. Ihr Verhältnis zu Praxis kann sein, die Verselbständigungen des gesellschaftlichen Zusammenhanges aufzuzeigen. Theorie kann hier – neben der notwendigen ›internen‹ Verständigung und Weiterentwicklung – anderen Praxen Reflexionsmöglichkeiten bieten. Zugespitzt formuliert: Das Problem heute ist wohl weniger, dass es an gelebten Alternativen fehlt, als vielmehr, dass Alternativen weiterhin ›von oben‹ gedacht werden.“73
Wenn Brands Problembeschreibung zutrifft ist, ist Adornos Theorie auf der Höhe unserer Zeit. Denn das Moment der materialistischen Dialektik verhindert gerade, dass die zu erkennende Sache ‚von oben‘ gedacht und damit idealistisch-begrifflich gleichsam vorfabriziert wird. Philosophische Erkenntnis darf sich nicht mit integralen, z. B. abstrakten oder bloß technischen Begriffen zufrieden geben. Neben theoretischen muss sie auch empirische Elemente in Form von Situationsbeschreibungen, Erfahrungsberichten, historischen Rekonstruktionen, veranschaulichenden Zitaten und verlebendigenden Quellen in ihre Untersuchungen einbeziehen. Natürlich handelt es sich dabei immer um irgendwie schon ‚begriffene‘ Sachen. Jedoch wird philosophische Erkenntnis eben darin ‚materialistisch‘, dass sie die historischen Materialien selber zum Sprechen bringt, statt sie sich vorab mit abstrakten Begriffen idealistisch zurechtzubilden. Anders gesagt, es müssen sich Begriff und Sache wechselseitig erläutern. Nur so ist „die Ideologie positiver, seiender Identität von Wort und Sache“ (63) vermeidbar.
Bezogen auf das Globalisierungsbeispiel bedeutet dies, dass Philosophie das Verhältnis der Globalisierungsbegriffe zur tatsächlich bestehenden Globalisierungspraxis einschließlich deren Einbettung in den gesellschaftlichen Lebenszusammenhang bedenken muss. Auf diese Weise widersetzt sie sich der stets lauernden Gefahr einer Verselbständigung der hauptsächlich von den Globalisierungsbefürwortern verwendeten und geprägten Globalisierungsbegriffe im Sinne ihrer Loslösung von den damit begriffenen Gegenständen. Bezüglich dieser zu Recht geforderten Materialgebundenheit ihrer Begriffe ist negative Dialektik also materialistisch. Idealistisch bleibt sie darin, dass sie die historischen Materialien wesensmäßig zu begreifen und begrifflich zu vereinheitlichen sucht.
Unbeschadet der Aktualität von Adornos hermeneutischer Anweisung, ‚das Seiende als Text seines Werden zu lesen‘, leiden seine programmatischen Äußerungen jedoch unter einer geltungstheoretischen Unterbestimmtheit. Indem Adorno methodologisch der alten hermeneutischen Maxime folgt, der gemäß etwas verstehen bedeutet, es in seinem Gewordensein zu verstehen,74 dispensiert er sich von der Reflexion darauf, was eine Sache über dies historische Gewordensein hinaus ist, d. h. was sie für uns bedeutet und vor allem, was sie uns wert ist. So haben sich Bedeutung und Wert der Globalisierung im Verlauf der letzten 20 Jahre wohl für alle von ihr Betroffenen unterschiedlich stark verändert, und für einen Inder besitzt sie noch heute einen ganz anderen Stellenwert als für einen Nordamerikaner. Außerdem fließt die Bewertung einer Sache stets in die Rekonstruktion ihrer Geschichte ein, indem sie mitbestimmt, unter welchen leitenden Gesichtspunkten, z. B. idealtypischen Begriffen oder systematischen Interessen ich sie vom gegenwärtigen Standpunkt aus beurteile. M. a. W.: In einer rationalen Beurteilung des Globalisierungsphänomens stellen genetische Aspekte ein wichtiges, aber noch nicht zureichendes Theorieelement dar. Um das, was an der Globalisierung richtig und falsch, gut und schlecht ist, begründet unterscheiden zu können, benötige ich neben narrativen auch strukturelle, systematische und normative Elemente. Erst diese machen aus einer bloß hermeneutischen Sicht der Globalisierung eine gesellschaftskritische, wie dies von Adorno zweifelsohne beabsichtigt, wenngleich noch nicht methodisch befriedigend durchgeführt worden ist.
Die These von der Sprache als Horizont und Medium hermeneutischer Erfahrung verbindet Adornos gesellschaftskritische Theorie mit Gadamers geistesgeschichtlicher Hermeneutik:
„Dialektik, dem Wortsinn nach Sprache als Organon des Denkens, wäre der Versuch, das rhetorische Moment kritisch zu erretten … In der rhetorischen Qualität beseelt Kultur, die Gesellschaft, Tradition den Gedanken … In der Dialektik ergreift das rhetorische Moment, entgegen der vulgären Ansicht, die Partei des Inhalts. Es vermittelnd mit dem formalen, logischen, sucht Dialektik, das Dilemma zwischen der beliebigen Meinung und dem wesenlos Korrekten zu meistern“ (66).
Anders jedoch als Gadamers Hauptwerk Wahrheit und Methode, das wohl treffender ‚Wahrheit oder Methode‘ hieße, sucht Adorno die Sprache der Hermeneutik nicht gegen die Logik der Wissenschaft auszuspielen. Vielmehr begreift er die rhetorische Qualität als ein Moment dialektischen Denkens, das es mit dem formal-logischen Moment zu vermitteln gilt.
Zur Verdeutlichung dieser Zusammenhänge ist es hilfreich, zwei Extreme gegenwärtigen philosophischen Denkens kurz zu skizzieren. Der Dekonstruktivismus Jacques Derridas ist zwar von kulturhistorischer Rhetorik im Sinne Adornos beseelt, vernachlässigt dabei jedoch vollkommen die formallogische Stimmigkeit seiner Dekonstruktionen. Daher kann an Derridas Denken, das sich als „von der Dekonstruktion organisierte[s] Spiel der Zerschlagung und Reorganisation von Bedeutung, der Aufhebung der Grenze zwischen Signifikat und Signifikant“75 charakterisieren lässt, der Vorwurf der Beliebigkeit gerichtet werden. Willard van Orman Quine hingegen verzichtet nahezu vollständig auf Kultur, Gesellschaft und Tradition als philosophische Inspirationsquellen. Stattdessen baut er seine behavioristische Sprachtheorie mit den Mitteln der Mathematik, der formalen Logik und technisch präziser Operationalisierungen auf. Adorno paraphrasierend: alles darin ist korrekt, aber Wesensfragen werden nicht gestellt.76
Adornos Insistieren auf der rhetorischen Sprachfunktion ist also nicht bloß ein traditionalistischer Zug. Die Sprache der Philosophie soll nicht nur Informationen und Wissensdaten übermitteln, sie soll das Erkannte auch ausdeuten und sprachlich neu gestalten. Ausdrücklich wird die Darstellungsfunktion philosophischer Sprache der Erkenntnis von Neuem unterstellt:
„Rhetorik vertritt in Philosophie, was anders als in der Sprache nicht gedacht werden kann. Sie behauptet sich in den Postulaten der Darstellung, durch welche Philosophie von der Kommunikation bereits erkannter und fixierter Inhalte sich unterscheidet“ (65).
Differenziert gestaltete Sprache ist für Adorno viel näher an den Sachen und vermag diese daher auch präziser zu thematisieren als jede mathematische Formel: „Idiosynkratische Genauigkeit in der Wahl der Worte, so als ob sie die Sache bennen sollten, ist keiner der geringsten Gründe dafür, daß der Philosophie die Darstellung wesentlich ist“ (61). Ein einfaches Beispiel mag diesen Gedanken erläutern. Es ist bekannt, dass Schulnoten hinsichtlich der durch sie bewerteten Leistungen eine wesentlich geringere Aussagekraft aufweisen als differenzierte Verbalbeurteilungen. Hierüber herrscht offenbar unter allen Experten, zumal unter Pädagogen, Konsens. Dem ungeachtet hat sich das Bewertungssystem der Benotung außer in Waldorf-Schulen allgemein durchgesetzt, weil es eine leichtere Operationalisierbarkeit erlaubt, umfassende Vergleichbarkeiten ermöglicht und damit auf gesellschaftlicher Ebene den Schein von Gerechtigkeit erzeugt. Einer solchen funktionalen Operationalisierung, so notwendig sie in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen auch immer sein mag, hat sich Philosophie nach Adorno zu widersetzen. In ihr muss es um eine möglichst differenzierte Erkenntnis der Sache gehen ohne Rücksicht darauf, wozu philosophisches Wissen sonst noch dienen und verwendet werden kann.
An dieser Stelle ist ein weiterer zentraler philosophischer Begriff zu thematisieren, der vonseiten negativ-dialektischen Denkens massiv kritisiert wird: der des Systems. Systemphilosophie, so Adorno, ignoriert den Eigengehalt der Inhalte des Denkens, indem sie diese in eine starr vorausgesetzte gedankliche Ordnung hineinpresst: „System, Darstellungsform einer Totalität, der nichts extern bleibt, setzt den Gedanken gegenüber jedem seiner Inhalte absolut und verflüchtigt den Inhalt in Gedanken: idealistisch vor aller Argumentation für den Idealismus“ (35). Anhand des oben gewählten Beispiels aus dem Bereich des Schulwesens lässt sich dies daran illustrieren, dass im Schulsystem die Leistungsfunktion über die Leistung selbst, d. h. die präzise Messung, Überprüfung, Verwaltung und Vergleichung von Leistungen über die individuelle Bewältigung konkreter Lernziele und -inhalte gestellt wird. In ihrer funktionalisierten und operationalisierten Darstellungsform wird die systemisch erfasste, ‚evaluierte‘ Leistung ihrer individuellen Hervorbringung, ihren kontextuellen Voraussetzungen und ihren normativen Implikationen nicht gerecht.77 An guten Schulen werden Benotungen, Klausuren und Prüfungen daher zwar als notwendiges Übel, nicht aber als Hauptziel pädagogischer Arbeit angesehen.
Was in der Praxis an systemischer Reglementierung unvermeidbar zu sein scheint, ist in der Arbeit philosophischer Begriffe bei Strafe ihrer Selbstaufhebung strikt zu vermeiden:
„Der unreglementierte Gedanke ist wahlverwandt der Dialektik, die als Kritik am System an das erinnert, was außerhalb des Systems wäre; und die Kraft, welche die dialektische Bewegung in der Erkenntnis entbindet, ist die, welche gegen das System aufbegehrt“ (42).
Dialektik als reflexive Resistenz des Denkens gegen das ihm aufoktroyierte Gedankensystem zielt auf die Erkenntnis des Einzelnen und Besonderen. „Die Kategorien der Kritik am System sind zugleich die, welche das Besondere begreifen“ (38). Erweist sich negative Dialektik darin als Kritik am Idealismus, so stimmt sie mit ihm dennoch im Festhalten an der Verbindlichkeit des Gedachten überein:
„Die Forderung nach Verbindlichkeit ohne System ist die nach Denkmodellen. … Das Modell trifft das Spezifische und mehr als das Spezifische, ohne es in seinen allgemeinen Oberbegriff zu verflüchtigen. Philosophisch denken ist soviel wie in Modellen denken; negative Dialektik ein Ensemble von Modellanalysen“ (39).
Als historisches Beispiel modellartigen, d. h. verbindlichen, jedoch nicht systemischen Denkens nennt Adorno die Enzyklopädie der französischen Aufklärer, in welcher „ein vernünftig Organisiertes und gleichwohl Diskontinuierliches, Unsystematisches, Lockeres […] den selbstkritischen Geist von Vernunft aus[drückt]“ (40). Als aktuelle Beispiele können Adornos eigene zahlreiche Aufsätze und materiale Arbeiten angeführt werden.
Allerdings benutzt Adorno den Systembegriff noch in einem anderen, ontologischen Sinn, der m. E. nicht rational rekonstruierbar ist. Danach müsse die Philosophie den gesellschaftlichern Zwangscharakter als negative Totalität in sich aufnehmen: „Soviel aber bleibt ihr [der Philosophie, U. M.] am System zu achten, wie das ihr Heterogene als System ihr gegenübertritt. Darauf bewegt die verwaltete Welt sich hin. System ist die negative Objektivität, nicht das positive Subjekt“ (31). Wenn das richtig wäre, könnte sich die Philosophie dem Systemgedanken gar nicht widersetzen, weil sie selber von ihm ontologisch immer schon vereinnahmt wäre. Daher sollte im Gegensatz zu Adorno darauf bestanden werden, dass die Interpretation des bestehenden schlechten Zustands als eines Systems lediglich als regulative Idee im kantischen Sinne verwendet werden darf, sofern es überhaupt als plausibel erscheint, das Bestehende, die Wirklichkeit, die Gesellschaft oder die Welt als ein einziges System aufzufassen.
Philosophische Modelle sollen die Wirklichkeit mikrologisch beschreiben. Die rhetorische Sprachfunktion soll dabei die Darstellungsqualitäten der Philosophie transportieren. Dies dient jedoch keinesfalls nur ästhetischen oder pragmatischen Zwecken. Vielmehr soll das rhetorische Moment die philosophische Rede konkretisieren, individualisieren und präzisieren. Es gibt jedoch noch eine weitere Funktion philosophischer Rhetorik, die in der Rettung des Ausdrucks für das Denken besteht:
„Das mag erklären helfen, warum der Philosophie ihre Darstellung nicht gleichgültig und äußerlich ist sondern ihrer Idee immanent. Ihr integrales Ausdrucksmoment, unbegrifflich-mimetisch, wird nur durch Darstellung – die Sprache – objektiviert. Die Freiheit der Philosophie ist nichts anderes als das Vermögen, ihrer Unfreiheit zum Laut zu verhelfen. Wirft das Ausdrucksmoment als mehr sich auf, so artet es in Weltanschauung aus; wo sie des Ausdrucksmoments und der Pflicht zur Darstellung sich begibt, wird sie der Wissenschaft angeglichen. Ausdruck und Stringenz sind ihr keine dichotomischen Möglichkeiten. Sie bedürfen einander, keines ist ohne das andere. Der Ausdruck wird durchs Denken, an dem er sich abmüht wie Denken an ihm, seiner Zufälligkeit enthoben. Denken wird erst als Ausgedrücktes, durch sprachliche Darstellung, bündig; das lax Gesagte ist schlecht gedacht“ (29).
Rhetorik als sprachliches Medium subjektiven Ausdrucks trägt Interessen, Beweggründe und Gefühle in die philosophische Theorie hinein, die dadurch verständlicher, humaner, lebensnäher, besser nachvollziehbar wird. Ohne die Leidenschaft des religiösen Glaubens wäre Kierkegaards Philosophie bloße Logik des Paradoxen; ohne stringenten Gedankengang nur Bekenntnisprosa. Fehlte Schopenhauers Denken der Ausdruck des Leidens an der Welt, mutete es wie eine Verwässerung der kantischen Systematik an. Ohne jedes systematische Moment hingegen wäre es von kulturpessimistischem Defätismus nicht zu unterscheiden. Wenn der Ausdruck einer Philosophie subjektive Aufrichtigkeit und Glaubwürdigkeit verleiht, verschafft ihr die gedankliche Konsequenz Objektivität und Nachhaltigkeit. Erst beide Momente zusammen machen philosophisches Sprechen Adorno zufolge wahrheitsfähig. Nicht durch Ausschaltung menschlicher Motive, Stimmungen und Gefühlslagen wird philosophisches Denken objektiv, sondern durch ihre bewusste Einbeziehung und gedankliche Durchdringung. Warum sollte das individuelle Leiden an den Folgen des Nationalsozialismus, an andauernder Arbeitslosigkeit und Armut nicht in philosophischer Rede zum Ausdruck gebracht werden, da es doch alles andere als bloß individuelle Ursachen hat? Würden Nationalsozialismus und Arbeitslosigkeit hingegen ohne dieses Moment des Leidens thematisiert, verlöre die Untersuchung ihren genuin philosophischen Charakter und ginge in Sozialwissenschaft über. Umgekehrt sähe sich der unreflektierte Leidensausdruck auf eine bloß ästhetische Redeform zurückgeworfen. Beide Thematisierungsweisen sind für Adorno zwar philosophisch durchaus bedeutsam, je für sich jedoch noch nicht philosophisch.
Was also zeichnet philosophisches Denken nach der negativen Dialektik aus?
1. Es ist sachhaltig und begnügt sich nie mit formallogischen Operationen (phänomenologischer Aspekt).
2. Es ist stringent und logisch folgerichtig; eine lose Folge von Impressionen, Gefühlen oder Gedankenblitzen bildet noch keinen philosophischen Text (logischer Aspekt).
3. Es versteift sich nicht auf abstrakte Einzelbegriffe, bleibt nicht bei eindeutigen Etikettierungen stehen, verzichtet auf logische bzw. mathematische Formeln und vermeidet deduktiv gewonnene Begriffsraster, Ordnungsschemata oder Gedankensysteme, mit einem Wort: es setzt auf Begriffskonstellationen (methodologischer Aspekt).
4. Es versucht, den Gegenstand als individuellen sprachlich zu erschließen (intentionaler Aspekt).
5. Es bezieht rhetorisch gestaltete Ausdrucksmomente ein (ästhetischer Aspekt).
6. Es folgt dem Grundsatz der größtmöglichen Differenzierung (qualitativer, bzw. kriteriologischer Aspekt).
7. Positiv zusammengefasst: Es ist wesentlich Kritik und kritische Traditionsanverwandlung. In anderen Worten: „Die Anstrengung, die im Begriff des Denkens selbst, als Widerpart zur passivischen Anschauung, impliziert wird, ist bereits negativ, Auflehnung gegen die Zumutung jedes Unmittelbaren, ihm sich zu beugen“ (30) (programmatischer Aspekt).
8. Negativ zusammengefasst: Es richtet sich gegen abschlusshafte Urteile und jede Form von Dogmatik und bekämpft somit jene Befriedigung, mit der „begriffliche Ordnung sich vor das [schiebt], was Denken begreifen will“ (17) (motivationaler Aspekt).
Es ist abschließend die Frage zu stellen, welcher Begriff philosophischer Erfahrung aus diesen acht Aspekten negativ-dialektischen Denkens spricht. Will man sich der Beantwortung dieser Frage nähern, so ist zunächst zu berücksichtigen, dass die Begriffe von Erkenntnis und in einem emphatischen Sinne verstandener Erfahrung von Adorno größtenteils synonym gebraucht werden. So spricht er von „ungeschmälerter Erkenntnis“ (61), „geistiger Erfahrung“ (57), „dialektischer Erkenntnis“ (59), „philosophischer Erfahrung“ (52), vom „offene[n] Gedanke[n]“ (45), „unreglementierte[n] Gedanke[n]“ (42) oder von „philosophischer Selbstreflexion“ (21) und meint jedes Mal dasselbe, nämlich jene Offenheit, die in der diesbezüglich wohl prägnantesten Formulierung der Einleitung zum Ausdruck gelangt, nach der sie „nichts anderes als die volle, unreduzierte Erfahrung im Medium begrifflicher Reflexion“ (25) sei.
Erfahrung muss also erstens dynamisch und offen sein für eine prinzipiell unendliche Fülle von Erfahrungsmöglichkeiten. Dieses wohl wichtigste Merkmal des in der ND verteidigten Erfahrungsbegriffs wird besonders anhand von Adornos Kritik an Kants Rückbindung aller Erfahrung an die Kategorien als apriorische Denkfunktionen deutlich. Zweitens soll Erfahrung Momente von Lebendigkeit und Spontaneität aufweisen. Dies ermöglicht ihr eine sachangemessene Flexibilität. Drittens muss Erfahrung selbstreflexiv strukturiert sein, um Selbstkorrekturen innerhalb des Erfahrungsprozesses zu ermöglichen. Viertens schließlich besteht ein universales Moment von Erfahrung darin, dass sie nicht nur Experten wie Philosophen oder Künstlern eignet, sondern vielmehr eine allgemeinmenschliche Vollzugs- und Lebensweise ist, die allerdings oft durch restringierende Bedingungen wie Herrschafts- und Marktsysteme verhindert oder eingeschränkt wird.
Obwohl Adorno die Erfahrungsmerkmale Lebendigkeit, Selbstreflexivität und Universalität mit dem Erfahrungskonzept teilt, das Hegel in der Phänomenologie des Geistes78 entfaltet hat, unterscheidet er sich durch das Moment der Erfahrungsoffenheit sowohl von Kant als auch von Hegel. Denn bei Hegel führt Erfahrung notwendig zum absoluten Wissen, ist also immer schon in positiver Weise metaphysisch vorstrukturiert. Bei Kant wiederum ist die Möglichkeit von Erfahrung an die apriorischen Kategorien des Verstandes geknüpft. Die ND dagegen betont mit der Offenheit von Erfahrung die Ungewissheit ihres Gelingens, ihre Vergänglichkeit und Zerbrechlichkeit. Daraus resultiert schließlich auch der weitere wichtige Unterschied, dass Erfahrung bei Kant vom transzendentalen Subjekt, bei Hegel von einem seiner selbst bewussten absoluten Geist, bei Adorno hingegen von leibhaftigen Individuen vollzogen wird.79