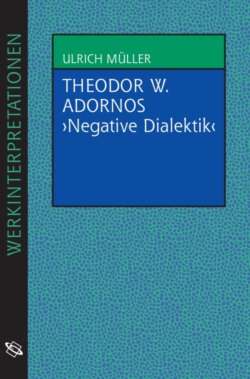Читать книгу Theodor W. Adornos "Negative Dialektik" - Ulrich Muller - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eigenart, Entstehungsgeschichte und Rezeption des Textes
Оглавление„Die ›Negative Dialektik‹, das dicke Kind6, wirst Du unterdessen erhalten haben“, schreibt Adorno am 15. 12. 1966 an Max Horkheimer, „und ich bin natürlich aufs höchste darauf gespannt, wie Du reagieren wirst, ohne im übrigen Dich drängen zu wollen, es rascher zu lesen, als Du und ich halt so etwas zu lesen vermögen. Hoffentlich empfindest Du es nicht als einen Rückfall in die Philosophie. Gemeint ist es vielmehr als der Versuch, aus der philosophischen Problematik selbst heraus deren traditionellen Begriff, gelinde gesagt, zu erweitern […] Kontrovers sein könnte nur, ob man deshalb so sehr mit der sogenannten fachphilosophischen Sphäre sich einlassen soll; aber das entspricht nun einmal meiner Passion für immanente Kritik, die keine bloße Passion ist, und vielleicht auch in dem Buch einigermaßen gerechtfertigt.“7
Adornos Selbsteinschätzung der ND spricht deren Problematik bereits klar an: Die traditionelle Philosophie soll mit ihren eigenen Mitteln überwunden, jedoch keineswegs radikal verabschiedet werden. Beabsichtigt ist vielmehr ein Denken, das, wie es an einer Stelle heißt, „der Tradition sich entäußern muß“ und zugleich „verwandelnd sie aufbewahren könne“ (64). Genau darum geht es in dem Buch. Es bewegt sich im Medium überlieferter Philosophien und genuin philosophischer Begriffe, die jeweils von verschiedenen (erkenntnistheoretischen, soziologischen, politischen, psychologischen, geschichtsphilosophischen etc.) Aspekten her beleuchtet, gedeutet und vor allem kritisiert werden. Die gelieferte Kritik der Philosophie erfolgt also von keinem ‚rein‘ philosophischen, sondern vielmehr einem umfassenderen gesellschaftskritischen Standpunkt aus.
Der dabei verwendete Begriff von Gesellschaft als antagonistische Totalität ist allerdings selber wiederum ein philosophisch-ontologischer: Er bezeichnet die „zwangshafte Verfassung der Realität“ (22), die „objektiv zur Totalität geschürzte Welt“ (28). Und in der Tat besteht das bei weitem größte Problem der ND in ihrem Arbeiten mit eben diesem gesellschaftlichen Totalitätsbegriff: Die bestehende Gesellschaft sei eine „bis ins Innerste falsche Welt“ (41).8 Wenn nun aber das Schlechte des bestehenden Zustands totalisiert wird, wie es bei Adorno an vielen Stellen geschieht, ergibt sich die aporetische Situation, dass der Theoretiker selbst Bestandteil der Totalität ist, die er kritisiert. Gerhard Schweppenhäuser ist hier der Meinung, Adorno habe gesehen, „daß nur die Philosophie weiterführt, die sich dieser Aporie aussetzt“,9 und stimmt ihm darin zu. Ich glaube zwar auch, dass dies Adornos eigene Position war, habe aber großen Zweifel, ob sie sich theoretisch wirklich durchführen lässt. Erstens ist es m. E. gar nicht notwendig, Adorno derart aporetisch, wie er sich offenbar selbst verstand, zu interpretieren, um seine kritische Intention einer Rettung des Einzelnen und Individuellen glaubwürdig vertreten zu können: eine Deutung seines erkenntnistheoretischen Modells als hermeneutische Transformation der kantischen Transzendentalphilosophie etwa verhindert dies.10 Und zweitens bedeutet es eine Abschottung gegenüber jeglicher Empirie, zu behaupten, wirklich alles sei schlecht.11
Kurzum, ich halte den Holismus, das konstitutive Verwenden der Totalitätskategorie, für das größte Problem der ND. Dieses auf Hegel und Lukács gestützte systemphilosophische Erbe wird nun aber konterkariert durch das Denken von Singularitäten und Individualitäten, für das Siegfried Krakauer und Walter Benjamin Adornos wichtigste Inspirationsquellen waren. Es sei bereits hier als erster Orientierungssatz bemerkt, dass sich die nachfolgende Interpretation dem konstitutiven Totalitätsdenken gegenüber kritisch verhalten und die mit diesem Systemdenken zugleich vertretene Hermeneutik von Einzelphänomenen stark machen wird. M. E. lassen sich beide Denkweisen letztlich nicht miteinander vereinbaren, selbst dann nicht, wenn wir, wie viele Interpret(inn)en, die polemisch-kritischen Untertöne in Adornos Verwendung der Totalitätskategorie wahrnehmen und im Vorantreiben des Gegensatzes zwischen kritischem Materialismus und metaphysischem Messianismus eine produktive Offenheit zu sehen bereit sind.12
Gegenüber dem traditions- und gesellschaftskritischen Geschäft der ND tritt die Konturierung und Ausarbeitung ihrer eigenen Position spürbar zurück oder, besser gesagt, sie zeigt sich erst im Vollzug kritisch-hermeneutischen Denkens als die besondere Gestalt, die Adorno dieser methodischen Grundorientierung gibt. Mit ›kritischer Hermeneutik‹ ist hier ein philosophiehistorisches Denken gemeint, das systematische oder strukturelle Elemente verwendet, die nicht ihrerseits wieder hermeneutisch unterwandert und relativiert werden können. Elemente wie ‚Vernunft‘, ‚Selbständigkeit‘, ‚Kritikfähigkeit‘ oder ‚Toleranz‘ lassen sich nicht vollständig historisieren, weil ihr normativer Gehalt nachweislich über die Zeitepoche hinaus, in der diese Ideen entstanden sind, Gültigkeit beansprucht.13 Solche normativen Gesichtspunkte grundieren nach meiner Erfahrung die ND, wenngleich dieser Sachverhalt im Text kaum reflektiert wird. Versteckt jedoch finden sich vernünftige Begründungen der normativen Gehalte, z. B. in Adornos Rückbindung der Philosophie an „ihr sprachliches Wesen“ (65) und an ihren „Einspruch gegen den Mythos“ (66). In einer Zeit des ‚Anything goes‘ ist es geboten, die Leser(innen) an die aufklärungskritische und aufklärerische Absicht der ND zu erinnern – nicht etwa, um dem Buch eine voreilig rationalistische Interpretation angedeihen zu lassen, sondern um das für Adorno noch Selbstverständliche14 unter den veränderten Bedingungen der Globalisierung, der Medien- und Informationsgesellschaft, neu zur Geltung zu bringen. Dies sei als zweiter Orientierungssatz unserer nachfolgenden Interpretation formuliert.
In den bisherigen Interpretationen der ND wurde deren normativ gehaltvolles Moment kritischer Unbedingtheit durchaus verschieden beschrieben, z. B. als „Humanismus“15, „Intransigenz“16, „Vernunftkritik“17 oder „undogmatische Beharrlichkeit“18. Bei aller Verschiedenheit der Deutungen und Rekonstruktionen handelt es sich hier jedoch übereinstimmend um normative Anhaltspunkte kritischen Denkens, die, jeder für sich, rational begründbar sind. Letzteres ist ausschlaggebend, um sie von Elementen bloßer Geistesgeschichte zu unterscheiden – wenngleich Adorno selbst hier keinen Unterschied zu machen bereit war: „Verstehen ist eins mit Kritik; die Fähigkeit des Verstehens, des Verstandenen als eines Geistigen innezuwerden, keine andere als die, wahr und falsch darin zu unterscheiden, wie sehr auch diese Unterscheidung abweichen muß vom Verfahren der gewöhnlichen Logik.“19
Dem Verfahren der gewöhnlichen Logik gegenüber zeigte sich Adorno in hohem Maße gleichgültig, und dieser Sachverhalt erschwert natürlich die Lektüre des Textes. Dialektik wird geradezu als in sich widersprüchliche Methode definiert: „Dialektik als Verfahren heißt, um des einmal an der Sache erfahrenen Widerspruches willen und gegen ihn in Widersprüchen zu denken“ (148). Dieses Dialektikverständnis ist m. E. aber nicht zu retten. Adorno verfolgt mit ihm den Gedanken, die Theorie müsse die „unversöhnte Sache“ (ibid.) gewissermaßen abbilden, um sie kritisch treffen zu können. In Wirklichkeit produziert er damit jedoch nur theoretische Paradoxien und Fragwürdigkeiten, die weder dabei behilflich sind, die in der Sache vermuteten Gegensätze näher zu erläutern oder besser zu verstehen, noch dabei, sie zu kritisieren oder gar aufzulösen.
Unabhängig von der terminologischen Frage, ob sich Gegensätze überhaupt angemessen in Widersprüche übersetzen lassen, oder ob wir nicht besser klar zwischen der realen Opposition zweier Kräfte und der logischen Entgegensetzung zweier Aussagen unterscheiden sollten, wird mit dieser Auffassung von Dialektik als „Ontologie des falschen Zustandes“ (22) das in Frage Gestellte philosophisch nur reproduziert. Wäre Adorno in der ND tatsächlich diesem und nur diesem Dialektikkonzept gefolgt, so wäre die von ihm beabsichtigte und, wie ich meine, zu großen Teilen auch gelungene traditionskritische Anverwandlung der Tradition nicht zu leisten gewesen. Denn gegen Widersprüche in der Sache lässt sich in philosophischer Begrifflichkeit genauso widerspruchsfrei andenken, wie sich real existierende Konflikte in konfliktfreier Rede thematisieren lassen. Dialektik kann nicht, wie Adorno glaubte, „in eins Abdruck des universalen Verblendungszusammenhangs und dessen Kritik“ sein. Und sie muss sich auch nicht „in einer letzten Bewegung sich noch gegen sich selbst kehren“ (397). Wenn wir Dialektik mit Adorno gegen Adorno als „Kritik“ im Sinne des Unterscheidens von Falschem und Richtigen begreifen, brauchen wir auch angesichts ‚letzter‘ metaphysischer Fragen nicht aufhören, dialektisch zu denken.
Doch genau dieses Ende der Dialektik scheint Adorno zu propagieren: „Angesichts der konkreten Möglichkeit von Utopie ist Dialektik die Ontologie des falschen Zustandes. Von ihr wäre ein richtiger befreit, System sowenig wie Widerspruch“ (22). Sofern Adorno seine negative Dialektik an eine holistische Ontologie bindet, muss er sie widerrufen bzw. einschränken, sobald die bestehenden Wirklichkeitsverhältnisse ‚richtig‘ oder ‚richtiger‘ geworden sind. Würde er Dialektik jedoch von vornherein nur als differenzierte Kritik ohne holistische Vorentscheidungen konzipieren, gelangte er erst gar nicht in die Verlegenheit, eine selbstdestruktive Methodologie auf Zeit vertreten zu müssen.
Über diesen generellen Widerspruch hinaus müssen wir in der ND stets darauf gefasst sein, Phänomene als Widersprüche angeboten zu bekommen, die gar keine sind oder wenigstens keine sein müssen: Begriff und Sache, Allgemeines und Besonderes, System und Konkretion, Methode und Inhalt, Subjektivität und Wissenschaft etc. Adorno zeigt sich in diesem Werk als geradezu fetischistischer Begriffspolarisierer. Er lässt kaum eine Gelegenheit aus, philosophische Grundbegriffe in ein dichotomisches Verhältnis zu bringen. Begriffspaare wie ›Methode und Sache‹, ›Wesen und Erscheinung‹, ›Unmittelbarkeit und Vermittlung‹, ›Sein und Seiendes‹, ›Natur und Geschichte‹, ›Identität und Nichtidentisches‹, ›Begriff und Begriffsloses‹ etc. werden ganz selbstverständlich als Widersprüche diskutiert, obwohl es sich dabei doch entweder nur um Komplementärbegriffe (Natur und Geschichte) oder Begriffsoppositionen (Begriff und Begriffsloses) handelt, die als polare Begrenzungen eines zwar weit erstreckten, aber gemeinsamen Begriffsfeldes zwanglos miteinander vereinbar sind.
In der ND finden wir solche Begriffspole in ein Verhältnis wechselseitiger Beeinflussung gebracht, eben ‚dialektisch vermittelt‘. Das bedeutet, dass sie zu einem Punkt geführt werden, an dem sich die Extreme berühren. Und dieses begriffspolare Vermittlungsverfahren erzeugt dann auch so missverständliche und schwer auflösbare Sätze wie „Subjekt ist in Wahrheit nie ganz Subjekt, Objekt nie ganz Objekt; dennoch beide nicht aus einem Dritten herausgestückt, das sie transzendierte“ (177) oder „im Innersten koinzidieren die [These, U. M.] vom Determinismus und die von der Freiheit“ (261).
Doch damit nicht genug. Wie Susan Buck-Morss eingehend dargelegt hat, dichotomisiert und dialektisiert Adorno auch abstrakte Einzelbegriffe wie ›Subjekt‹, ›Identität‹ oder ›Freiheit‹ dergestalt, dass es für ihn immer sowohl ein für Erfahrung offenes Subjekt, als auch ein deformiert verschlossenes gibt, eine gute wie schlechte Identität und eine gelungene wie ideologische Freiheit. M. a. W.: In der Begriffsverwendung ist der positive Begriffspol mit dem negativen eng fusioniert.20
Hinter dieser Begriffstechnik steht natürlich weniger eine ausgeprägte Leidenschaft für Aporien als vielmehr die Absicht, die als antagonistisch angenommene Verfassung der Gesellschaft philosophisch auf den Begriff und zum Ausdruck zu bringen. Adorno möchte durch die Konstruktion aporetischer Ausdrucksformen offen lassen, ob das Subjekt oder das Individuum oder das soziale Ganze jemals ihrer selbst mächtig sein und damit ihren Namen verdienen werden, oder ob diese Begriffe stets ideologisch bleiben, weil sie einen Anspruch stellen, der in der realen Verfassung der Gesellschaft kein Äquivalent findet. Die Differenz zwischen begrifflichem Anspruch und realer Einlösung sucht Adorno also in den Begriff selber hinein zu nehmen. Anders gesagt, er behandelt Einzelbegriffe wie vollständige Aussagesätze. So, wenn er sagt, das idealistische System sei als „vorgängige Allgemeinheit … wahr sowohl wie unwahr: wahr, weil sie jenen ›Äther‹ bildet, den Hegel Geist nennt; unwahr, weil ihre Vernunft noch keine ist, ihre Allgemeinheit Produkt partikularen Interesses“ (22). Des weiteren konfundiert Adorno die philosophischen Bedeutungen der Begriffe ›Positivität‹ und ›Negativität‹ mit ihren alltagssprachlichen Entsprechungen.21 Dieses Verfahren zielt ebenfalls auf eine größtmögliche Öffnung des Bedeutungsspektrums negativ-dialektischer Zentralbegriffe, nimmt dafür jedoch Bedeutungsinkonsistenzen und Verstehensschwierigkeiten in Kauf, die durch eine sorgfältige Unterscheidung der verschiedenen Begriffsbedeutungen durchaus vermeidbar gewesen wären. Letzteres hätte auch Adornos aufklärerischer Grundintention besser entsprochen. Die zwei- oder oft auch mehrsinnige Verwendung abstrakter Begriffe eines personalen oder sozialen Ganzen deutet bereits auf Adornos besonderes Verständnis philosophischer Begrifflichkeit überhaupt hin, das ebenfalls zwischen einem positiven Ideal, der Konstellation mehrerer Einzelbegriffe, und einer vorherrschend schlechten Praxis in Gestalt der Verwendung defizitärer Einzelbegriffe hin und her changiert. Grundsätzlich folgt Adorno dem Hauptstrom der neuzeitlichen Philosophie in dessen sprachtheoretischem Nominalismus. Der (einzelne) Begriff ist für ihn eine Abbreviatur der darunter zusammengefassten Gegenstandsmerkmale, also eine bloße Bezeichnungskonvention. Das Bemerkenswerte an Adornos nominalistischer Grundposition ist jedoch, dass die darin implizierte Begriffsleistung gerade als unzulänglich bewertet wird:
„Der Begriff an sich hypostasiert, vor allem Inhalt, seine eigene Form gegenüber den Inhalten. Damit aber schon das Identitätsprinzip: daß ein Sachverhalt an sich, als Festes, Beständiges, sei, was lediglich denkpraktisch postuliert wird. Identifizierendes Denken vergegenständlicht durch die logische Identität des Begriffs. Dialektik läuft, ihrer subjektiven Seite nach, darauf hinaus, so zu denken, daß nicht länger die Form des Denkens seine Gegenstände zu unveränderlichen, sich selber gleichbleibenden macht; daß sie das seien, widerlegt Erfahrung“ (156f.).
Adorno möchte das begrenzende und fixierende Moment des nominalistisch gedachten Begriffs durch die Verwendung dialektischer, und das heißt in diesem Zusammenhang flexiblerer, differenzierterer und somit auch erfahrungsgesättigterer Begriffe, korrigieren. Allerdings stellt sich die Frage, ob Einzelbegriffe wie Aufklärung, Mythos oder Moderne als solche tatsächlich bereits derart starre logische Vergegenständlichungen darstellen, wie Adorno hier offensichtlich unterstellt. Erstens unterliegen sie, wie die Sprache insgesamt, einem stetigen historischen Wandel, und zweitens verhindert schon der wechselnde Gebrauchskontext eine statische oder endgültige Begriffsfixierung.
Unabhängig davon ist aber die „denkpraktisch[e]“ Unterstellung identischer Bedeutungen zu Verständigungszwecken geradezu notwendig. Wenn wir in unseren täglichen Gesprächen und Diskursen nicht immer wieder identische Bedeutungen zwischen den Sprechern oder zwischen Sprecher und Hörer schlicht voraussetzen würden, wohl wissend, dass sie tatsächlich keineswegs identisch sind, wäre die Möglichkeit von Verständigung nur schwer erklärbar. Dass durch diese kontrafaktische Unterstellung jedoch bereits die Denkinhalte verkürzt, entstellt oder festgeschrieben würden, halte ich für ein Vorurteil, und wie oben gesehen, ist dies auch nicht einfach Adornos Behauptung. Aber gerade deshalb müsste er m. E. erklären, wie denn „der Begriff an sich“ „vor allem Inhalt“ etwas „hypostasieren“ kann, wenn er doch auf jeweils verschiedene Weise sowohl verwendbar ist, als auch verwendet wird, und wenn zugleich eben diese Verwendungsweise, zumindest nach dem späten Wittgenstein, über seine Bedeutung bestimmt.
Unbeschadet solcher Fragwürdigkeiten scheint mir Adornos Begriffskritik schließlich doch auf etwas Richtiges und auch Wichtiges hinzuweisen: Sie lenkt den Blick auf die wesentliche Nicht-Definierbarkeit von Begriffen im Allgemeinen und philosophischen Grundbegriffen im Besonderen. Der abschlussartigen Fixierbarkeit entziehen sie sich durch die nicht wegzudenkende Historizität allen Denkens und Sprechens. Entsprechend käme eine im naturwissenschaftlichen Sinne strenge Definition etwa des Wortes ›Moderne‹ dem Versuch gleich, „dem Gedanken seine geschichtliche Dimension auszutreiben“ (63). Diese Definition müsste etwa die Elemente aller schwarz auf weiß vorliegenden Darstellungen des Begriffs der Modernität, in denen die Interpret(inn)en zum Untersuchungszeitpunkt übereinstimmen, zusammenfügen und das so ermittelte Konzentrat, den gemeinsamen Nenner, zur allgemein gültigen Begriffsdefinition erklären.22
Das Erkenntnisideal der ND ist historische Gerechtigkeit: Begriffe und die mit ihnen bezeichneten Phänomene sollen so unverkürzt und individuell wie möglich erfasst werden. Dazu ist deren historisches wie soziales Eingebettetsein unbedingt mit zu berücksichtigen. Kein anderes, übergeordnetes, praktisches oder sonstwie leitendes Erkenntnisinteresse darf sich davor schieben. „Denken jedoch, das frisch-fröhlich von vorn anfängt, unbekümmert um die geschichtliche Gestalt seiner Probleme, wird erst recht deren Beute“ (28). Erstaunlicherweise richtet sich Adornos Vorwurf des enthistorisierten Denkens auch gegen alle wie immer berechtigte „Kritik an Autorität“ und Überlieferung, sofern sie
„verkennt, daß Tradition der Erkenntnis selbst immanent ist als das vermittelnde Moment ihrer Gegenstände. Erkenntnis verformt diese, sobald sie kraft stillstellender Objektivierung damit tabula rasa macht. Sie hat an sich, noch in ihrer dem Gehalt gegenüber verselbständigten Form, teil an Tradition als unbewußte Erinnerung; keine Frage könnte nur gefragt werden, in der Wissen vom Vergangenen nicht aufbewahrt wäre und weiterdrängte. Die Gestalt des Denkens als innerzeitlicher, motiviert fortschreitender Bewegung gleicht vorweg, mikrokosmisch, der makrokosmischen, geschichtlichen, die in der Struktur von Denken verinnerlicht ward“ (63).
An dieser Stelle kommt Adorno der geistesgeschichtlich orientierten Hermeneutik Hans-Georg Gadamers so nahe wie sonst nie in der ND. Gadamer bekräftigt noch in seinem letzten Buch die Notwendigkeit einer Öffnung der Philosophie für das ‚Prinzip der Wirkungsgeschichte‘, indem er es gegen das naturwissenschaftliche ‚Prinzip der Definition‘, die kurz, präzise und umfassend zu sein hat, absetzt.23 Es ist hier nicht der Ort, auf die Probleme der Gadamer’schen Position näher einzugehen.24 Auch sind die Unterschiede zwischen Adorno und Gadamer nicht zu übersehen, bekennt dieser sich doch offen zur geistigen Autorität der Überlieferung, insbesondere der griechischen Antike, während jener jedes konkrete geistige Vor- oder Leitbild25 energisch zurückweist. Verglichen mit Gadamers großem Buch Wahrheit und Methode26, das reichlich mit Hervorhebungen, Zusammenfassungen, Überschriften, Überblicken und systematischen Texterläuterungen arbeitet, verweigert Adorno sämtliche didaktischen, methodischen und orientierenden Verständnishilfen – nicht etwa, weil er unverstanden bleiben will, sondern weil er sie für ein äußerliches, vom Inhalt nur ablenkendes, ihn gar verzerrendes Mittel hält. Zentrierende Leitbegriffe innerhalb der ND hätten ihm zufolge nur hierarchisch gewichtet, was in der Sache gleichberechtigt nebeneinander stehen muss.27 Adorno begibt sich dem eigenen Anspruch zufolge umstandslos in die ‚Sache selber‘, um sie zu durchdenken und nicht eher wieder zu verlassen, bis sie sich ihm ein Stück weit aufgeschlossen hat.
Genau dies beansprucht er auch von seinen Leser(inne)n: Sie dürfen nicht kontinuierlich fortlaufende Gedankenketten erwarten, bei denen, wie z. B. in Kants Kritik der reinen Vernunft, das Verständnis des ersten Satzes das des zweiten ermöglicht und so fort. Vielmehr müssen sie in den wenigen Kapiteln mit verschiedenen „Bündeln“ oder ganzen „Büscheln“ von lose, z. B. assoziativ miteinander verbundenen Motiven rechnen, wobei die Motivkomplexe untereinander ebenfalls zwanglos verwoben sind.
Lesepraktisch bedeutet dies für uns, mit dem Autor in die Thematik hineinspringen und uns von ihm erst einmal führen lassen zu müssen, bevor wir uns ein Bild von der Sache machen und Einwände begründet formulieren können. Denn dieses Bild setzt sich, Adornos spezifischer Denkweise entsprechend, nicht logisch-systematisch, sondern mosaiksteinartig zusammen. Der Autor benötigt also zunächst unseren „Kredit“, um angemessen wahrgenommen werden zu können. So gesehen steht der Textduktus der ND demjenigen des Hegel’schen Spätwerks durchaus nahe: Es darf und muss über Schwieriges oder gar Unverständliches zunächst hinweg gelesen werden, bis sich nach einer größeren Lesestrecke ein Sinnzusammenhang28 herausschält, sei es durch die an einem exponierten Gedanken vorgenommenen Veränderungen, sei es durch die Quasi-Wiederholung eines Gedankens in anderen Worten, oder sei es durch die wechselseitige Erläuterung verschiedener Gedanken.29
Im Ganzen gesehen macht der Text den Eindruck einer mehrsätzigen Sinfonie, um diesen musikalischen Vergleich für die künstlerisch geschliffene Sprache des Ästhetikers Adorno, der in der ND jedoch bewusst „von allen ästhetischen Themen sich fernhält“ (10), einmal auszunutzen. Quasi-musikalisch verknüpft, ›durchkomponiert‹ sind auch die Themen, Motive und Argumente; weniger der Diskurszusammenhang von Gedanken und Argumenten, als vielmehr die thematische Verwandtschaft und Nachbarschaft der Elemente bestimmen den Textverlauf. Weder einzelne ›Hauptgedanken‹ noch bestimmte ›Kernthesen‹ prägen den Text, sondern dessen differenziertes ›Gewebe‹. Nicht von ungefähr also bindet Adorno selber sein philosophisches Darstellungsideal an die musikalische Kompositionsmethode Arnold Schönbergs:
„An Philosophie bestätigt sich eine Erfahrung, die Schönberg an der traditionellen Musiktheorie notierte: man lerne aus dieser eigentlich nur, wie ein Satz anfange und schließe, nichts über ihn selber, seinen Verlauf. Analog hätte Philosophie sich nicht auf Kategorien zu bringen sondern in gewissem Sinn erst zu komponieren. Sie muß in ihrem Fortgang unablässig sich erneuern, aus der eigenen Kraft ebenso wie aus der Reibung mit dem, woran sie sich mißt; was in ihr sich zuträgt, entscheidet, nicht These oder Position; das Gewebe, nicht der deduktive oder induktive, eingleisige Gedankengang. Daher ist Philosophie wesentlich nicht referierbar“ (44).
Was hier musiktheoretisch erläutert wird, findet sein sprachliches Äquivalent im essayistischen Stil der ND. Denn der Essay als methodisch bestimmte Darstellungsform verkörpert für Adorno das ideale Medium für die von ihm angestrebten Ziele einer größtmöglichen „Individuation der Erkenntnis“ (56) und „Differenzierung“ (57) der Objektwahrnehmung. Die Darstellungsweise des Essays, so Adorno, sei eine anti-architektonische und, so dürfen wir hinzufügen, auch eine anti-kantische, sofern die Architektur des Gedankengebäudes bei Kant eine außergewöhnliche Rolle spielt:
„Alle seine Begriffe sind so darzustellen, daß sie einander tragen, daß ein jeglicher sich artikuliert je nach den Konfigurationen mit anderen. In ihm treten diskret gegeneinander abgesetzte Elemente zu einem Lesbaren zusammen; er erstellt kein Gerüst und keinen Bau. Als Konfiguration aber kristallisieren sich die Elemente durch ihre Bewegung. Jene ist ein Kraftfeld, so wie unterm Blick des Essays jedes geistiges Gebilde in ein Kraftfeld sich verwandeln muß.“ 30
Über die essayistische Gedankenausbreitung hinweg täuscht die relativ klare, wenn auch recht grobe Inhaltsunterteilung der ND in eine kurze Vorrede zur Intention des Buches (9 – 11), eine sehr lange Einleitung zum philosophischen Erfahrungsbegriff (15 – 66), einen ersten „Haupt“31 -Teil, der das kritische Verhältnis der ND zur Existenzialontologie Martin Heideggers behandelt (67 – 136), einen zweiten, in dem Idee und Kategorien einer negativen Dialektik entworfen werden (137 – 207), schließlich einen dritten, der drei Modelle negativ-dialektischen Denkens ausführt (209 – 400): das erste zu Kants Freiheitsbegriff, das zweite zu Hegels Naturgeschichtskonzeption und das dritte zum Problem der Metaphysik.
Adornos Selbstverständnis zufolge müsste eigentlich der dritte Teil der wichtigste oder wenigstens verbindlichste sein, weil er genau dem Rechnung trägt, was die ND wesentlich sein will: „Philosophisch denken ist soviel wie in Modellen denken; negative Dialektik ein Ensemble von Modellanalysen“ (39). Nach meiner Leseerfahrung jedoch sind Einleitung und zweiter „Haupt“-Teil insofern gewichtiger, als in ihnen konstante Motive der Philosophie Adornos überhaupt expliziert werden, z. B. die Identitätsproblematik (148 ff.), der methodisch folgenreiche ›Konstellations‹-Gedanke (164ff.), die ›Subjekt-Objekt-Dialektik‹ (176ff.), das Motiv vom ›Vorrang des Objekts‹ (184ff.) und nicht zuletzt der Zusammenhang von ›Erfahrung‹ und ›Dialektik‹ selber (18ff.). Wir haben es hier gewissermaßen mit Schlüsselbegriffen negativ-dialektischen Denkens zu tun, die Adornos explizit geäußertes Ideal, alle Sätze eines Textes müssten gleich weit von seinem Zentrum entfernt sein32, als Utopie erscheinen lassen, die anzustreben mir darüber hinaus schon aus Orientierungsgründen gar nicht sinnvoll zu sein scheint.
Dies heißt nun aber nicht, derartige Leitmotive würden in den anderen Teilen dieses Werks nicht angesprochen oder wären dort gar unwichtig. Im Gegenteil, wir müssen bei der Lektüre dieses hochkomplexen Textes immer auf Themensprünge, Motivwechsel, Abbrüche gerade begonnener und Wiederaufnahmen zurückliegender Gedanken gefasst sein. Dies gilt auch und gerade für die Diskussion der Tradition: Kant und Hegel sind allgegenwärtig, Benjamin, Lukács und Marx folgen ihnen dicht auf den Fersen und Heidegger dient, übrigens meistens zu Unrecht, als zeitgenössischer Lieblingsgegner.
Die Weise des kritisch eingreifenden und verändernden Umgangs mit der Tradition folgt unterschiedlichen Strategien. Oft werden Theoreme einzelner Denker, bevorzugt wiederum Kants und Hegels, lobend aufgerufen, bzw. ablehnend gebrandmarkt, um die eigene Position zu stützen oder zu konturieren. Dies entspricht den weithin praktizierten und wissenschaftlich anerkannten hermeneutischen Verfahren, wenngleich nur Weniges explizit zitiert wird. Meistens werden andere Theoretiker spontan zur Diskussion eines Themas benannt, kritisiert, miteinander verglichen oder gegeneinander ausgespielt. Ein charakteristisches Beispiel:
„Fraglos hat Hegel, gegen Kant, die Priorität der Synthesis eingeschränkt: er erkannte Vielheit und Einheit, beide bei Kant schon nebeneinander Kategorien, nach dem Muster der Platonischen Spätdialoge als Momente, deren keines ohne das andere sei. Gleichwohl ist Hegel, wie Kant und die gesamte Tradition, auch Platon, parteiisch für die Einheit“ (160).
Im konkreten Fall ergibt sich also das folgende differenzierte Bild: Kant hat etwas Recht, sofern er Vielheit und Einheit als formal gleichberechtigte Kategorien behandelt. Hegel hat etwas mehr Recht, weil er sie in ein beiderseitiges Abhängigkeitsverhältnis brachte. Am meisten Recht hat der späte Platon, der Hegel das Modell dafür lieferte. Aber der „offizielle“ Platon hat in seiner Bevorzugung der Einheit so wenig Recht wie die gesamte Tradition.
Darüber hinaus werden aber auch Philosophien aus dem Blickwinkel anderer Philosophien betrachtet und kritisiert, ohne dass dies eigens angezeigt wird. So verformt Adorno Kant, dem jeweiligen Thema entsprechend, mit Hilfe Hegels (176f.), Kierkegaards (378) und Sohn-Rethels (180 f.), transformiert Hegel durch Benjamin (62) und betrachtet Marx durch die Lukács-Brille (347ff.). Das häufige Wechseln von Brillen, Perspektiven und Standorten erzeugt im Leser mitunter das Gefühl, sich in einem Spiegelkabinett zu befinden. Adorno scheint permanent Zuflucht in der Kritik anderer Teilpositionen zu suchen, ohne doch jemals eine integrale Eigenposition finden zu können.
Trotz dieses heterogenen Bezugsfeldes negativ-dialektischer Kritik bedeutet die Verwendung von Begriffskonstellationen als Kraftfeldern nach Adorno keinen prinzipiellen Verzicht des Essays auf Logik:
„Nur entwickelt er die Gedanken anders als nach der diskursiven Logik. Weder leitet er aus einem Prinzip ab, noch folgert er aus kohärenten Einzelbeobachtungen. Er koordiniert die Elemente, anstatt sie zu subordinieren; und erst der Inbegriff seines Gehalts, nicht die Art von dessen Darstellung ist den logischen Kriterien kommensurabel.“33
Der letzte Satz zumindest muss uns überraschen. Wie soll denn die Logik des wesentlichen „Gehalts“ unabhängig von dessen „unlogischer“ Darstellungsweise fassbar sein? Oder soll hier wieder nur in übertrieben paradoxer Ausformulierung ausgedrückt werden, dass sich die logische Stimmigkeit des Inhalts nicht auf den ersten Blick erschließt, sondern erst nach der mühsamen „Kleinarbeit“ detailgetreuer und differenzierter Beschreibung von Einzelelementen und -aspekten – ähnlich wie sich die Darstellung des Kriegsgrauens in Picassos berühmtem Bild Guernica nicht in der Zusammenschau der dargestellten schrecklichen Einzelheiten ergibt, die für sich genommen keinen verstehbaren Zusammenhang erkennen lassen, sondern nur nach deren sukzessiver Betrachtung sowie der Betrachtung ihrer Wechselwirkung, gewissermaßen als gestückelte Summe statt als integrale Ganzheit?34
Eine solche Interpretation des zitierten Satzes stimmt mit Adornos genereller Auffassung der Dialektik von Form und Inhalt überein und ist auch mit den übrigen Darstellungsleistungen des Essays verträglich. „Der Essay“, führt Daniel Kipfer im Hinblick auf das besondere Philosophieverständnis Adornos in der ND treffend aus,
„gilt ihm als diejenige Darstellungsform, welche die Intentionen negativer Dialektik und deren Verpflichtung auf Sachhaltigkeit, deren Verpflichtung auf Explikation konkreter Gegenstände, beansprucht einlösen zu können. Adornos Begriff des ‚Essays als Form‘ gibt seinen Begriff philosophischer Methode wieder. … Der Essay gibt in begrifflicher Hinsicht das Modell für die Konstellation ab. Begriffe machen sich, so wie sie im Essay verwendet werden, wechselweise gehaltvoll.“35
Die Einlösung seines Ideals philosophischer Konkretion verspricht sich Adorno durch die besonderen Darstellungsqualitäten, an die er das essayistische Denken gebunden sieht:
„Ausdruck und Stringenz sind ihr [der Philosophie, U. M.] keine dichotomischen Möglichkeiten. Sie bedürfen einander, keines ist ohne das andere. Der Ausdruck wird durchs Denken, an dem er sich abmüht wie Denken an ihm, seiner Zufälligkeit enthoben. Denken wird erst als Ausgedrücktes, durch sprachliche Darstellung, bündig; das lax Gesagte ist schlecht gedacht. Durch Ausdruck wird Stringenz dem Ausgedrückten abgezwungen“ (29).
Ihre Darstellungs- und Ausdrucksleistungen erfüllt Adornos philosophische Essayistik, wie Gabriele Stilla-Bowman eingehend vorgeführt hat, einerseits durch rhetorische Strategien, die sich zwischen Subversion und Anklage bewegen, wie die Artikulation gedankengebundener Affekte, Leiden, Enttäuschungen, Hoffnungen, Erwartungen und Bedrohungen; andererseits durch narrative Mittel, die in der ND vor allem in der Nacherzählung des Märchens vom Zwerg Nase (183) und der Erinnerung an Kindheitserfahrungen im Zusammenhang mit der Diskussion Prousts (366) zum Tragen kommen. Die Funktion dieser narrativen Elemente, die jedoch anders als bei Ernst Bloch keine Literarisierung, sondern lediglich eine Verlebendigung der Philosophie darstellen, besteht darin, „das Nicht-Repräsentierbare zum Sprechen zu bringen und seine Verhinderungen darzustellen.“36
Stilla-Bowman zufolge erlangt Adornos metaphernreiche und narrativ implementierte Sprache jedoch nicht das Gewicht, „welches den philosophischen Diskurs entscheidend in die Richtung einer veränderten ausdrucksstarken Subjektivität modifizieren könnte“37. Stattdessen werde seine Theorie „zu einer Position, die zwischen Schuldzuweisung und Opferposition einen Halt sucht“38 Diese These erläutert die Autorin u. a. an. den vielen konjunktivischen Äußerungen der ND wie: „Wahr wäre der Gedanke, der Richtiges wünscht“39 oder: „Wem gelänge, auf das sich zu besinnen, was ihn einmal aus den Worten Luderbach und Schweinsstiege ansprang, wäre wohl näher am absoluten Wissen als das Hegelsche Kapitel, das es dem Leser verspricht, um es ihm überlegen zu versagen.“40 Solche Sätze, die sich beliebig vermehren ließen, deutet Stilla-Bowman als überhöhte Wunschprojektionen, die „den Ausdruck des Bedürfnisses einem moralischen Postulat unter(ordnet).“41
Indessen stellt sich die Frage, ob Adorno wirklich diesen hier unterstellten alternativen Diskurs führen will, oder ob er nicht vielmehr ‚nur‘ den etablierten Philosophiediskurs der Unzulänglichkeit oder sogar Ausweglosigkeit überführen möchte, ohne selbst ein positives ‚Gegenkonzept‘ überhaupt anzusteuern. M. E. ist der Konjunktiv schlicht als Ausdruck der Unentschiedenheit, ob er als Irrealis oder als Potentialis zu lesen sei, aufzufassen. Diese Interpretation kommt den Intentionen Adornos viel näher als eine, die darin das Moment eines dichten Netzes von rhetorischen „Stellvertretungen“ sieht, in denen der individuelle Ausdruck untergehe.42
Wie Britta Scholze richtig diagnostiziert, versucht Adorno stattdessen, „tradierten Kategorien und Begriffen eine neue, nicht affirmative Ausrichtung zu geben, indem er sie bewußt als Analyseinstrumente einsetzt“43, nur dass m. E. eben dieses Verfahren seinerseits als unzulänglich kritisiert werden müsste. Aus meiner Sicht ist Adorno an der Ausformulierung einer vollständig neuen Philosophie überhaupt nicht interessiert. Ein solches Ziel wäre für ihn gleichbedeutend mit einer abstrakten Pauschalnegation der Tradition, die wiederum denjenigen in die Hände spielte, die Veränderungen jeglicher Art von vornherein zu verhindern suchten: „Die Methexis der Philosophie an der Tradition wäre aber einzig deren bestimmte Verneinung. Sie wird gestiftet von den Texten, die sie kritisiert. An ihnen, welche die Tradition ihr zuträgt und die die Texte selbst verkörpern, wird ihr Verhalten der Tradition kommensurabel“ (64).
Adorno gießt also gleichsam neuen Wein in alte Schläuche. Und dieser neue Wein fungiert sozusagen als ‚Kontrastflüssigkeit‘, welche das bestehende ‚Röhrensystem‘ nur desto konturenschärfer hervortreten lässt. Die Konzeption von Philosophie als sprach- und textkritische Disziplin ermöglicht dieser ja gerade das Ausüben der differenzierten und konkreten Kritik, welche die ND als ‚bestimmte Negation‘ auch programmatisch fordert: „Die überlieferte philosophische Problematik ist bestimmt zu negieren, gekettet freilich an deren Fragen“ (28). Im Hinblick auf solche kritisch-bestimmte Traditionsanverwandlung ist die ND ein für Adornos Denken insgesamt durchaus charakteristischer Text. Und dies gilt, wie wir gesehen haben, erst recht für seinen essayistisch-luziden Stil.
Indes finden sich die für Adorno untypischen, vielleicht sogar widersprüchlichen Momente der ND im programmatischen Bereich: Es sollen, wie er sagt, „die Karten auf den Tisch“ gelegt und „eine Methodologie der materialen Arbeiten des Autors“ (9) gegeben werden. Aus diesem ungewöhnlichen Anspruch, welcher der ND u. a. den von Adorno selbst verabscheuten Titel eines Hauptwerks eingetragen hat, leite ich nun als dritten neben dem ‚totalitätskritischen‘ und dem ‚vernunftkritischen‘ den ‚methodologiekritischen‘ Orientierungssatz für die nachfolgende Interpretation ab. Dieser besagt, daß bevorzugt verfahrensbedeutsame Stellen heranzuziehen sind. Damit soll Anderes keineswegs ausgeschlossen oder diskreditiert, sondern nur, der Idee des Buches entsprechend, thematisch gewichtet werden.
Kritisch-reflexive Theorie, welche die ND sein will, war für Adorno die einzige Gestalt von Praxis, die ihm rational verantwortbar erschien.44 In diesem Zusammenhang bezeichnet die Formulierung ‚kritische Anverwandlung der Tradition‘ ein geeignetes Programm für das Verständnis dessen, was Adorno im eingangs zitierten Brief salopp ‚Erweiterung des traditionellen Philosophiebegriffs‘ nannte. Mit ihm lassen sich m. E. viele andere, auf den ersten Blick paradox oder gar aporetisch anmutende Absichtserklärungen der ND – z. B. „mit der Kraft des Subjekts den Trug konstitutiver Subjektivität zu durchbrechen“ (10) oder „über den Begriff durch den Begriff hinauszugelangen“ (27) – durchaus rational rekonstruieren.45 Nur bleibt zu erinnern, dass diese Absichten nicht allein mit den Mitteln einer Kritik, die in jeder Hinsicht auf der Ebene der Voraussetzungen ihres Gegenstandes bleibt, zu realisieren sind. Eine Theorie kann nicht wirklich kritisch sein, wenn sie alle Dimensionen und Maßstäbe ihrer Kritik der kritisierten Sache selber, in diesem Fall der Tradition, entnimmt.46 Offensichtlich muss sie, um die kritisierte Sache nicht nur beschreiben, sondern sich von ihr auch distanzieren zu können, auf Gesichtspunkte zurückgreifen, die im Kritisierten selbst nicht enthalten sind. Es gilt daher, entgegen allen anders lautenden Suggestionen Adornos, denen gemäß Dialektik „in eins Abdruck des universalen Verblendungszusammenhangs und dessen Kritik“ (397) sein müsse, darauf zu bestehen, dass eine Reproduktion des bestehenden Schlechten dieses qua Reproduktion nicht zugleich kritisieren kann. Ein solches ‚Zugleich‘ ist aber durch den Ausdruck „in eins“ angezeigt.
Wenn wir dies zugeben, haben wir jedoch bereits das philosophische Ideal der ‚immanenten Kritik‘, jedenfalls in dem strengen Sinn, den Hegel und Marx mit ihr verbinden, verabschiedet. Kritik ergibt sich nicht gleichsam automatisch aus dem ‚Gang der Sache selbst‘. Vielmehr bedarf sie, wie übrigens auch Adorno wohl wusste, des „Vermögen[s] der Unterscheidung des Erkannten und des bloß konventionell oder unter Autoritätszwang Hingenommenen.“47 Um z. B. den Idealismus zu widerlegen, reicht es eben nicht aus, ihm mit Karl Marx die eigene Melodie vorzusingen48. Eine veränderte Intonation, um im Bild zu bleiben, gehört mindestens dazu.
Was die rationale Rekonstruktion der ND erschwert, ist also nicht zuletzt das Fehlen einer expliziten Reflexion oder auch nur Thematisierung der eigenen Maßstäbe. Denn der Text folgt dem philosophischen Ideal seines Autors darin, „daß die Rechenschaft über das, was man tut, überflüssig wird, indem man es tut“ (58). Auf 400 Druckseiten finden wir keinen einzigen Hinweis zur Methode oder Systematik des Vorgehens – eine Enthaltsamkeit, die ohne Zweifel auch zum weitgehenden Unverständnis der protestierenden Studenten beigetragen hat. Wer mochte sich in Zeiten öffentlicher Protestaufrufe, Strategiepapiere und Rechtsgutachten schon auf eine umfangreiche und überdies höchst schwierige Auseinandersetzung mit dem traditionellen Philosophiebegriff einlassen?
Blicken wir auf die 40-jährige Rezeptionsgeschichte des Werks zurück, so scheint sich bei aller Heterogenität der Positionen, Themen und Darstellungsarten doch ein Trend zu umfassenderen und gründlicheren Abhandlungen einerseits, zu spezielleren und genaueren Untersuchungen andererseits abzuzeichnen. Polemiken und ideologische Grabenkämpfe gehören der Vergangenheit an. Der zögerliche Zuwachs an nicht-deutschen, überwiegend amerikanischen und englischen Adorno-Publikationen ist aufgrund der verspäteten Übersetzung und Rezeption seiner Schriften im Ausland nur verständlich. Verglichen jedoch mit der Dialektik der Aufklärung und der Ästhetischen Theorie erfuhr die ND im Ganzen gesehen deutlich weniger Aufmerksamkeit.
Festzuhalten bleibt, dass Adorno seiner Philosophie mit diesem Buch nicht nur eine Bündelung ihrer wichtigsten Motive und damit Konstanz verschafft hat, sofern sie als 1966 erschienenes Spätwerk an Leitgedanken der beiden programmatischen Aufsätze Die Aktualität der Philosophie49 von 1931 und Die Idee der Naturgeschichte50 von 1932 anknüpft, sondern auch gleichsam ein methodologisches Zentrum seiner vielfältigen theoretischen Bemühungen ausformuliert hat. Von einer Fundierung seiner Philosophie im traditionellen Verständnis dieses Wortes kann im Hinblick auf ihre negativ-metaphysische Zentrierung jedoch keine Rede sein. Denn negative Dialektik, so Adorno, „bezieht nicht vorweg einen Standpunkt“ (17). Ihr Verfahren, so ließe sich ergänzen, besteht wesentlich in vernünftiger, d. h. sachbezogener und konkreter Kritik.