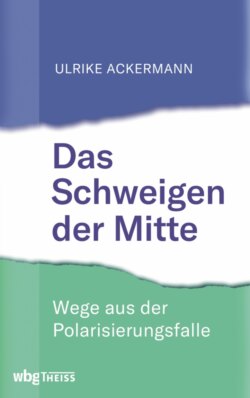Читать книгу Das Schweigen der Mitte - Ulrike Ackermann - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Kongress für kulturelle Freiheit
ОглавлениеDie amerikanisch-deutsche Initiative zur Gründung des Kongresses für kulturelle Freiheit am 26. Juni 1950 in West-Berlin war gewissermaßen die Antwort auf die recht erfolgreiche Arbeit der Kommunisten, die Herzen und Köpfe der Intellektuellen zu erreichen. Als Antwort auf die Erfahrungen des Totalitarismus organisierten und versammelten sich darin regelmäßig namhafte amerikanische und europäische Intellektuelle. Sie einte die Hoffnung auf ein Ende der Ideologien, wie auch 1962 der Buchtitel des bekannten Soziologen Daniel Bell lautete. Der Kongress spielte fortan in der ideologischen Gemengelage eine gewichtige Rolle und die Protagonisten wurden von links und natürlich von den kommunistischen Parteien umgehend als Kalte Krieger beschimpft.
Zu den Hauptakteuren des Kongresses zählten der Schriftsteller Arthur Koestler und der 1920 in New York geborene Journalist Melvin J. Lasky. Koestlers politische Erfahrungen und der Bruch mit der Kommunistischen Partei prägten sein gesamtes literarisches Werk. Sonnenfinsternis, erschienen 1940, ist eines der beeindruckendsten Dokumente über die sogenannten „Großen Säuberungen“ Stalins von 1936 bis 1938. Und Lasky war nach Kriegsende als Kulturoffizier nach Berlin gekommen und hatte 1948 den Monat gegründet. Diese beiden und zahlreiche andere europäische und amerikanische Intellektuelle, die Nationalsozialismus, Faschismus und Stalinismus zumeist am eigenen Leibe erfahren hatten, versammelten sich nun also erstmals 1950 in West-Berlin. Ein antitotalitärer Konsens einte sie, der die Diskussionen beim Kongress und die weitere Arbeit des Netzwerkes bestimmte. Der Sozialdemokrat Carlo Schmid war dabei, Richard Löwenthal, der Historiker Golo Mann, Eugen Kogon, François Bondy, Margarete Buber-Neumann oder der französische Schriftsteller David Rousset. Auch die europäischen Föderalisten, die sich teils schon vor Kriegsende getroffen hatten und nicht zuletzt den Europarat initiierten, waren maßgeblich an der Kongressarbeit beteiligt: u.a. der Italiener Altiero Spinelli und der Franzose Denis de Rougemont. Eine besondere Rolle kam auch hier dem großen Denker des liberalen Antitotalitarismus, Raymond Aron, zu. Als „Steuermann des Kongresses“ bezeichnete ihn François Bondy. Zur Gründungskonferenz waren zahlreiche Emigranten aus Ostmitteleuropa gekommen: u.a. Jerzy Giedroyc, der Begründer der traditionsreichen polnischen, seit 1947 in Paris erscheinenden Exilzeitschrift Kultura. Im Ehrenpräsidium saßen die Philosophen Benedetto Croce, John Dewey, Karl Jaspers, Jacques Maritain und Bertrand Russell. Neben der leidenschaftlichen Verurteilung totalitärer Politik zählten die Debatten über die zukünftige Rolle Europas zu den Höhepunkten der Berliner Konferenz. Die Suche nach dem Standort Europas zwischen den beiden Großmächten war nicht nur wegweisend für die weitere Arbeit des Kongresses, sondern außerordentlich vorausschauend. Zur Abschlusskundgebung versammelten sich im Sommergarten am Berliner Funkturm rund 15.000 Besucher. Alle Reden mündeten in ein großes Plädoyer für ein freies und vereinigtes Europa. Pathetisch schloss Koestler mit den Worten: „Freunde, die Freiheit hat die Offensive ergriffen.“
Während der 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahre entstand in Fortsetzung der Berliner Gründungskonferenz ein einzigartiges Netzwerk europäischer und amerikanischer Intellektueller, dessen Arbeit bis heute nahezu im Verborgenen geblieben ist. Beteiligt daran waren u.a. Hannah Arendt, Albert Camus, Alexander Weißberg-Cybulski, George Orwell, Manès Sperber, Czesław Miłosz, Leszek Kołakowski, François Fejtő und Daniel Bell. Neben der Planung von Konferenzen wurde – in Anknüpfung an den Monat – die Herausgabe weiterer Zeitschriften vorbereitet. François Bondy gründete im Oktober 1951 das französische Pendant, die Zeitschrift Preuves.
Das internationale Exekutiv-Komitee des Kongresses hatte sein Sekretariat in Paris. Bezeichnend für die durchaus symbolträchtige Arbeit des Komitees war der Empfang, den es Czesław Miłosz bei seiner Ankunft in Paris im Frühling 1951 bereitete. Nach seinem Bruch mit der kommunistischen Regierung in Warschau, für die er bis 1950 als Kulturattaché gearbeitet hatte, ging er 1951 ins Exil nach Paris. Denis de Rougemont und Ignazio Silone hießen ihn persönlich willkommen und das Komitee organisierte eine internationale Pressekonferenz mit dem ‚abtrünnigen‘ Milosz. Zwei Jahre später erschien sein großartiges Werk Verführtes Denken – in der deutschen Ausgabe mit einem Vorwort von Karl Jaspers. Darin setzt er sich mit der für Intellektuelle ungeheuren Faszination des siegreichen Kommunismus auseinander. Seine Analyse zählt neben Arons Opium für Intellektuelle zu den eindrücklichsten Arbeiten über die totalitären Versuchungen, denen Intellektuelle ausgesetzt oder erlegen waren. Nach dem Zeitalter der Herrschaft nationalsozialistischer, faschistischer, kommunistischer und antikommunistischer Dogmen suchten die im Kongress versammelten Intellektuellen nach Ressourcen freiheitlicher Denktraditionen, an die sie nach dem Zweiten Weltkrieg und seinen Katastrophen anknüpfen konnten.
Im April 1966 schließlich kam der große Skandal, der langfristig zum Ende des Kongresses für kulturelle Freiheit in den 1970er-Jahren führen sollte: Die Gelder für den Kongress waren nicht, wie angenommen, vonseiten der amerikanischen Gewerkschaften, sondern von der Ford Foundation und der CIA gekommen. Zwar hat selten ein Auslandsgeheimdienst so innovativ und Erkenntnis stiftend investiert, doch der Skandal sorgte im Zuge der Studentenbewegung und der Proteste gegen den Vietnam-Krieg für die sukzessive Aufkündigung des antitotalitären Konsenses bei den Intellektuellen. Sie positionierten sich neu, und der Gewinner war ein linker Antifaschismus, der den amerikanischen Imperialismus geißelte und die Herrschaft des Kommunismus verharmloste.
Jene Debatten, die der Kongress für kulturelle Freiheit angestoßen hatte, hatten immer wieder auch um das Selbstverständnis der Intellektuellen gekreist: Sind sie einem besonderen Tugendkatalog verpflichtet oder wäre dies eine moralische Aufladung und Überdehnung ihrer Rolle und ihres Handelns? Es wurde heftig über die Verantwortung der Intellektuellen, über Selbstkritik und neue Wege der Selbstreflexion gestritten. Und dieser Streit reicht bis heute.