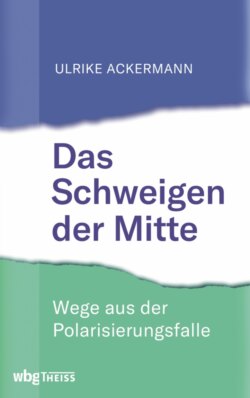Читать книгу Das Schweigen der Mitte - Ulrike Ackermann - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Tabus und Schweigespiralen
ОглавлениеAuch noch 2019 sind zwei Drittel der Bevölkerung laut einer Untersuchung des Instituts für Demoskopie in Allenbach der Überzeugung, man müsse in der Öffentlichkeit „heute sehr aufpassen, zu welchen Themen man sich wie äußert“. Geht es um Klimaschutz, Gleichberechtigung, Arbeitslosigkeit oder Kindererziehung, sei dies kein Problem. Anders verhalte es sich bei heiklen Themen, die als Tabuzonen angesehen werden. 71 Prozent der Bürger sagen, man könne sich zur Flüchtlingsthematik nur mit Vorsicht äußern. Für die Diskussion über die Rolle und den Umgang mit dem Islam sieht das die Bevölkerung ähnlich. 41 Prozent glauben, die Political Correctness werde übertrieben und 35 Prozent sind überzeugt, freie Meinungsäußerungen seien nur im privaten Kreis möglich. Auch die permanente Einführung und Durchsetzung neuer Begriffe geht den Bürgern in großer Mehrheit zu weit. Zwei Drittel halten es für übertrieben, wenn sie den Begriff „Ausländer“ nun ersetzen sollen durch „Menschen mit Migrationshintergrund“. Die jährliche Shell-Studie über die Orientierungen der 12- bis 27-Jährigen weist 2019 in eine ähnliche Richtung. 68 Prozent der Befragten sind der Überzeugung: „In Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden.“
Auch die Genderisierung der Sprache hält eine Mehrheit quer durch alle Bildungsschichten und Generationen für übertrieben. Auf großes Unverständnis stößt ebenso die nachträgliche Umschreibung und Korrektur von historischen Texten – etwa das Ansinnen, den „Negerkönig“ aus Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf in „Südseekönig“ umzubenennen. 75 Prozent halten dies für Unsinn und plädieren für die Beibehaltung der Originalversion. Und das Verständnis für diese Weisen der Sprachregulierungen und Aktivitäten einer Art Diskurspolizei sinkt seit den letzten Jahren bei der Mehrheit der Bürger immer weiter. 57 Prozent „geht es auf die Nerven, das einem immer mehr vorgeschrieben wird, was man sagen darf und wie man sich zu verhalten hat“.
Die Sozialwissenschaftlerin Elisabeth Noelle-Neumann hatte 1980 mit ihrem später in elf Sprachen übersetzten Buch über die sogenannte Schweigespirale bereits diesen wunden Punkt der Meinungsbildung im öffentlichen Raum untersucht. Kurz zusammengefasst geht sie von folgenden Prämissen aus: Da die meisten Menschen soziale Isolation fürchteten, seien sie geneigt, ständig das Verhalten anderer im Auge zu behalten, um besser einschätzen zu können, welche Verhaltensweisen oder Meinungen in der Öffentlichkeit abgelehnt werden oder auf Zustimmung stoßen. Um nicht in soziale Isolation zu geraten, neigten sie dazu, schon bevor es zur Konfrontation oder Ablehnung gekommen ist, ihre eigene Meinung zu verschweigen, weil sie Missfallen auslösen könnte. Jene, die von vornherein öffentliche Unterstützung unterstellen oder schon spüren, äußerten ihre Meinung hingegen vernehmbar und deutlich. Deshalb spricht Noelle-Neumann von einer „Schweigespirale“, die sich in Gang setze, wenn einerseits lautstarke Meinungsäußerungen auf das Schweigen der anderen Seite treffen. Das passiert in der Regel bei kontroversen, emotional aufgeladenen Themen und zwar unabhängig von der realen Stärke der Meinungslager. Eine Minderheitsmeinung kann in der Öffentlichkeit als Mehrheit erscheinen, wenn etwa ihre Anhänger sie mit großem öffentlichen Nachdruck und selbstbewusst vertreten. Und natürlich haben die Massenmedien einen maßgeblichen Einfluss auf diese Prozesse der öffentlichen Meinung. Wenn die Leitmedien oft, „kumulativ“, und übereinstimmend, „konsonant“, eines der Meinungslager unterstützen, sind dessen Chancen natürlich größer, der Schweigespirale zu entkommen. In analogen Zeiten, in denen die Öffentlichkeit noch recht übersichtlich strukturiert war, hatte die sogenannte öffentliche Meinung die Gesellschaft noch eher stabilisieren und integrieren können. Konflikte wurden durch Schweigespiralen zugunsten jeweils einer Auffassung beigelegt, wodurch der öffentlichen Meinung eine nicht unerhebliche Integrationsfunktion zukam. Mit der heillosen Zersplitterung dieser Öffentlichkeit im Internet hat sie diese Integrationsfunktion erheblich eingebüßt, obwohl auch weiterhin Schweigespiralen entstehen. Die Mobilisierungskraft der sozialen Netzwerke zeigt uns inzwischen, in welch atemberaubender Geschwindigkeit Minderheitsmeinungen die Tagespolitik maßgeblich beeinflussen können. Die Gilets jaunes in Frankreich führten vor, wie ein aufbruchswilliger junger, aber auch machtverliebter Präsident vonseiten einer sehr heterogenen, politisch bunt gemischten Truppe, geeint durch Unzufriedenheit und inzwischen hoch militant, unter massiven politischen Druck geraten konnte. Ein anderes Beispiel sehr erfolgreicher Mobilisierung ist die im Oktober 2017 losgetretene #MeToo-Debatte. In der New York Times war zuvor ein Artikel erschienen, der dem Filmproduzenten Harvey Weinstein sexuelle Belästigung zur Last legte. Einige Tage später meldete sich die bekannte US-amerikanische Schauspielerin Alyssa Milano mit dem Hashtag #Me-Too und forderte darin andere Frauen auf, ihrem Beispiel zu folgen und in sozialen Medien eigene Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen, Missbrauch und Diskriminierung zu teilen. Alyssa Milano knüpfte damit an die Aktivistin Tarana Burke an, die das Hashtag bereits 2006 benutzt hatte, um auf sexuellen Missbrauch an afroamerikanischen Frauen aufmerksam zu machen. Endlich ist damit eine internationale Debatte über Missbrauch, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung und Sexismus am Arbeitsplatz, besonders in der Unterhaltungsindustrie und im Kunst- und Kulturbetrieb angestoßen worden. In dieser grundsätzlichen Auseinandersetzung über den aktuellen Stand der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ging es jedoch auch um die Grenzüberschreitungen dieser Aufklärungskampagne und die Zulässigkeit, möglicherweise strafbare Handlungen mit den Erfahrungen von alltäglichem Sexismus ungebührlich zu vermischen. Dankenswerterweise erhoben französische Schauspielerinnen und Schriftstellerinnen Einspruch, angeführt von Catherine Deneuve. Sie kritisierten die Kampagne, und weitere namhafte Frauen schlossen sich an und warnten vor einem neuen Puritanismus, der den Umgang der Geschlechter gleichschalten und die Erotik zwischen ihnen tilgen wolle. Sie traten auch der Vorstellung entgegen, Frauen seien immer und allseits Opfer patriarchalischer, struktureller Gewaltverhältnisse. Seitdem wird darüber gestritten, ob es zulässig ist, unabhängig von juristischer Verfolgung vermeintliche Täter in dieser modernen Form an den Pranger zu stellen.