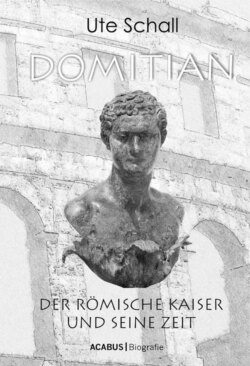Читать книгу Domitian. Der römische Kaiser und seine Zeit - Ute Schall - Страница 7
Gefährliche Jahre
Оглавление„Dazu herrschte eine allgemeine Verwirrung infolge von Neros Tod. Diese Gelegenheit verlockte viele, die Oberherrschaft anzustreben, und die Soldaten waren begierig nach Veränderungen, die ihnen etwas einbrächten.“1 Mit dieser Bemerkung weist der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, von dem später noch ausführlich die Rede sein soll, auf Unruhen in Rom selbst hin, aus denen schließlich Titus Flavius Vespasianus als Sieger hervorgehen sollte.
Im ausgehenden siebenten Jahrzehnt der neuen Zeitrechnung wurden aber nicht nur der Osten des Reiches, namentlich Judäa, und die Hauptstadt selbst von Unruhen erschüttert. Auch im Westen brodelte es, versuchten unterworfene und längst romanisiert geglaubte Volksstämme, durch Neros launige Herrschaft und die Querelen in Palästina ermutigt, das römische Joch abzuschütteln. Die Zeit war gefährlich. Das ganze Imperium Romanum, in vielen Jahrhunderten mühsam und mit gewaltigen Verlusten zusammenerobert, drohte auseinander zu brechen.
Schon im Frühjahr 68 hatte sich die Gallia Lugdunensis mit der Hauptstadt Lyon, bislang ein Paradebeispiel gelungener römischer Provinzialverwaltung, von Rom losgesagt, aber die Legionen des von der Reichsgrenze herbeigeeilten Legaten L. Verginius Rufus hatten die Lage rasch unter Kontrolle gebracht.
Die Lugdunensis blieb kein Einzelfall. Ihrem Beispiel folgten die Bataver, ein Germanenstamm, der am Niederrhein, im heutigen Holland, siedelte. Ein bunt zusammengewürfelter Heereshaufen rechtsrheinischer Germanen, darunter Chatten, Usipeter und Mattiaker, überschritt den Mittelrhein und belagerte das Kastell von Mainz, Mogontiacum, einen der wichtigsten römischen Stützpunkte auf germanischem Boden und Sitz der Legio XXII Primigenia Pia Fidelis. Nur mit Mühe gelang es dem Legaten Vocula, die Ordnung einigermaßen wiederherzustellen und die römische Herrschaft in dieser Ecke des Weltreichs für eine Weile zu sichern.
Da traf Rom ein weiteres Unglück, das im ganzen Reich als göttliches Zeichen angesehen wurde: Im Dezember 69 – Nero war bereits tot – brannte bei Ausschreitungen das Capitol mit dem berühmten Iupitertempel ab, dem symbolischen Mittelpunkt des Weltreichs, dessen Ende nun viele kommen sahen.
Durch diese vermeintliche Botschaft ermuntert, schlossen sich nun auch die gallischen Stämme der Treverer und Lingonen den Aufständen an mit dem Ziel, sich von Rom zu lösen und ein eigenständiges Imperium Galliarum zu errichten.
Zum Glück für das Weltreich bestieg – nach den Interimskaisern Galba, Otho und Vitellius – Titus Flavius Vespasianus den Thron der Caesaren, und der tatkräftige Feldherr, bald unangefochtener Alleinherrscher, hatte zuverlässige Leute, die den stadtrömischen Bürgerkrieg rasch beendeten. Dies war sicherlich auch einer der Gründe dafür, dass sich noch keineswegs alle Gallier erhoben hatten, da sie Vespasians Schlagkraft fürchteten. Die, die bereits den Aufstand probten, konnten unmöglich wissen, dass die Römer über schier unermessliche Reserven verfügten. Auch waren die Aufrührer nicht in der Lage, ihre Handlungen zu koordinieren und errungene Siege auszunutzen.
Nachdem der Bürgerkrieg beendet war, hatte Rom also freie Hand, mit der gefährlichen Situation am Rhein fertig zu werden. Im Frühjahr 70 marschierten aus Italien fünf Legionen ab, drei kamen aus Spanien, und auch in Britannien setzte sich eine Legion Richtung Süden in Bewegung. Der Aufstand brach rasch zusammen. Bis zum Herbst 70 hatte Rom die Lage wieder in der Hand. Die siegreichen römischen Feldherren waren klug genug, über die geschlagenen Völker kein Strafgericht zu verhängen.
Bereits im Juni 68 hatte der von Nero mit dem Oberbefehl über die römischen Truppen in Judäa betraute Vespasian fast das ganze Land mit Ausnahme Jerusalems und einiger Festungen bezwungen. Als er von Neros Selbstmord hörte, brach er den Feldzug ab. Nach außen hin erkannte er jeden der drei neuen Kaiser an. Insgeheim aber traf er Vorbereitungen, den Thron der Caesaren für sich zu gewinnen. Er sicherte sich die Unterstützung des Mucianus, des Statthalters von Syrien, und Tiberius Alexanders, des Präfekten von Ägypten, eines einflussreichen jüdischen Renegaten. Mucianus betraute er später mit der Leitung der Staatsgeschäfte in Rom, ehe er selbst im Herbst 70 n. Chr. dort erschien.
Bereits im Juli 69 riefen ihn die in Ägypten, Syrien und Judäa stationierten Legionen zum Kaiser aus. „Die Donaugarnisonen folgten nach, und man entwarf Pläne für den Angriff auf Italien. Während Vespasian selbst in Ägypten blieb, um Rom die Getreidezufuhr abzuschneiden, sollte Mucianus das Hauptheer nach Westen führen.“2
Der Bürgerkrieg des kommenden Jahres forderte dann auch in Vespasians Familie ein prominentes Opfer. Sein Bruder Sabinus, Stadtpräfekt von Rom, suchte während der blutigen Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern von Vitellius und denen der aufstrebenden Flavier am 18. Dezember 69 auf dem Capitol Zuflucht, wurde aber von Vitellius’ Leuten aufgespürt und kam um. Man hatte ihn in Ketten vor Vitellius geführt, der ihn mit durchaus nicht feindseliger Miene empfing. Aber der blutgierige Pöbel nötigte dem noch amtierenden Kaiser Sabinus’ Hinrichtung ab. Man schleppte den zerschundenen Leichnam, dem man den Kopf abgeschlagen hatte, auf die Gemonische Treppe, den Ort öffentlicher Leichenschändung.
Domitian, Sabinus’ Neffe, der mit ihm geflohen war, brachte, „als … der Tempel in Flammen stand“, die Nacht heimlich beim Tempelhüter zu. „Am nächsten Morgen verkleidete er sich als Isispriester, mischte sich unter die Opferdiener verschiedener Religionen und begab sich mit nur einem Begleiter zur Mutter eines Schulkameraden auf das andere Tiberufer, wo er sich so gut verborgen hielt, dass er von den Häschern, die seinen Spuren gefolgt waren, nicht ausfindig gemacht werden konnte.“3 Er verließ sein Versteck erst, nachdem feststand, dass sein Vater Kaiser geworden war, wurde als Caesar begrüßt und übernahm das Amt des Stadtprätors mit konsularischer Gewalt. Er war jedoch nur nominelles Staatsoberhaupt, da Mucianus inzwischen im Auftrag seines Vaters die Staatsgeschäfte führte. Dennoch hätte er sich trotz seiner Jugend an seine Stellung gewöhnen können. „Nachdem er Kaiser geworden war, sorgte Domitian dafür, dass seine Taten aus jener Zeit durch Reliefs und die Hofdichtung verherrlicht wurden.“4 Die Hütte des Tempelhüters ließ er niederreißen und „baute Jupiter dem Erretter eine kleine Kapelle nebst einem Altar, der auf dem Marmor seine Begegnisse darstellte; nachher, als er zur Regierung gelangt war, weihte er Jupiter dem Hüter einen ungeheuren Tempel und sein eigenes Bild im Schoße des Gottes“5. Seine frühe Karriere endete jäh, als Vespasian vom jüdischen Kriegsschauplatz nach Rom zurückkehrte. Offensichtlich wurde Domitian von da an zu keiner vernünftigen Beschäftigung mehr herangezogen. Sein Vater und danach sein kaiserlicher Bruder übertrugen ihm eine Reihe bedeutungsloser Ehrenämter. Er blieb bis zum Jahr 81, als er nach dem frühen Tod seines Bruders Titus selbst den Thron bestieg, stummer Beobachter, wenn er auch mit großem Interesse und wachem Verstand das Staatsgeschehen verfolgte. Die Zügel der Macht schon ganz allein in Händen haltend, habe er sie, sagt der zeitgenössische Dichter Martial, dennoch wieder abgeben müssen und sei in einer Welt, die schon einmal ihm gehört habe, nach Vespasian und Titus nur mehr der Dritte gewesen.6
Vespasian überließ Titus, seinem älteren Sohn, der mit ihm zur Befriedung Judäas ausgesandt worden war, die Beendigung des jüdischen Krieges und machte sich auf den Heimweg. Ihm muss bewusst gewesen sein, dass Titus die Angelegenheiten im Osten in seinem Sinn fortführen und zur Zufriedenheit Roms beenden würde. Dass sein Sieg ein so vollkommener wäre, konnte der Vater aber kaum voraussehen. Titus’ überwältigender Triumph stellte den jüngeren Flaviersohn nun endgültig in den Schatten des politischen Geschehens.
Fast ein ganzes Jahr lang hatten die Römer den Juden eine unfreiwillige Ruhepause gewährt, da Vespasian mit der Sicherung seiner eigenen Stellung beschäftigt war. Die Juden nutzten diese kampffreie Zeit allerdings schlecht. Statt ihre noch vorhandenen Kräfte zu schonen und zu erneuern, begannen sie wieder, sich wie früher gegenseitig zu bekämpfen. Es kam in Jerusalem zu innerstädtischen Auseinandersetzungen zwischen Gemäßigten und Anhängern der radikalen Zelotenpartei, die Angehörige des Stadtadels gefangen nahmen und den Einfluss der Hohepriesterschaft zu unterwandern versuchten. Sie ersetzten den amtierenden Hohepriester durch einen Mann niederen Standes, der nicht nur ungebildet, sondern auch mit der Pflicht des obersten religiösen Würdenträgers der Juden nicht vertraut war. Damit brachen sie mit der romfreundlichen Tradition und schafften die angestammten Vorrechte jener Familien ab, die bislang die Amtsträger gestellt hatten – eine ungeheure Provokation der römischen Schutzmacht, die entsprechend reagierte.
Aber nicht nur sie war brüskiert. Das Volk empörte sich über das Sakrileg, und der älteste Hohepriester, Ananos, heizte die Stimmung gegen die Aufrührer in geschickter Rede noch an. Der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus bezeichnet ihn als einen höchst verständigen Mann, „der vielleicht auch die Stadt gerettet haben würde, wenn er den Händen der Mörder entkommen wäre“7. Das Schicksal war den Juden aber nicht so gnädig.
Voll Erbitterung stürzten sich die rivalisierenden Parteien aufeinander, und es bewahrheitete sich einmal mehr das Sprichwort vom sich freuenden Dritten, der zwei streitende Gegner beobachtet. So war Titus’ Sieg weniger der römischen Überlegenheit zuzuschreiben als der jüdischen Uneinigkeit.
Der Übermacht der Gemäßigten weichend, zogen sich die Zeloten bald in das Innere des Tempels zurück, wohl wissend, dass Ananos kaum wagen würde, die heiligen Pforten zu sprengen. Tatsächlich hielt es dieser für gesetzeswidrig, seine Anhänger ohne die vorgeschriebenen Reinigungsriten in den göttlichen Bezirk zu führen. Er wählte deshalb 6.000 Mann aus, die er als Wachen vor den Hallen aufstellte, um seine Gegner am Entkommen zu hindern. Ein Verräter in Ananos’ Reihen, ein Mann namens Johannes, der aus Gischala geflohen war und den Hohepriester selbst bei den geheimsten Unterredungen begleitet hatte, hinterbrachte den Eingeschlossenen auf dem Tempelberg, dass Ananos das Volk überredet hätte, Gesandte zu Vespasian zu schicken, damit er heranrücke und sich der Stadt bemächtige. Wollte man ihr Leben nicht aufs Spiel setzten, sei auswärtige Hilfe vonnöten.
Die Zeloten suchten daraufhin bei den Idumäern um Unterstützung nach, einem ungestümen, zügellosen Volk, das für seine stetige Kampfbereitschaft bekannt war.
Bald rückten 20.000 Mann an und belagerten Jerusalem. Im Schutze der Dunkelheit und eines heftigen Unwetters gelang es einigen Zeloten, die Belagerer in die Stadt zu schleusen. Dort befreiten diese zunächst deren eingeschlossene Gesinnungsgenossen, nachdem sie die Wachen überwältigt hatten. Geschrei drang vom Tempelberg in die Stadt, aber niemand wagte, sich den militanten Eindringlingen entgegenzuwerfen. Viele Menschen fanden bei den nächtlichen Kämpfen den Tod. Am nächsten Morgen zählte man nicht weniger als 8.500 Leichen. Auch Ananos wurde kurze Zeit später erschlagen. „Ich irre nicht“, bemerkt Flavius Josephus, „wenn ich sage: Mit dem Tod des Ananos nahm der Untergang der Stadt seinen Anfang, und von dem Tag an, da die Juden ihren Hohepriester, den Mann, der ihnen den Weg zur Rettung gewiesen, mitten in der Stadt hingemordet sahen, war ihre Mauer zerstört, der jüdische Staat vernichtet.“8
Beim Abschlachten ihrer Glaubensgenossen erwiesen sich die Zeloten als so gewalttätig, dass sich viele der auswärtigen Krieger angewidert abwandten und nach Hause zurückkehrten.
Aus der Ferne beobachtete Vespasian geduldig die innerjüdischen Schlächtereien getreu dem römischen Grundsatz: Divide et impera – teile und herrsche! Auch diesmal sollte sich der Leitspruch der römischen Expansionspolitik als für Rom nützlich erweisen.
Kaum hatten sich die Idumäer vom blutgetränkten Jerusalem abgewandt, zogen die Zeloten die übelsten Register ihrer Grausamkeit. „Alle menschlichen Rechte wurden mit Füßen getreten, die göttlichen verhöhnt, die Weissagungen der Propheten als betrügerisches Geschwätz verlacht.“9 Erbarmungslos wurde gefoltert, erschlagen, verbrannt. Es gab Warnungen gottesfürchtiger Männer, die Stadt werde eingenommen werden und das Allerheiligste in Flammen aufgehen, sollte der Aufruhr fortgesetzt und das Heiligtum von den eigenen Händen befleckt werden.
Waren die Zeloten auch nicht unempfänglich für diese makabren Vorhersagen, so trugen sie doch selbst zu deren Erfüllung bei.
Johannes’ Führungsanspruch traf auf den Eleazars, des Anführers der Zeloten. Dazu kam eine dritte Kraft, die der Nationalisten unter einem Mann namens Simon, dem Sohn des Giora. Auch er wollte nach Ananos’ Tod den Oberbefehl über Jerusalem erlangen, wenngleich er um die Ansprüche von Johannes und Eleazar wusste.
Er sammelte ein Heer und erschien im Frühjahr 69 vor den Toren der jüdischen Hauptstadt. Dort hatten seine beiden Rivalen inzwischen ein solches Schreckensregiment errichtet, dass der Bevölkerung im Vergleich dazu jedes andere Übel gering erschien. Man hoffte auf Simon und hieß ihn willkommen. Kaum aber hatte er sich in der Stadt etabliert, unterschied er sich in nichts mehr von seinen Gegnern.
Das Volk wurde nun unbarmherzig zwischen den widerstrebenden Interessen zerrieben. Nicht nur zahllose Menschen verloren ihr Leben. Bei den Auseinandersetzungen gingen, als in der Umgebung des Tempelbergs alles eingeäschert war, auch Getreidevorräte in Flammen auf, die für eine jahrelange Belagerung ausgereicht hätten – eine Tatsache, die kurze Zeit später den Römern den Kampf um Jerusalem erheblich erleichtern sollte.
Derart waren die Verhältnisse in Judäa, als Vespasian im Sommer 69 zum Kaiser ausgerufen wurde: Nordost-Judäa und Idumäa hatte der Feldherr ohne große Schwierigkeiten für Rom zurückerobert. Jetzt befanden sich nur noch die Festungen Herodion, Machaerus und Masada in aufständischer Hand, dazu einige Höhlen über dem Toten Meer, die für Rom jedoch wenig gefährlich waren, und Jerusalem, dessen Schicksal noch einmal aufgeschoben wurde.
Der neue römische Kaiser begab sich mit seinem Sohn Titus nach Berytos (Beirut), um Kriegsrat zu halten. Er schenkte (Flavius) Josephus die Freiheit, da sich dessen Prophezeiung, Vespasian werde die Herrscherwürde erlangen, erfüllt hatte. Die römischen Streitkräfte waren inzwischen auf vier Legionen angewachsen, als die XII. Legion Fulminata aus Syrien dazugestoßen war. Vespasian schickte sich an, den jüdischen Kriegsschauplatz zu verlassen, und Titus rückte mit seiner gewaltigen Streitmacht gegen die Hauptstadt Israels vor, deren Tage nun gezählt waren.
Nur vorübergehend vermochte die drückende feindliche Übermacht die rivalisierenden jüdischen Parteien zu einen. Bald widmeten sie sich wieder ihrem inneren Zwist. Titus’ Bemühen, unter Flavius Josephus’ Vermittlung Friedensbedingungen auszuhandeln, schlugen fehl.
Als erster blieb, eher zufällig, Eleazar auf der Strecke. Als die römischen Sturmböcke in Stellung gebracht wurden, erkannte Johannes, der Not gehorchend, Simons Führerschaft, die diesem durch ein Volksbegehren längst übertragen worden war, an und erklärte sich bereit, mit ihm zur Verteidigung der Stadt zusammenzuarbeiten. Es war zu spät.
Immer wieder versucht Flavius Josephus, seinen Freund Titus von der Schuld an der Zerstörung Jerusalems rein zu waschen, wie überhaupt Vespasians älterer Sohn in der Geschichtsschreibung in äußerst günstigem Licht erscheint, möglicherweise, weil seine Herrschaft nur von kurzer Dauer war. Der jüngere Domitian hingegen wird als Bösewicht schlechthin dargestellt.
Bis heute ist allerdings umstritten, welche Rolle Titus im Kampf um Jerusalem und vor allem bei der Zerstörung des Tempels tatsächlich spielte. Hat er nichts sehnlicher gewünscht, als Stadt und Heiligtum zu erhalten? Machte er deshalb den Belagerten ein weiteres Friedensangebot, das seine jüdischen Gegner aber als Zeichen der Schwäche auslegten und ablehnten? Flavius Josephus behauptet es. Er war Titus verpflichtet, da er ihm sein Leben verdankte. Aber er war auch Jude und der einzige Augenzeuge, der der Nachwelt über das Geschehen und den Fall Jerusalems berichtete.
Auch andere Historiker gestehen Titus, „dem Glück und der Wonne des Menschengeschlechts“, eine für einen Römer geradezu unwahrscheinliche Milde zu.10
Er habe es, sagen wieder andere, darüber hinaus eilig gehabt, von dem für ihn öden Judäa nach Rom zurückzukehren, das er als einfacher Privatmann verlassen hatte und als Sohn des Kaisers wiedersehen sollte und das einem Sterblichen noch immer den höchsten Lebensgenuss bot. Ein schneller Friedensschluss wäre ihm deshalb willkommen gewesen. Und noch etwas spricht für Titus’ Absicht, Jerusalem zu schonen: Er war zu Berenike, der Schwester Agrippas II., des Königs von Chalcis, in heftiger Leidenschaft entbrannt, und er wusste, wie sehr das Herz seiner Geliebten an der heiligen Stadt hing.
Wenn er tatsächlich an Schonung gedacht hatte, nahmen die Ereignisse bald ihren eigenen Lauf. Letzte Vermittlungsversuche des Flavius Josephus, der als Jude die Juden in ihrer Muttersprache, dem Aramäischen, zur Einsicht beschwor, bewirkten bei den sturen und verbohrten Einheimischen nichts. Das wohlwollende Bemühen erntete nur Spott und Hohn. Die Anführer der Jerusalemer Bürgerschaft hatten jeden, der den Römern nachzugeben riet, mit dem Tod bedroht.
Ohnehin hielt dieser in der belagerten Stadt reiche Ernte. Die Hungersnot war so groß wie die Wut der Herrschenden, die jeden Winkel nach Essbarem durchforschten, sich nahmen, was sie brauchen konnten und dabei vor keiner Art von Gewalt zurückschreckten. Keine Stadt, so klagt der historische Zeitzeuge, habe je Ähnliches auszuhalten gehabt, und kein Geschlecht sei, solange die Welt besteht, erfinderischer in den Werken der Bosheit gewesen.11
Titus verlor langsam die Geduld und gab Jerusalem zum Sturm frei. Gespenstisch muteten Stadt und Umgebung mittlerweile an. Sie hatten ihr Aussehen völlig verändert. Zum Bau der Wälle hatten die Römer ringsum alles kahl geschlagen. Die Gegend, „die zuvor mit Bäumen und Parks geschmückt war, lag jetzt allenthalben verwüstet und des Holzes beraubt. Kein Fremder, der das alte Judäa und die herrlichen Vorstädte Jerusalems gesehen, hatte beim Anblick der damaligen Verödung seine Tränen und Seufzer über das Ausmaß der Veränderung zurückhalten können“12. Selbst für die Römer kann das Ziel ihrer Begierde nicht mehr allzu verlockend gewesen sein.
Am tragischsten freilich war der letzte Akt im dramatischen Schauspiel des Untergangs einer Stadt, die seit über 1.000 Jahren zu den eindrucksvollsten Siedlungsplätzen der Welt gehört hatte.
Nachdem die Mauern gestürmt waren, ging der herodianische Tempel, ein Wunderwerk architektonischer Baukunst, der erst kürzlich fertiggestellt worden war, in Flammen auf. Vielleicht waren Titus und seine Berater tatsächlich übereingekommen, das prächtige Bauwerk um seiner Schönheit und Einzigartigkeit willen zu schonen. Die Dinge entzogen sich jedoch bald jeder Kontrolle und nahmen ihren eigenen Lauf.
Der römische Feldherr ließ die Umfassungsmauer des Tempelareals niederbrennen und befahl, das Heiligtum zu erobern, aber nicht zu zerstören, wenn auch viele aus dem Beraterstab die Auffassung vertreten hatten, es werde, unversehrt, immer ein Herd des Widerstandes bleiben.
Aber ein römischer Soldat ergriff ein brennendes Holzscheit und schleuderte es, ohne viel nachzudenken, durch das goldene Tempeltor. In Windeseile ging das trockene Holz der Hallen in Flammen auf, und niemandem gelang es, das alles verheerende Feuer unter Kontrolle zu bringen.
Titus, entsetzt, aber dabei doch von der vielen Römern eigenen Neugierde getrieben, drang ins Allerheiligste vor, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen. Im letzten Augenblick gelang es den Römern, den Tempelschatz in Sicherheit zu bringen, goldene Möbel, Trompeten, den Tisch mit den Schaubroten und den siebenarmigen Leuchter, die berühmte und symbolträchtige Menorah.
Domitian war beim Untergang Jerusalems zwar nicht anwesend – er hielt sich, zur Untätigkeit gezwungen, in Rom auf. Aber er erfuhr von den schrecklichen Geschehnissen durch den jüdischen Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der im Gefolge des Titus nach Rom gekommen und zum Freund der kaiserlichen Familie aufgestiegen war, und von seinem Bruder selbst, der ja diesen Vernichtungsfeldzug gegen die Juden geführt hatte. Jahre später, nach Titus’ frühem Tod, hielt Domitian die wohl düsterste Stunde des Judentums in einem imposanten Bauwerk fest: An der Innenseite des Titus-Bogens, den er dem Andenken seines siegreichen Bruders widmete, stellt ein Relief die für Judäa so demütigenden Ereignisse des Jahres 70 n. Chr. dar. Es heißt übrigens, kein frommer Jude sei je freiwillig durch diesen Bogen hindurchgegangen.
Bald nach der Zerstörung Jerusalems kehrte Titus im Sommer des Jahres 71 n. Chr. als Triumphator nach Rom zurück. Einen Teil seiner Rache an den Juden hatte er sich für eine besondere Gelegenheit aufbewahrt: Als er in Caesarea den Geburtstag Domitians feierte, opferte er dem Bruder zu Ehren zahlreiche Kriegsgefangene – von 2.500 Menschen ist die Rede – in „Spielen“ mit wilden Tieren, durch Verbrennen oder in Zweikämpfen.
Ein Gefangener kam allerdings nicht nur mit dem Leben davon. Er sollte in Rom und in der alten Welt noch zu besonderen Ehren gelangen. Es war der bereits öfter genannte Flavius Josephus. Er war Priester und Historiker und hatte Vespasian, wie erwähnt, die Kaiserwürde vorausgesagt, was ihm das Leben rettete.