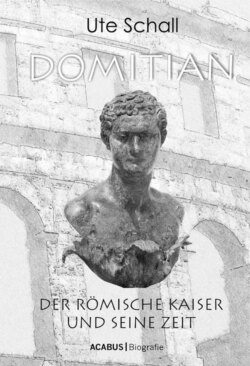Читать книгу Domitian. Der römische Kaiser und seine Zeit - Ute Schall - Страница 8
Ein jüdischer Seher und der Aufstieg eines neuen Geschlechts
ОглавлениеDrehen wir das Rad der Geschichte noch einmal einige Monate zurück, um die für die Entwicklung Roms und der flavischen Dynastie so bedeutsamen Ereignisse des Jahres 69 n. Chr., das nach dem bereits erwähnten Aussterben des julisch-claudischen Kaiserhauses einen neuen Abschnitt der Geschichte der alten Welt einleitete, näher zu beleuchten. Vespasian ist noch nicht zum Kaiser ausgerufen worden. Die Verhältnisse des Römischen Reiches sind verworren und kosten den loyalen Feldherrn im entlegenen Osten manche schlaflose Nacht.
Erschreckende Nachrichten sind zu ihm nach Judäa gedrungen. Galba, ein Mann edler Abstammung, aber ein gichtiger Greis, hat das Ruder der Staatsführung an sich gerissen, doch seine Herrschaft währt, wie zu erwarten gewesen war, nur ein halbes Jahr. Man sagt ihm die üblichen Laster nach, aber nicht sie trugen die Schuld daran, dass er die Bühne des Weltgeschehens so schnell wieder verließ. Strenge und eine bis zum Geiz gesteigerte Sparsamkeit empörten Soldaten und Plebs und galten in jener Epoche als todeswürdiges Verbrechen. Kein Wunder also, dass seine Tage von Anfang an gezählt waren. Mitte Januar 69 begegnete man am Eingang zum Forum Romanum dem alten Mann, „der seinen Kopf zur Sänfte herausstreckte und keine Gelegenheit mehr fand, ihn wieder zurückzuziehen“1.
Otho, ein bankrotter Senator, folgte ihm auf den Thron. Er hatte seine Gläubiger wissen lassen, er könne seine Schulden nur zurückzahlen, wenn er Kaiser würde. So hatten sie ein verständliches Interesse daran, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Man brachte ihm Galbas abgeschlagenes Haupt. Da er dieses an den blutverschmierten Haaren nicht fassen konnte, hielt er es mit dem Daumen im Mund fest. Die Prätorianer schlugen sich auf Othos Seite, und er trat eine glücklose, nur 95 Tage währende und mit den üblichen Lastern ausgefüllte Herrschaft an. Am 96. Tag steckte er zwei scharfe Dolche unter sein Kopfkissen, mit denen er sich am nächsten Morgen umbrachte. Denn General Vitellius, ein Vielfraß und unbändiger Schlemmer, rückte mit seinen kampfkräftigen Legionen, aus Germanien kommend, in Italien ein – seine Männer hatten inzwischen auch ihn zum Kaiser ausgerufen – und traf bei Cremona auf die Legionäre Vespasians, die ihrerseits den tapferen Feldherrn des jüdischen Krieges zum Herrscher erkoren hatten.
In einer der blutigsten und grausamsten Schlachten des gesamten Altertums schlugen Vespasians Sympathisanten die seines Gegners vernichtend. Vitellius nahm die Niederlage gelassen hin. Er ließ sich noch einmal ein Schlemmermahl zubereiten, dessen Verzehr einen Tag und eine Nacht dauerte, und hörte erst auf zu essen, als Vespasians Truppen bereits in die Stadt eingedrungen waren.
Glauben wir Tacitus, begleitete das Volk die Kämpfe der verfeindeten Truppen unbeteiligt, aber mit größtem Interesse und verfolgte Vitellius’ Abstieg vom Palatin nicht ohne eine gewisse Rührung2, wenn seine Huldigung auch dem Sieger galt.
Der von seiner Tafel aufgeschreckte Vitellius wurde durch geschickte Martern langsam zu Tode gequält. Seine Leiche wurde in den Tiber geworfen. Mucian befahl, auch Vitellius’ einzigen Sohn zu töten. Er wollte mit dieser Hinrichtung, wie er bemerkte, künftigen Auseinandersetzungen vorbeugen. Bis heute ist unklar, ob Mucian hier auf eigene Faust oder in Absprache mit Vespasian handelte.
Vespasian war klug genug, nach außen hin loyal zu den drei in so kurzen Abständen aufeinander folgenden Kaisern zu halten und seine Soldaten auf sie vereidigen zu lassen. Er mochte die Auffassung vertreten, dass ein schlechter Princeps noch immer besser als gar keiner war. Und wären nicht merkwürdige Dinge geschehen, und hätte ihn nicht C. Lucius Mucianus immer wieder ermuntert, er wäre wohl nie auf den Gedanken gekommen, seine Hand nach dem höchsten römischen Staatsamt auszustrecken, denn er war ein besonnener und eher vorsichtiger Mann, der kühne Abenteuer nicht schätzte. Zudem war er sich stets seiner einfachen Herkunft bewusst geblieben.
Was hat ihn veranlasst, von seiner Politik des geduldigen Abwartens abzurücken? Und wer war jener Mucianus, der Statthalter Syriens, der Vespasian so gut zuredete?
Er entstammte einem unbekannten Zweig einer ansonsten berühmten Familie, der gens Licinia, aber er war, wir wissen nicht wie, zu einigem Vermögen gelangt. Von ihm machte er, den Gepflogenheiten seiner Alters- und Standesgenossen entsprechend, verschwenderischen Gebrauch und handelte sich damit den Tadel des Kaisers Claudius ein. Nero, dem er wesensverwandt gewesen zu sein scheint, machte ihn Ende der fünfziger Jahre zum Statthalter Lykiens und Pamphyliens, einer nicht eben bedeutenden kleinen Provinz in der heutigen Südtürkei. Mucian bewährte sich, erlangte das Konsulat und wurde schließlich zum Statthalter der Provinz Syrien ernannt, eine Schlüsselstellung und ein besonderer Vertrauensbeweis Neros, der an ihm offensichtlich Gefallen gefunden hatte.
Als Vespasian in den Osten gekommen war, um gegen die aufständischen Juden vorzugehen, begegnete ihm Mucian zunächst äußerst kühl und reserviert. Möglicherweise hatte er selbst auf den Oberbefehl im Krieg gegen die Juden gehofft. Doch der junge Titus, der bald die Sympathie des Statthalters gewann, vermittelte und brachte die beiden Männer zusammen. Dem politisch begabten Sohn Vespasians, der Aufmerksame schon jetzt alle Tugenden eines künftigen Herrschers ahnen ließ, war nicht entgangen, dass Mucian ein wichtiger Bundesgenosse in diesem gefährlich gewordenen Teil der römischen Welt war. Das Land, über das er gebot, verfügte über nahezu unerschöpfliche Hilfsquellen, und es beherbergte vier Legionen, deren Unterstützung den bevorstehenden Krieg entscheiden mochte. Zudem war Mucian ein Vertrauter Neros – wie sonst wäre er zu derartiger Höhe gelangt? – der sich im höfischen Intrigenspiel bestens auskannte und überall einflussreiche Freunde besaß. Dabei blieb er stets distanziert, ein außenstehender Beobachter, der die Dinge vielleicht deshalb nüchtern und realistisch sah.
Vespasian und er hatten sich im Bewusstsein gegenseitiger Abhängigkeit kennen und schätzen gelernt, freundeten sich an und bildeten mit dem Rückhalt der von ihnen befehligten Legionen bald einen Machtblock, der weit über die Grenzen Palästinas hinausreichte. Zu ihrem Glück waren die Hauptstadt und der Westen des Reiches mit anderen Sorgen beschäftigt, und man bemerkte dort nicht, welche geballte Kraft sich da im Vorderen Orient gebildet hatte.
Der Geschichtsschreiber Tacitus, der sich hier auf zeitgenössische Quellen beruft, zeichnet Mucian als schillernde Persönlichkeit, einen Mann mit zwei Gesichtern und dem sicheren Gespür für das politisch Richtige und Machbare.
Später, nachdem er sich aus der Politik zurückgezogen hatte, ging er unter dem Schutz der flavischen Herrscher seiner wahren Leidenschaft nach, dem Studium von Kultur und Geschichte, über die er sogar einige Bücher verfasste. An Stoff mangelte es ihm nicht. Er hatte sich während seiner Statthalterschaft mit der Lokaltradition vieler Städte beschäftigt, Material gesammelt und Tagebuch geführt und konnte seine Arbeit jetzt auswerten. Möglicherweise war er sogar mit dem Älteren Plinius bekannt, der so manches, was Mucian erzählt hatte, in seine Naturalis historia aufnahm. Plinius nennt ihn ter Konsul. Das weist darauf hin, dass sich Mucian erst nach seinem dritten Konsulat (72 n. Chr.) der Schriftstellerei widmete. Leider ist von seinem umfangreichen Werk, darunter eine Sammlung historischer Dokumente aus der Zeit der römischen Republik, nicht viel übrig geblieben. Nur die mirabilia, Wundergeschichten, geben Auskunft darüber, dass Mucian ein interessierter und interessanter Mann war.
Weshalb beanspruchte er als solcher das Amt des Princeps nicht für sich und unterstützte einen Freund, dem er sich dann für den Rest seines Lebens unterordnen musste? Wir wissen es nicht. Möglich wäre, dass er schon damals beabsichtigte, irgendwann von der politischen Bühne abzutreten und sich nur noch seinen Neigungen zu widmen. Denkbar wäre auch, dass ihm der Ausgang einer Auseinandersetzung zwischen den Heeren Syriens und Palästinas ungewiss schien und seine Kräfte selbst dann, wenn er gewonnen hätte, doch kaum ausgereicht hätten, sie zur Erringung der Kaiserwürde in die Waagschale zu werfen. Wahrscheinlich aber war seine Sympathie für die Flavier inzwischen so groß, dass es ihm am vernünftigsten erschien, sich rückhaltlos für ihren Aufstieg einzusetzen, zumal er selbst nach einer Bemerkung, die ihm Tacitus in den Mund legt, keinen Sohn hatte, dem er Thron und Titel hätte weitergeben können.
„… mich stelle ich über Vitellius“, sagte er zu Vespasian, „dich über mich. Dein Haus hat einen Namen durch Triumph, zwei Jünglinge, von denen einer schon der Herrschaft fähig und durch die ersten Jahre seines Dienstes auch bei den germanischen Heeren berühmt“ ist. „Töricht wäre es, dem die Herrschaft nicht zu überlassen, dessen Sohn ich adoptieren würde, wenn ich selbst herrschte … Und nicht größeres Vertrauen setze ich auf deine Wachsamkeit, Sparsamkeit und Weisheit als auf des Vitellius Stumpfsinn, Unverstand und Grausamkeit.“3 Vespasian vergaß seinem Freund die Unterstützung nie.
Immerhin soll sich, wenn wir Tacitus glauben können, Mucian einmal im Senat gerühmt haben, er habe das Imperium, das sich bereits in seiner Hand befunden habe, Vespasian geschenkt.4 Doch wahrscheinlich wusste er, dass dies nicht richtig war. Das Reich bedurfte der Leitung eines starken Mannes, da, wie bereits angesprochen, in Germanien und Gallien Unruhen ausgebrochen waren. Und wer hätte sich da als Führer besser geeignet als jener geschickte Feldherr, der das aufsässige Judäa mit viel List und wenigen Opfern auf römischer Seite in so grausamer Schnelligkeit bezwungen hatte?
Noch bevor der Winter des Jahres 68 heraufgezogen war, schickte der künftige Kaiser seinen Sohn Titus auf den Weg nach Rom. König Iulius Agrippa II. von Chalcis im Libanon begleitete ihn. Es galt nicht nur, dem neuen Princeps, Galba, seine Reverenz zu erweisen, sondern auch, die Kandidatur für das Prätoramt vorzubereiten, wozu die ungeschriebene römische Verfassung die persönliche Anwesenheit des Bewerbers in der Hauptstadt vorsah.
Galba war ein Greis, und er hatte keine Kinder. War da die Hoffnung verwegen, er werde vielleicht Gefallen an dem jungen Flavierspross finden? Aber das Schicksal hatte es anders bestimmt.
In Korinth erreichte den jungen Reisenden die Nachricht von Galbas Tod, Othos Thronbesteigung und auch der gleichzeitigen Wahl des Vitellius zum Kaiser. So beschloss er, die Reise vorerst nicht fortzusetzen. Nur ein Narr konnte glauben, Otho werde seinen Platz kampflos räumen und Rom ohne Blutvergießen einem anderen überlassen. Für einen Aufenthalt in der Hauptstadt wäre jetzt der ungünstigste Zeitpunkt gewesen. Es war zweifellos besser, man wartete ab.
Ganz allmählich begannen sich die Flavier an den Gedanken der bevorstehenden Kaiserwürde für ihr Geschlecht zu gewöhnen. Es war Titus nicht entgangen, dass Mucian eine Kandidatur Vespasians ins Auge gefasst hatte. Er machte kehrt und besuchte auf Cypern in Paphos den berühmten Tempel der Aphrodite. Dort eröffnete ihm ein weiser Priester die Zukunft. Von da an glaubte er an sein Glück.
Die vereinigten Heere von Syrien und Palästina, nicht weniger als sieben Legionen, dazu die beiden in Ägypten stationierten, stellten ein gewaltiges Machtpotential dar, das bei der Ernennung der drei Kaiser Galba, Otho und Vitellius nicht um seine Meinung gefragt worden war. Im Grunde spielte es für den Osten keine große Rolle, wer in Rom das Sagen hatte. Aber das Handwerk des Soldaten ist der Krieg, und der wird umso sehnlicher herbeigewünscht, wenn Aussicht auf reiche Beute besteht. Konnte sich Vespasian auf seine Leute verlassen? Hatte nicht die Geschichte immer wieder gezeigt, dass bislang jeder Führer, der sich in den Bürgerkriegen auf die Kräfte des Orients gestützt hatte, verloren war? Tacitus weist in diesem Zusammenhang darauf hin und erinnert an Pompeius Magnus, Cassius, Brutus und nicht zuletzt an Marcus Antonius.5 Ob Vespasian mit dem Eingreifen zögerte, weil er der Verlässlichkeit seiner Heere in diesem Punkt nicht traute, ist nicht bekannt. Krieg gegen barbarische Völker zu führen, war eine Sache, Römerblut zu vergießen, eine andere.
Die allgemeine Verwirrung steigerte sich noch, als just in jenen Tagen im Osten ein Mann auftrat, der vorgab, Kaiser Nero zu sein. Er sei, so hieß es, wie jener Künstler und dabei von frappierender Ähnlichkeit mit dem verstorbenen Herrscher, dessen Andenken bei vielen, besonders den einfachen Leuten, noch sehr lebendig war. Tatsächlich war es dem Mann, einem entlaufenen Sklaven oder Freigelassenen, gelungen, Bewaffnete um sich zu sammeln. Er ging vor der Insel Kynthos, einer der westlichen Kykladen, vor Anker. Der Centurio Sisenna, ein altgedienter Soldat, hatte sich ihm angeschlossen. Aber er zweifelte bald an der Echtheit des wieder auferstandenen Nero und suchte das Weite. Erst dem Statthalter der Provinz Galatia – Pamphylien gelang es, den Mann dingfest zu machen.
Es blieb übrigens nicht der einzige Zwischenfall dieser Art. Es kam – und ging – noch mancher Nero.
Weshalb sich die Parther, Roms Erbfeinde, in dieser unruhigen Zeit wartend zurückhielten, ist nicht bekannt. Vielleicht fürchteten sie die berühmten Feldherrn von Syrien und Judäa, die über eine solch beachtliche Streitmacht verfügten. Sie griffen auch in die Auseinandersetzungen zwischen Juden und Römern nicht ein, obwohl zu Israel rege Handelsbeziehungen bestanden, die noch auf die Zeit nach der Babylonischen Gefangenschaft zurückgingen. Nicht alle Juden hatten damals Persien verlassen, um in die angestammte Heimat zurückzukehren. Zu Ansehen und Wohlstand gelangt, hatten es viele vorgezogen zu bleiben, sodass die jüdische Gemeinde in Parthien eine der bedeutendsten der Diaspora war.
Wie groß der Respekt des parthischen Großkönigs Vologaeses war, nachdem man Vespasian zum Kaiser gekürt hatte, zeigt die Tatsache, dass er diesem aus freien Stücken 40.000 Bogenschützen zur Durchsetzung seiner Ansprüche anbot. Vespasian lehnte dankend ab. Er zog es wohl vor, sich nicht in die Abhängigkeit eines Volkes zu begeben, dessen Führer Rom Jahrhunderte lang bis aufs Blut bekämpft hatten. Zudem waren die innerrömischen Auseinandersetzungen zu diesem Zeitpunkt offensichtlich bereits beendet.
Da in Italien keine Ruhe einkehren wollte, sahen sich Mucian und Vespasian schließlich doch zum Eingreifen gezwungen. Aber wie sollten sie vorgehen? Vespasians Heer, das gegen die aufständischen Juden eingesetzt werden musste, abzuziehen, wäre in der gegenwärtigen Situation unverantwortlich gewesen. Es hätte zudem viele Monate gedauert, das riesige Truppenkontingent oder auch nur einen Teil davon in den Westen zu schaffen. Man hätte – mangels einer größeren Flotte – dafür den Landweg wählen müssen. So entschloss sich Vespasian zu einer Maßnahme, die zwar nicht vornehm war, da sie die Falschen traf, sich in der Vergangenheit aber als äußerst wirksam erwiesen hatte. Er unterband die Getreideversorgung aus Ägypten und der Provinz Africa, wozu er, wie bereits erwähnt, die Unterstützung Tiberius Alexanders und des Befehlshabers der Legio III Augusta, eines Mannes namens Valerius Festus, gewann.
Von Festus ist wenig bekannt. Tiberius Alexander, wie ihn die literarischen Quellen nennen, war ein Mann mit sicherem politischen Gespür und einer fast unheimlich anmutenden Voraussicht. Er war wie sein Onkel, Philo von Alexandria, der hervorragende Gelehrte, von Geburt Jude, kümmerte sich aber um den Glauben seiner Väter nicht. Wie die Gebildeten vieler Nationen fühlte auch er sich zum Griechentum hingezogen und besaß das noch immer begehrte römische Bürgerrecht, ein Privileg, dessen sich nur wenige Juden rühmen konnten.
Das Ende Neros war für ihn nicht überraschend gekommen. Er hatte es wie so vieles, was die politische Entwicklung betraf, vorausgesehen und bereits zu Galba Kontakt aufgenommen, als sich dieser noch in Spanien befand. Rom hätte sich keinen loyaleren Sachwalter in Ägypten vorstellen können. Selbst einen Aufstand seiner Glaubensgenossen im Land am Nil schlug er mit brutalsten Mitteln nieder. Und er verstand es, sich stets rechtzeitig auf die Seite der politischen Gewinner zu schlagen.
Schon früh hatte er sich auch Vespasian genähert. Tacitus weiß von einem Briefwechsel der beiden Männer zu berichten.6 Als Vespasian Kaiser war und Titus seinen Triumph über das bezwungene Judäa feierte, wurde auch eine Statue des ägyptischen Präfekten im Triumphzug mitgeführt, ein Hinweis auf die Rolle, die dieser für Vespasians Thronbesteigung und Titus’ Sieg gespielt hatte.
Es kam der 1. Juli 69, der sich für das flavische Geschlecht als Schicksalstag erweisen sollte. Tiberius Alexander hielt vor Nikopolis, unweit von Alexandria, eine Ansprache an seine Truppen und entfaltete dabei ein Schreiben Vespasians. Darin erklärte dieser, die Kaiserwürde anzunehmen, wenn man sie ihm denn antrüge. Soldaten und Volk brachen in Jubel aus, Vespasian war als Kaiser bestätigt und vergaß dem Freund den großen Dienst nie.
Eindrucksvoll berichtet ein 1939 in Kairo veröffentlichtes Papyrusdokument von den Ereignissen jener weit zurückliegenden Zeit. Darauf erscheinen die Namen Tiberius Alexanders und Vespasians. Es wird berichtet, dass sich das Volk im Hippodrom von Alexandria versammelt habe, um Kaiser Vespasian zu akklamieren, dem soter (Retter) und euergetes (Wohltäter der Menschheit), der sogar als Sohn des Gottes Amun bezeichnet wird.
Ist sich die Wissenschaft auch nicht schlüssig, ob sich der Bericht auf die Kaiserproklamation oder, was wahrscheinlicher ist, einen bald darauf erfolgten Besuch Vespasians in der damaligen Hauptstadt Ägyptens bezieht, so ist das Zeitdokument doch von unschätzbarem historischen Wert. Übrigens sollen auch die Bewohner Antiochias in Scharen zusammengeströmt sein, um dem neuen Herrn der Welt zu huldigen.7
Bereits mehrfach wurde Flavius Josephus erwähnt, der jüdische Geschichtsschreiber, der nach der Unterwerfung Judäas unter der Herrschaft der Flavier am Hof in Rom das Leben eines Gelehrten führte und unter anderem seine berühmten „Jüdischen Altertümer“ sowie „Die Geschichte des Jüdischen Krieges“ schrieb, bis heute die wichtigsten Quellen zum Verständnis des Judentums in der Antike, wenn Flavius Josephus auch von vielen Juden bis auf den heutigen Tag als Verräter an der jüdischen Sache und willfähriger Romgünstling geschmäht wird.
Wie kam ein Jude, der sich in verantwortlicher Position befand, nach Rom? Und weshalb überlebte ausgerechnet er, der den Widerstand gegen die Römer maßgeblich geleitet hatte, das große Sterben, das in Judäa in den letzten Jahren des siebten Jahrzehnts der neuen Zeitrechnung eine halbe Nation dahinraffte?
Josephus’ Geschichte – den Beinamen Flavius nahm er erst später an – gehört zu den wahrscheinlich merkwürdigsten der alten Welt. Für uns Nachgeborene kann sie als einzigartiger Glücksfall gewertet werden.
Flavius Josephus, „des Mattathias Sohn, aus Jerusalem gebürtiger Hebräer und Priester“8, mütterlicherseits aus der Königsfamilie der Hasmonäer stammend, kämpfte in vorderster Front gegen Rom und erlebte die blutigen Auseinandersetzungen als Augenzeuge mit. So entstand sein umfangreiches Werk nicht in der Stube des Gelehrten und nicht aus der Sicht eines unbeteiligten Zuschauers. Dies verleiht seiner Überlieferung ein hohes Maß an Authentizität.
Zu Beginn der Unruhen teilten die Verantwortlichen in Jerusalem das Land in sechs Distrikte ein, die jeweils einem Befehlshaber unterstellt waren. Die Auswahl dieser Männer erfolgte nach strengen Kriterien. Nur die Zuverlässigsten und Besten wurden in die Verantwortung genommen. In Galiläa war es ein 30-jähriger Priester, Pharisäer, der die Römer kannte und selbst schon in Rom gewesen war, wo ihn keine Geringere als Poppaea Sabina, die exzentrische Gattin Kaiser Neros, fasziniert von der jüdischen Kultur, empfangen hatte. Es war dies eben jener Flavius Josephus, der sich mit seinen Aufzeichnungen der Ereignisse für Jahrhunderte einen Namen machen sollte.
Obwohl er über keinerlei Kriegserfahrung verfügte und als Soldat nie ausgebildet worden war, muten seine Vorbereitungen erstaunlich professionell an.
Er ordnete zunächst die inneren Angelegenheiten des ihm anvertrauten Landesteils, befestigte Städte und Plätze, hob ein Heer von angeblich 60.000 Fußsoldaten, 350 Reitern und 4.500 Söldnern aus. Allein seine Leibwache sollen 600 Männer gebildet haben. Doch geht Flavius Josephus, der selbst davon berichtet, mit Zahlen oft recht großzügig um, sodass seine Angaben mit Vorsicht zu gebrauchen sind.
Eine starke Leibwache war sicherlich nötig, denn er hatte viele und mächtige Feinde. Einer von ihnen war Johannes von Gischala, der versuchte, das Volk gegen seinen Führer aufzuhetzen, und diesem sogar nach dem Leben trachtete. Da seine Bemühungen erfolglos blieben, verlegte er sich auf Intrigen. Heimlich schickte er Boten nach Jerusalem, die Josephus bei der Staatsführung wegen der Stärke seiner Truppen verdächtig machen sollten. Tatsächlich sandte man 2.500 Schwerbewaffnete gegen den vermeintlichen Verräter aus. Aber diesem gelang es, die Anführer der Elitetruppen in seine Gewalt zu bringen und unversehrt nach Jerusalem zurückzuschicken. Der mit seinen Verdächtigungen gescheiterte Johannes zog sich daraufhin nach Gischala zurück, von wo er vor kurzem geflohen war.
Wiederholt hatte sich auch die Stadt Tiberias von Josephus losgesagt, war zuletzt aber doch zur Besinnung gekommen. Er hatte sie seinen Anhängern zur Plünderung freigegeben, die Beute aber bald darauf ihren Eigentümern zurückerstattet, eine Maßnahme zur Warnung und ein Verhalten, über das sich ganz Israel wunderte.
Josephus’ Leute scheinen indes nicht allzu mutig gewesen zu sein. Er lagerte mit einer jüdischen Einheit in der Nähe der Stadt Sepphoris. Als sie hörten, dass der Krieg nahe, stoben die Soldaten auseinander, ohne auch nur einen einzigen Römer gesehen zu haben. Josephus beklagte den Mangel an Moral und zog sich mit denen, die bei ihm ausgeharrt hatten, nach Tiberias zurück. Er hatte erkannt, dass er mit den wenigen todesmutigen Männern gegen die römische Übermacht nichts würde ausrichten können. Jerusalem und das Land der Väter, von Jahwe selbst den Juden einst verheißen, waren verloren. Es gab für seine Glaubensbrüder keine Rettung mehr. Und doch war es nach seiner Ansicht besser, für das Vaterland ehrenhaft zu sterben, als es zu verraten.
In seiner Not bat er die Verantwortlichen in der Hauptstadt, sich mit den Römern zu vergleichen. Sei man hingegen zum Krieg fest entschlossen, benötige er ein neues Heer.
Derweil hatte Vespasian erfahren, dass sich die meisten Aufständischen des Lagers von Sepphoris nach Jotapata geflüchtet hatten. Ein Kundschafter meldete, auch Josephus sei in dieser Stadt eingetroffen. Vespasian vernahm die Worte des Fremden wie die Kunde eines seltenen Glücks. War es nicht eine Fügung der Götter, dass ihm von seinen Feinden ausgerechnet jener in die Falle gegangen war, dem der Ruf besonderer Klugheit und großen Einfallsreichtums vorauseilte? Er befahl, die Stadt sofort mit 1.000 Reitern zu umzingeln, damit der jüdische Anführer nicht heimlich entweichen könne. Er selbst schlug vor Jotapata die Zelte auf und begann mit der Belagerung.
Josephus erkannte, dass sich seine Zufluchtsstätte nicht lange würde halten können. In der Tat endete schon bald der ungleiche Kampf. Die obsiegenden Römer töteten nahezu alle Männer. Frauen und Kinder wurden in die Sklaverei verkauft. Es gab nur wenige, die sich vorübergehend retten konnten, und nur einen, der das große Schlachten überlebte – der Anführer Josephus.
Er war „wie unter göttlichem Beistand“9 durch die Reihe der Feinde geschlichen und in eine tiefe Zisterne gesprungen, die sich am Grund zu einer von oben nicht sichtbaren Höhle weitete. Dort hatten sich auch einige andere Leute versteckt. Sie verbargen sich tagsüber; nachts stiegen sie hinauf, um einen Fluchtweg ausfindig zu machen, fanden aber alles von den Römern streng bewacht. Das Versteck wurde verraten – von einer Frau, die sich ebenfalls darin verborgen hatte. Vespasian schickte zwei Tribunen, die Josephus freies Geleit anbieten und ihn zum Verlassen der Höhle bewegen sollten. Aber dieser misstraute allen Beteuerungen, sooft sie auch wiederholt werden mochten, und dachte daran, was ihn für seine Taten an Strafen erwartete. So bedurfte es großer Mühe und vieler guter Worte, bis er sich endlich überreden ließ.
Er erinnerte sich nächtlicher Träume, „in denen ihm Gott das bevorstehende Unglück der Juden und das künftige Geschick der römischen Imperatoren offenbart hatte. Josephus verstand es, Träume auszulegen und auch die Verkündigungen zu erklären, die die Gottheit zweideutig gelassen hatte, da er als Priester und Priestersohn mit den Weissagungen der heiligen Bücher wohl vertraut war“10. Seine Gabe und die Tatsache, dass er sich ihrer just in diesem Augenblick bewusst wurde, retteten ihm nun das Leben. „Weil du beschlossen hast“, rief er den Gott seiner Väter an, „das Volk der Juden, das du geschaffen, zu beugen, weil alles Glück zu den Römern gewandert ist und du meine Seele erwählt hast, die Zukunft zu offenbaren, so biete ich den Römern die Hand und bleibe am Leben. Dich aber rufe ich zum Zeugen an, dass ich nicht als Verräter, sondern als dein Diener zu ihnen übergehe.“11 Seine Leidensgenossen in der unterirdischen Höhle versuchten vergeblich, ihn mit Wort und Schwert vom Überlaufen abzubringen. Schließlich kam man überein, gemeinsam zu sterben. Das Los sollte entscheiden, wer wen niederzustßen hatte.
Ein glücklicher Zufall oder göttliche Fügung wollten es, dass Josephus am Leben blieb. Man führte ihn gefangen zu Vespasian, der befahl, den gefährlichsten Juden in Gewahrsam zu nehmen und nach Rom zu Kaiser Nero zu bringen, der ihn gebührend bestrafen mochte.
Nicht nur eine Menge Römer drängten sich heran, um den berühmten Feldherrn zu sehen und Mitleid mit ihm zu empfinden. Er hatte auch einen einflussreichen Fürsprecher in Vespasians nächster Umgebung gefunden. Seine Jugend und der Wechsel seines Geschicks hatten Titus so sehr gerührt, dass er bei seinem Vater um Gnade für den vornehmen Häftling bat.
Josephus war von Vespasians Absicht, ihn von Kaiser Nero aburteilen zu lassen, entsetzt. Er bat den römischen Oberbefehlshaber um ein Gespräch unter vier Augen. Nur Titus und zwei enge Freunde nahmen an der folgenden Unterredung teil.
„Wozu willst du mich Nero schicken?“, wandte sich der Gefangene an Vespasian. „Werden etwa seine Nachfolger, die noch vor dir auf den Thron kommen, ihn lange behaupten? Du, Vespasian, wirst Caesar und Alleinherrscher sein. Du und auch dieser, dein Sohn … Du wirst nicht nur mein Gebieter sein, sondern Herr über die Erde, das Meer und das ganze Menschengeschlecht.“12
Vespasian glaubte zunächst, der für seine Schläue bekannte Jude habe sich erneut einer List bedient, um seine Haut zu retten. Er stellte über die Glaubwürdigkeit des Hellsehers Nachforschungen an und erfuhr, dass dieser auch andere Ereignisse, etwa den Fall Jotapatas und die eigene Gefangennahme, zuverlässig vorausgesagt hatte. Auch erinnerte er sich anderer Vorzeichen, die ihm die künftige Herrscherwürde angedeutet hatten. So hatte sich einst „eine Zypresse auf dem Gut seiner Familie, die, ohne dass ein Gewitter getobt hätte, entwurzelt zu Boden gestürzt war“, wieder aufgerichtet. „In Griechenland aber träumte er, sein und seiner Familie Glück werde beginnen, wenn Nero ein Zahn gezogen würde. Da geschah es, dass am folgenden Tag ein Arzt ins Zimmer trat und Vespasian einen Zahn zeigte, den er eben dem Kaiser gezogen hatte.“13
Auch aus Rom wurde Seltsames berichtet. Nero sei, so erzählte man, im Traum aufgefordert worden, den Wagen des Iupiter Optimus Maximus, des höchsten römischen Staatsgottes, aus seinem Heiligtum zu holen und ins Haus Vespasians zu führen. Und während einer von Galba abgehaltenen Volksversammlung hätte sich eine Statue Gaius Iulius Caesars von selbst nach Osten gewendet. Vor Beginn der Schlacht von Cremona sollen zwei Adler gegeneinander gekämpft haben. Nachdem der eine besiegt war, sei ein dritter von Osten her gekommen und habe den Sieger verjagt. Am sichersten war wohl eine Prophezeiung des Basilides, eines Priesters in einem Tempel auf dem Karmelgebirge, das sich von Samaria in nordwestlicher Richtung zum Mittelmeer hin erstreckt. Von Glück und Segen für die Familie der Flavier wusste der Gottesmann zu berichten. Was auch immer Vespasian in die Hand nähme, es würde gelingen. Worte, die zwar einige Zeit zurücklagen, die der künftige Kaiser aber keineswegs vergessen hatte.
Allmählich begann sich Vesapasin an den Gedanken einer Thronbesteigung zu gewöhnen. Den jüdischen Wahrsager beschenkte er mit einem vornehmen Gewand und anderen kostbaren Dingen. Er behandelte ihn fortan freundlich, schenkte ihm aber noch nicht die Freiheit.
In Jerusalem hieß es indes, auch der Feldherr Josephus sei bei der Einnahme Jotapatas ums Leben gekommen. Diese Nachricht erfüllte die Stadt mit tiefer Trauer. Fast jede Familie hatte unter den Gefallenen ein oder mehrere Opfer zu beklagen. Um Josephus aber weinte eine ganze Nation.
Als man jedoch erfuhr, dass dieser lebe und von den Römern behandelt werde, wie es ein Kriegsgefangener eigentlich nicht hoffen durfte, wurde der Groll der Juden gegen den „Verräter“ ebenso groß wie es zuvor die Sympathie für den Totgeglaubten gewesen war. Schon im Alter von 27 Jahren, sagte man, sei dieser „Römling“ verdorben worden, als er mit Rom und dessen Kultur unmittelbar in Berührung gekommen war. „Der Glanz des Neronischen Hofes, das Treiben der Weltstadt und die Riesenhaftigkeit der Staatsinstitutionen blendeten ihn“ angeblich „so sehr, dass er die römische Macht für die Ewigkeit gebaut und von der göttlichen Vorsehung besonders begünstigt glaubte.“14
Es war dem jüdischen Priestersohn nicht vergönnt, den Ort des Schreckens, seine Heimat, gemeinsam mit Vespasian zu verlassen, der im Sommer des Jahres 70, ein Jahr nach der Kaiserproklamation, Richtung Italien aufbrach. Flavius Josephus musste ausharren und die Demütigung seiner Landsleute und den Fall des weltberühmten Tempels miterleben, ehe er gemeinsam mit Titus, mit dem ihn inzwischen eine innige Freundschaft verband, der Stätte des Grauens für immer den Rücken kehren durfte, um für seine Zeitgenossen und alle kommenden Geschlechter Zeugnis davon abzulegen, was Menschen ihresgleichen anzutun vermögen.
Im Zusammenhang mit der „Eroberung“ des Throns der Caesaren für Vespasian trat ein Mann in Erscheinung, der zu den schillerndsten Persönlichkeiten jener daran nicht armen Epoche gehörte. Sein Name war Antonius Primus. Er war rechtskräftig wegen einer Testamentsfälschung verurteilt worden. Aber diese Tatsache behinderte seine militärische Karriere nicht. Galba hatte ihn sogar zum Legaten der Legio VII Galbiana ernannt. Da er sich von Otho nichts erhoffte, schlug er sich auf die Seite Vespasians. In Vertretung von dessen Interessen ging er im Eifer des Gefechts oft eigenmächtig vor, was ihm der spätere Kaiser, der ihm stets kühl begegnete, trotz Primus’ Erfolgen offensichtlich übel nahm.
So hatte sich Primus, mit seiner Legion von Illyrien kommend, ohne Weisung mit den von ihm befehligten Truppen zwischen Cremona und Mantua bei Bedriacum dem Heer des Vitellius gestellt und dieses vernichtend geschlagen. Glauben wir dem Geschichtsschreiber Cassius Dio, häuften sich die Erschlagenen zu Bergen. Die Zahl der Toten wird auf 50.000 beziffert.15 Unbeschreibliche Szenen sollen sich abgespielt haben. In Cremona herrschte Weltuntergangsstimmung. Nicht weniger als 40.000 Bewaffnete drangen in die Stadt ein, plünderten, mordeten, brandschatzten und zerstörten alle Tempel. Wer in Gefangenschaft geriet, wurde erbarmungslos abgeschlachtet. Vespasian ermunterte später die wenigen Überlebenden, ihre Stadt wieder aufzubauen.16
Antonius Primus focht dies alles wenig an. Die von ihm befehligten Truppen hatten starke Verluste erlitten. Zu seinem Glück war inzwischen die Legio XI Claudiana aus Dalmatien nach Oberitalien gelangt. An ihrer Spitze rückte der Feldherr weiter Richtung Rom vor, um die Reste von Vitellius’ Streitmacht zu stellen. Diese hatten jedoch keine Lust mehr, den aussichtslos gewordenen Kampf fortzusetzen, und kapitulierten am 16./17. Dezember 69. Als Primus bis zu den Saxa Rubra in der Nähe von Rom vorgedrungen war, erfuhr er vom Tod des Stadtpräfekten Flavius Sabinus. Nach schweren Straßenkämpfen gegen die Vitellianer brachte er die Stadt in seine Gewalt. Dies geschah am 20. Dezember. Der Krieg in Italien war damit beendet. Übrigens sollen auch in Rom 50.000 Menschen umgekommen sein.
Einen Tag nach Primus’ vollkommenem Sieg traf Mucian in Rom ein, der im Auftrag Vespasians sofort das Kommando übernahm. In aller Eile wurden Antonius Primus vom Senat die Triumphalinsignien zuerkannt. Es war die einzige Anerkennung, die ihm für seine Verdienste zuteil wurde. Er war der Mohr, der seine Schuldigkeit getan hatte. Er durfte gehen.
Er reiste nach Ägypten, um Vespasian zu treffen, der ihn jedoch, wie gesagt, äußerst reserviert empfing. Vom Ruhm seines italischen Feldzugs zehrend, hat Primus noch bis in die letzten Jahre von Domitians Herrschaft gelebt. Politische oder militärische Bedeutung aber hat er nicht mehr erlangt. Nur der Dichter Martial hat ihm einige Epigramme gewidmet, ein Zeichen dafür, dass Primus bis zu seinem Lebensende zu den prominenten Persönlichkeiten Roms gehörte.