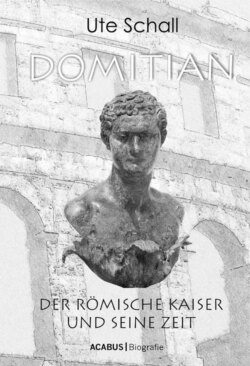Читать книгу Domitian. Der römische Kaiser und seine Zeit - Ute Schall - Страница 9
Der Übervater
Оглавление1937 wurde in Rom auf dem Gelände des antiken Marsfelds unter der Cancelleria Apostolica ein interessantes Relief gefunden. Die Wissenschaft nimmt an, dass es von Kaiser Domitian selbst in Auftrag gegeben wurde, um ein für ihn schicksalhaftes Ereignis für immer festzuhalten: Die Ankunft seines Vaters, des Kaisers, im Oktober 70 n. Chr. in der Hauptstadt des Römerreiches.
Geduldig wartend hatte Vespasian den Winter 69/70 in Ägypten verbracht. Kein Römer, der auch nur über ein wenig Verstand verfügte, vertraute sich in der unwirtlichen Jahreszeit den Launen der unberechenbaren Natur an, wenn es nicht um Tod oder Leben ging.
Nicht, dass es dem neuen Kaiser am Nil langweilig geworden wäre, hatte er doch bisher noch keine Gelegenheit gefunden, sich mit den Angelegenheiten des Landes, einer der wichtigsten Provinzen des Römischen Reiches, vertraut zu machen. Die Bevölkerung Ägyptens genoss es, einen leibhaftigen Kaiser beherbergen zu dürfen, träumte sie doch noch immer vom verflossenen Glanz der Pharaonen. Kein Wunder, dass man sich über Vespasian bald die seltsamsten Dinge erzählte. Einem Blinden habe er mit seinem Speichel das Augenlicht wiedergegeben, einen Handlahmen durch Berührung mit der Ferse mitten in der Menge, die sich um den Hilfe Suchenden gebildet hatte, von seinem Leiden befreit. Übereinstimmend berichten Suetonius Tranquillus1 und Tacitus2 von Wunderheilungen, derer sich Augenzeugen noch zu der Zeit Kaiser Trajans (98–117 n. Chr.) begeistert erinnerten, „wo Lüge keinen Gewinn mehr“ brachte.3 In beiden Fällen soll angeblich Serapis selbst, der alte ägyptische Heilgott, die Kranken zu Vespasian geschickt haben.
Sind solche Spontanheilungen wissenschaftlich haltbar? Die Zeit war offensichtlich für unerklärliche Vorgänge äußerst empfänglich, und vielen Großen des Altertums wurden übernatürliche Kräfte nachgesagt. Man denke hier nur an die Erzählungen der Evangelisten Matthäus und Lukas über die Wunder, die Jesus an Kranken bewirkte, oder an die Legenden, die sich um den alternden Augustus rankten. Auch das griechische Epidaurus, das bedeutendste Gesundheitszentrum der alten Welt, erzielte mit medizinisch nicht erklärbaren Methoden erstaunliche Heilerfolge. Wahrscheinlich kam es mehr auf den Glauben der Menschen an, der ja bekanntlich sogar Berge versetzt.
Was immer man von den Wunderdingen auch halten mag: Für Vespasian bedeuteten die Erzählungen darüber viel. Verbreitete sich doch mit ihnen der Ruf, auf dem neuen Kaiser Roms ruhe der Segen der Götter. Der Himmel selbst habe diesen Mann auserwählt, um der Menschheit Frieden und Ordnung zurückzubringen. Und da ihm Serapis die Kranken zugeführt hatte, galt Vespasian fortan nicht nur als Nachfolger der Pharaonen. Er war das lebendige Abbild des Gottes auf Erden, Kaiser nicht nur mit Hilfe und Zustimmung seiner Soldaten, sondern auch durch göttliche Legitimation, ein höchst virtuoses Mittel der politischen Propaganda, das seinen drei Vorgängern nicht zur Verfügung gestanden hatte.
Obwohl Vespasian wusste, dass in Rom noch längst nicht alles in geordneten Bahnen verlief und seine Anwesenheit dort dringend erforderlich gewesen wäre, ließ er sich mit der Rückkehr Zeit. Sein jüngerer Sohn Domitian wird nichts dagegen gehabt haben, sonnte er sich derweil wenn nicht im Ruhm des Herrschenden, so doch dessen, der das gewaltigste Reich der Welt repräsentierte. Erst als die Häfen längst geöffnet waren, stach der ältere Flavier im Sommer 70 auf einem Handelsschiff in See. Rhodos und die Insel Korkyra lagen auf seinem Weg. Er überquerte die Adria und betrat endlich nach jahrelanger Abwesenheit den Boden Italiens. Der Herbst hatte bereits seine Vorboten geschickt. Mucian, sein ergebener Sachwalter, erwartete ihn in Brundisium, dem heutigen Brindisi.
Domitian, damals 19 Jahre alt, oblag es als praetor urbanus, oberster Beamter der Stadt, dem Heimkehrer entgegenzureiten, um ihn offiziell willkommen zu heißen. Nicht nur als Sohn, auch als Stadtoberhaupt, hätte der Jüngere vor dem Älteren, dem Vater und neuen Herrn der Welt, die Hand zum Gruß erheben müssen. Ob es so war, wissen wir nicht. Domitian ließ es jedenfalls auf dem gefundenen Relief anders darstellen. Der neue Kaiser ist es, der sich dem stolzen Jüngling grüßend nähert. Man empfindet die Szene fast als geheime Huldigung an Domitian.
Die Darstellung auf dem unvergänglichen Stein bestätigt den Bericht, den der Kaiserbiograf Suetonius Tranquillus, Sekretär Kaiser Hadrians (117–138 n. Chr.), überliefert hat: „Als er (Domitian) dann zur Herrschaft gelangt war, hatte er die Stirn, vor dem Senat zu prahlen, er sei es gewesen, der seinem Vater wie seinem Bruder den Thron gegeben“ habe.4
Domitians jugendliche Überheblichkeit mag ein Grund dafür gewesen sein, dass sich sein Vater entschloss, ihn – anders als seinen Bruder Titus – nicht an der Regierungsverantwortung teilhaben zu lassen.
In der Tat unterschieden sich die Auffassungen von Vater und Sohn vom Principat als der Herrschaft des Ersten unter Gleichen beträchtlich. Aus niederer Gesellschaftsschicht stammend, die zu keinerlei Hoffnungen berechtigte, hatte sich Vespasian von der Pike an empor gedient, die ihm zugefallene Kaiserwürde stets als besondere Fügung des Schicksals und hohe Verantwortung betrachtet und sich nicht selten, wie wir noch sehen werden, über jene gewundert, die ihm Amt und Stellung neideten, weil sie nach seiner Meinung nicht wussten, welche Bürde diese mit sich brachten. Einfach und bescheiden brauchte sich der neue Princeps nicht zu geben. Er war es von Natur aus und stand damit ganz in der Tradition der Flavier, die sich immer zu diesen Eigenschaften bekannt hatten.
Ganz anders Domitian. Er liebte Vergnügen und Ausschweifung, und man kann diese Vorlieben sicherlich nicht nur mit seiner Jugend entschuldigen und auf gleichgeartete Altersgenossen verweisen. Alles Gute, das selbstredend auch er zumindest zu Beginn seiner Herrschaft stiftete, überschatteten doch sein Stolz, seine Überheblichkeit und das Bewusstsein seiner einzigartigen Stellung. Man gewinnt fast den Eindruck, als habe er durch die stetige Zurschaustellung der Bedeutung seines Amtes Defizite seiner Jugendzeit zu kompensieren und Komplexe auszugleichen versucht.
Nicht nur wegen seiner Jugend fehlte ihm, der 69 n. Chr. im Alter von 18 Jahren Stadtprätor wurde, für seine hohe und verantwortungsvolle Stellung der nötige Ernst. Auch seine Veranlagung hinderte den Jugendlichen daran, ein wirklich guter und umsichtiger Sachwalter römischer Interessen zu sein, und so war es geradezu ein Glück, dass ihm Mucian zur Seite stand, an seiner statt alle wichtigen die Stadt und das Reich betreffenden Entscheidungen traf. Vespasian mag auch hier seine Anordnungen mit Bedacht getroffen haben.
Von Domitians Wirken in Rom während der Abwesenheit seines Vaters ist nicht allzu viel bekannt. Doch waren durchaus vernünftige Entscheidungen unter seinen Erlassen. So hat er beispielsweise dem Senat den Einblick in die Listen der Denunzianten verweigert und ihn auf die Ankunft seines Vaters vertröstet. In Übereinstimmung mit seinem Mentor Mucian war er der Auffassung, das neue Principat solle nicht gleich mit blutigen Verfolgungen beginnen. Er befürwortete auch die Wiederherstellung der Ehre Galbas – und ignorierte damit geschickt die kurzen Regierungszeiten von Otho und Vitellius. Der Senat wurde angehalten, die Verhältnisse in Rom neu zu ordnen, den Wortlaut von Gesetzen auf Tafeln festzuhalten und die Fasten, den römischen Kalender, von den Auswüchsen der neronischen Zeit zu reinigen. Tacitus berichtet, Nero habe „durch Schmeichelei … die Jahrbücher entstellt“. Da auch die Staatsfinanzen aus dem Gleichgewicht geraten waren, musste „den öffentlichen Ausgaben Maß“ gesetzt werden.5 Mit edler Haltung trug der junge Caesar den versammelten Vätern seine Anliegen vor, kurz und gemäßigt, wobei er häufig errötete. Da man seinen wahren Charakter noch nicht kannte, wurde dies als Zeichen besonderer Bescheidenheit ausgelegt, einer Eigenschaft, die als eine der Kardinaltugenden für Roms Herrschende galt.
Suetonius weiß allerdings von solch redlichem Bemühen nichts. Nach ihm nutzte Domitian „seine hohe Stellung zur Ausübung schrankenloser Willkür, sodass man schon damals einen Vorgeschmack auf die Zukunft bekam“6. Er verführte, so hören wir, eine große Zahl verheirateter Frauen. Eine, Domitia Longina, nahm er sogar ihrem Gatten Aelius Lamia weg, um sie zu seiner Ehefrau zu machen. Und an einem einzigen Tag verteilte er in Rom und in den Provinzen über 20 Ämter, sodass sich sein Vater angeblich wunderte, dass er nicht auch ihm einen Nachfolger schickte.
Glich Domitian einem Meister an Verschwendung, so war sein Vater ein Genie der Sparsamkeit. Er zeigte sich besonders erfinderisch in der Erschließung neuer Steuerquellen. Was hätte er auch tun sollen angesichts einer durch Neros Lebensstil, Bürgerkrieg und den Krieg gegen die Juden verursachten leeren Staatskasse? Seinen eisernen Willen zu sparen bekamen schon die Alexandriner zu spüren, die auf reiche Geschenke gehofft hatten, dann aber enttäuscht erfahren mussten, dass Vespasian eher nahm als gab. Mit Schmähworten wurde daraufhin der eben erst gefeierte Kaiser bedacht. Seine anfängliche Popularität schwand.
Wenigstens die Stadtrömer wollte er vorerst von seinen Sparmaßnahmen verschonen. Die römischen Getreidespeicher waren leer. Und obwohl die Schifffahrt jahreszeitlich bedingt noch nicht eröffnet war, befahl er der alexandrinischen Kornflotte auszulaufen. Es wäre äußerst unklug gewesen, seine Herrschaft mit einer Hungersnot in Rom zu beginnen. Von Alexandria aus befahl er auch, die auf dem Capitol im Bürgerkrieg abgebrannten Gebäude wiederherzustellen.
Was immer er aber anordnete oder unterlassen wissen wollte, es war durch die lex de imperio Vespasiani legitimiert, ein Gesetz, das am 22. Dezember 69 erlassen worden war. In ihm wurden Vespasian die Machtbefugnisse übertragen, die vor ihm schon Augustus, Tiberius und Claudius besessen hatten. Er durfte Verträge abschließen, mit wem auch immer er wollte, ein Privileg, das früher nach der mos maiorum, der alten Vätersitte, dem Senat und Volk von Rom vorbehalten gewesen war. Ihm stand das Recht zu, den Senat einzuberufen, Anträge zu stellen, solche zurückzuweisen und abstimmen zu lassen. Befehle des Princeps standen Senatsbeschlüssen gleich. Seine Empfehlungen für die Vergabe der öffentlichen Ämter waren bindend. Und es war ihm gestattet, das pomerium, die geheiligte Stadtgrenze, zu erweitern. Eine letzte Bestimmung gleicht schließlich einer Art Generalvollmacht. Er durfte „alles tun, was er im Bereich des staatlichen Lebens und der öffentlichen und privaten Angelegenheiten zu tun für notwendig“7 erachtete.
Von seinem Ernennungstag an, dem 1. Juli 69, sollten diese Bestimmungen Gültigkeit besitzen. Wie kaum ein anderes Gesetz verlieh die lex de imperio Vespasiani Einblick in die dem Kaiser verliehenen Privilegien, die ihm erlaubten, zum Wohl von Volk und Senat von Rom nahezu uneingeschränkt zu handeln.
Nicht nur die Bewohner der westlichen Provinzen, deren Romanisierung längst als abgeschlossen und gelungen galt, probten unmittelbar vor Vespasians Thronbesteigung, durch die innerrömischen Wirren ermutigt, den Aufstand. In der Provinz Africa waren sich gar zwei Römer in die Haare geraten, der Prokonsul L. Calpurnius Piso, ein Mann aus altaristokratischer römischer Familie, und Valerius Festus, der die dort stehende Legio III Augusta befehligte. Er war mit Vitellius verwandt, hatte sich aber nicht auf dessen Seite geschlagen. Der Konflikt endete mit der Ermordung Pisos, die Festus geschickt verkaufte: Er habe damit einen offenen Konflikt in Africa vermeiden wollen. Vespasian nahm es dankbar zur Kenntnis.
Die Auseinandersetzungen im östlichen Teil des Reiches gipfelten schließlich im Krieg der Juden gegen die Römer, den Titus, wie berichtet, 70 n. Chr. mit der Zerstörung des von König Herodes erbauten Tempels und der Stadt Jerusalem niederschlug.
Nicht nur die Juden hatten nach Beendigung dieses ungleichen Kampfes zahllose Opfer zu beklagen. Auch die siegverwöhnten Römer hatten Rückschläge hinnehmen und Federn lassen müssen. Mit bewundernswertem Mut hatten sich ihnen die Juden entgegengestellt, ihr aus der Verzweiflung geborener Widerstand war hartnäckig gewesen. Umso glänzender erschien der römische Triumph, umso härter mussten die für die Aufstände Verantwortlichen bestraft werden. Die noch junge Dynastie der Flavier war es ihrem Ansehen schuldig, keinen zu schonen. So wurden die ersten Hinrichtungen jüdischer Rädelsführer bereits in Israel vorgenommen. Andere Gefangene wurden für Rom aufgespart, wo sie im Triumphzug vorgeführt und anschließend erdrosselt wurden. Es hätte Titus, dem man später große Milde nachsagte (clementia Titi), sicherlich gut angestanden, sich schon jetzt großzügig zu zeigen. Aber er fürchtete wohl, man würde ihm dies als Schwäche auslegen und ihn öffentlich dafür tadeln. Also war das Schicksal der jüdischen Anführer und Kriegsgefangenen besiegelt. Letztere schickte man, sofern es sich um gesunde und kräftige junge Männer handelte, entweder zur Schwerstarbeit in die Bergwerke Ägyptens, oder man wies sie einzelnen Städten als Gladiatoren für die blutigen Spiele in der Arena zu. In beiden Fällen tendierten die Überlebenschancen gegen Null. Es muss übrigens eine große Zahl von Kriegsgefangenen gegeben haben. Flavius Josephus zufolge gerieten 97.000 Menschen in Gefangenschaft, mehr als eine Million kamen angeblich um. Er behauptet, Jerusalem habe zur Zeit der Belagerung durch Titus mehr als 2.700.000 Einwohner gezählt. Doch wie immer neigt der antike Historiker sicherlich auch hier zu maßloser Übertreibung, und andere Geschichtsschreiber, so etwa Eusebius von Caesarea und der heilige Hieronymus, haben die Zahlen ungeprüft übernommen.
Wurde bereits darauf hingewiesen, dass Titus befahl, die eingenommene Stadt dem Erdboden gleich zu machen? Nur die unter dem Römerfreund Herodes erbauten Festungstürme Phasael, Hippikus und Mariamne blieben stehen. Sie sollten kommenden Geschlechtern von der Macht und Stärke der einstigen Hauptstadt des Judenreichs zeugen und den Ruhm der Sieger noch erhöhen.
Mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels endete eine Epoche der jüdischen Geschichte, da damit das geistige Zentrum des Judentums weggefallen war. Nie mehr sollte im Altertum das Passahfest, bei dem sich alljährlich Tausende von Gläubigen aus aller Welt trafen, in Jerusalem gefeiert werden.
Aber auch die wachsende Gemeinde der Christen beklagte den Verlust der Stätten, an denen Jesus gewirkt hatte und wo er gestorben war. Dass er den Untergang der Stadt vorausgesagt hatte, war ein Grund mehr, ihn als Sohn Gottes zu verehren. Die Steuer von zwei Drachmen jährlich, die jeder Jude bisher an den Tempel zu entrichten gehabt hatte, war überflüssig geworden, denn das Heiligtum existierte nicht mehr. Sie wurde den Besiegten jedoch nicht erlassen, sondern als Judensteuer fortan für den Tempel des Iupiter Capitolinus eingezogen, eine lukrative Einnahmequelle für den römischen Staat, der diese Gelder als Kriegsentschädigung betrachtete, eine zusätzliche Demütigung, ja ein Sakrileg für die Juden, die damit nach ihrem Glauben einen Götzen unterstützten.
Titus blieb nichts mehr zu tun, als seine verdienten Soldaten und Offiziere in der üblichen Weise zu dekorieren und die Glückwünsche der Nachbarn Judäas entgegenzunehmen. Selbst der Partherkönig schenkte dem Judenbezwinger einen goldenen Kranz, der ihm in Zeugma am Euphrat übergeben wurde. Von dort kehrte der glorreiche Sieger noch einmal an den Schauplatz seines Triumphes zurück. Traurigkeit befiel ihn ob des Anblicks der trostlosen Trümmerstätte. Aber er schob alle Schuld an der Zerstörung den uneinsichtigen Juden zu. Dann reiste er nach Alexandria, wo man ihn mit hohen Ehrenbezeugungen empfing.
Ist es wahr, dass sich der Sieger von Judäa mit dem Gedanken trug, die Herrschaft über die östlichen Reichsteile an sich zu reißen? Es gab Gerüchte, aber beweisen lässt sich bis auf den heutigen Tag nichts. Der Eindruck, Titus habe von seinem Vater abfallen und sich zum König des Orients machen wollen, gründete vielleicht in den Bitten, ja Drohungen seiner Soldaten, die ihn nach der Einnahme Jerusalems, die übrigens am Geburtstag seiner Tochter erfolgte, freudig als Imperator begrüßten, er möge entweder im Osten bleiben oder sie mitnehmen. „Dieser Verdacht erhärtete sich noch, als er auf dem Weg nach Alexandria anlässlich der Weihe eines Apisstiers in Memphis ein Diadem trug, was allerdings nur der Sitte und dem Ritus dieser alten Religion entsprach.“8
Sollte Titus je die Erlangung der Königswürde in Erwägung gezogen haben, verwarf er diese Überlegung rasch wieder. Das Verhältnis zu seinem Vater war das denkbar beste, und es stand nicht zu erwarten, dass sich daran etwas ändern würde. Wem, wenn nicht ihm, sollte dereinst der Thron zufallen, die Herrschaft über die ganze zivilisierte Welt, hinter deren Grenzen nach römischer Auffassung Barbaren lebten, die es noch zu bezähmen und von den Segnungen der mediterranen Stadtkultur zu überzeugen galt?
Wie sein Vater knapp zwei Jahre zuvor machte auch er sich von Ägypten aus auf den Heimweg. Er unterbrach seine Reise in Argos, um sich dort mit dem angesehenen Propheten und Wundertäter Apollonios von Tyana zu treffen, dem man die Gabe eines zweiten Gesichts nachsagte. Es ging wahrscheinlich um Titus’ politische Zukunft, aber Genaueres ist nicht bekannt. Auch Rhegium, das heutige Reggio di Calabria, wo Augustus’ unglückliche Tochter Julia die letzten Jahre ihrer Verbannung verbracht hatte, wurde angefahren, ebenso Puteoli, heute Pozzuoli, in der Nähe von Neapel. Aber nirgends hielt er sich lange auf.
In größter Eile reiste er weiter nach Rom, „wo er seinen überraschten Vater, gleichsam um die Grundlosigkeit der gegen ihn angestrengten Gerüchte zu beweisen, mit den Worten begrüßte: ‚Hier bin ich, Vater, hier bin ich‘“9.
Vespasian war über die Rückkehr seines Sohnes hoch erfreut und auch darüber, dass an den angeblichen Umsturzplänen nichts Wahres war.
Um das gute Einvernehmen zu demonstrieren und Titus auf die schwere Aufgabe seiner eigenen Regentschaft vorzubereiten, ließ ihn Vespasian fortan an der Regierung teilhaben, und der Sohn war dem Vater bald eine unentbehrliche Stütze. Vespasian war mit seinen 60 Jahren kein junger Mann mehr, wenn er sich auch einer blühenden Gesundheit erfreute, zu deren Erhaltung er „nichts anderes tat, als sich … im Ballspielsaal des Bades eine bestimmte Zahl von Malen selbst zu frottieren und jeden Monat einen Fasttag einzulegen“10. Aber er wusste wohl, dass er das Durchschnittsalter eines Römers längst überschritten hatte und auch auf ihn allmählich der Tod lauerte.
Auch wenn sich Vespasian auf seine bescheidenen Wurzeln besann und er an Prunk und öffentlicher Selbstdarstellung keinen Gefallen fand, so war es doch unerlässlich, den Sieg über Judäa, das Rom in jahrelange Kämpfe verwickelt und einen hohen Blutzoll gefordert hatte und noch immer nicht endgültig befriedet war – auf der Felsenfestung Masada hatten sich die letzten Aufständischen verschanzt – gebührend zu feiern. Gern bewilligte der dankbare Senat Vater und Sohn je einen Triumph, noch immer die höchste Auszeichnung, die Rom einem Feldherrn zu vergeben hatte, der sich rühmen konnte, mindestens 5.000 auswärtige Feinde getötet zu haben. Die Freude über die Eroberung und Zerstörung Jerusalems ließ alle finanziellen Probleme gering erscheinen. Und nach den langen und entbehrungsreichen Jahren der Wirren war eine derartige Großveranstaltung durchaus geeignet, ein neues Zeitalter des Friedens und der Ordnung einzuläuten.
Um die Staatskasse nicht mehr als nötig zu belasten, einigte man sich auf ein gemeinsames Fest, bei dem Titus seinem Vater den Vorrang ließ. Im Juni des Jahres 71 wälzte sich der gewaltige Triumphzug über die Via Sacra hinauf zum Capitol, und die ganze Stadt war auf den Beinen. Selten zuvor wurde den in dieser Beziehung ohnehin verwöhnten Römern ein großartigeres Schauspiel geboten.
„Es ist unmöglich“, kommentiert Flavius Josephus das beeindruckende Geschehen, „die Menge der hierbei gezeigten Sehenswürdigkeiten und die in jeder Hinsicht überwältigende Pracht der Kunstwerke, Luxusgegenstände und Naturseltenheiten gebührend zu schildern. Silber, Gold und Elfenbein sah man … wie einen Strom daherfließen. Gewänder, aus dem seltenen Purpur gewebt oder nach Art der babylonischen Kunst mit Bildwerken aufs Feinste durchstickt, schimmernde Edelsteine, in goldenen Kronen und anderen Fassungen gefügt, wurden in solchen Mengen vorbeigetragen, dass es irrig schien, so etwas für selten zu halten …“11 Herausragende Schätze waren die Gegenstände des Tempelkults, der siebenarmige Leuchter, die Menorah, der Tisch mit den goldenen Schaubroten, die Trompeten und eine Abschrift des Gesetzes. Die Menschen waren von der Fülle des Beuteguts überwältigt. Die wenigsten Römer waren über die Stadtgrenzen hinausgekommen, denn die Lebensbedingungen des einfachen Volkes standen in krassem Gegensatz zu denen der Aristokraten und des Geldadels. Außer Rom kannten sie nichts.
Ziel des Festzugs war der Iupitertempel auf dem Capitol.
Bevor jedoch der Triumphator und sein Gefolge das Heiligtum betreten durften, hatte ein Bote den Tod des feindlichen Heerführers zu melden. So verlangten es Sitte und Brauch. Der Hauptfeind „war Simon, des Gioras Sohn, der mit anderen Gefangenen im Triumph mitgeführt worden war … Man warf ihm einen Strick um und zerrte ihn auf einen Platz über der Versammlungsstätte, und schon während dies geschah, wurde er von denen gegeißelt, die ihn dorthin brachten. Das ist der Ort, an dem nach römischem Gesetz die zum Tode Verurteilten hingerichtet wurden … Als sein Tod gemeldet wurde, erhob sich ein allgemeines Jubelgeschrei, danach begannen die Opfer, die unter den vorgeschriebenen Gebeten glücklich zu Ende geführt wurden“12.
Vespasian befahl, den Tempel des Janus, dessen Tore in Kriegszeiten offen standen, zu schließen.
Frieden sollte wieder herrschen in Italien.
Noch zu Vespasians Zeiten sollten einige Monumente die Erinnerung an den Sieg über die Juden festhalten. Das Friedensforum gehörte dazu, das lange weitgehend unter der Via dei Fori Imperiali, der unter Mussolini angelegten Prachtstraße der Kaiserforen, begraben lag, aber neuerdings teilweise ausgegraben wird. Gleich 71 n. Chr. ließ es Vespasian als templum pacis zu Ehren der Friedensgöttin errichten und darin die goldenen Schaustücke aus dem Judentempel ausstellen, auf die er besonders stolz war. Das Amphitheatrum Flavium, von dem noch ausführlich die Rede sein wird, heute als Colosseum bekannt, die aufwändigste Vernügungs- und Hinrichtungsstätte Roms, wurde aus der Beute des jüdischen Kriegs finanziert. Und auch der Titusbogen, von Domitian, wie erwähnt, seinem so früh verstorbenen Bruder errichtet, erweist sich bis heute als lebendiges Bilderbuch der Geschichte. Von einem weiteren Bogen, der dem Kaisersohn im Circus Maximus erbaut wurde, haben sich keine Spuren erhalten. Es existiert nur die Abschrift einer Inschrift, die Titus rühmt, der Jerusalem bezwungen und dem Erdboden gleichgemacht habe, „eine Stadt, die niemals zuvor von einem Herrscher oder einem Volk bezwungen worden sei“13. Ein billiges Lob, das die Eroberungen durch Nebukadnezar, Antiochos IV. Epiphanes und Pompeius Magnus ignoriert.
Münzen, die einzigen Massenmedien jener Zeit, hielten die Ereignisse fest. Iudaea capta, selten Iudaea devicta, stand auf ihnen geschrieben, und eine Jüdin, die niedergeschlagen unter einer Palme sitzt, während auf der anderen Seite ein Gefangener mit auf dem Rücken gebundenen Händen oder ein sich auf seine Lanze stützender Soldat stehen, symbolisiert die besiegte Provinz.
Die Gesetzestafeln und der Purpurvorhang des Tempels wurden im kaiserlichen Palast aufbewahrt. Sie sollten auf ewige Zeiten von den Taten des flavischen Geschlechts künden.
Das war das Rom des Jahres 71, wo Domitian allmählich begann, Geschmack am Leben eines Kaisersohns zu finden.