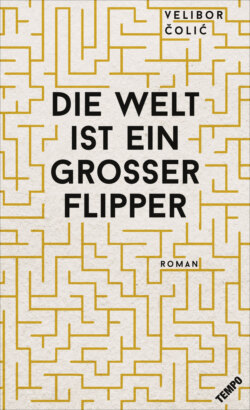Читать книгу Die Welt ist ein großer Flipper - Velibor Colic - Страница 6
3
ОглавлениеDas frisch renovierte Asylbewerberheim in Rennes erinnert mich an mein Gymnasium. Eine große Glastür, endlose Flure, nur dass es hier anstelle der Klassenzimmer Schlafräume für Flüchtlinge gibt. In der Eingangshalle hängt eine Weltkarte mit kleinen Fähnchen aus den Ländern der Bewohner. Im Spätsommer 1992 trifft sich das ganze Elend der Welt in Rennes. Irak und Bosnien, Somalia und Äthiopien, mehrere Länder des ehemaligen Ostblocks. Dazu ein paar professionelle Vagabunden, Männer, die seit langem, vielleicht schon immer, zwischen den verschiedenen Behörden und Grenzen, zwischen der richtigen Welt und der Unterwelt der Bürger zweiter Klasse verlorengegangen sind, ohne Papiere, ohne Gesicht und ohne Hoffnung.
Ich werde von einer Frau mit einer riesigen Brille empfangen. Sie spricht leise und sieht mir in die Augen. Das ist eine Premiere für mich. Seit meiner Ankunft in Frankreich sprechen alle (auch die Gutwilligen) sehr laut und in kurzen Sätzen mit mir, etwa so: »Du … Essen … ja … mjam, mjam, mmmm, ist gut, ja?«, oder: »Du, warten, hier! Hier, warten!«
Hier ist es anders. Die Frau erklärt mir ganz ruhig – und wie durch ein Wunder verstehe ich alles –, wie das Heim funktioniert. Ich verstehe, dass ich ein Einzelzimmer für Ledige bekomme, dass ich Badezimmer und Küche mit den anderen teile und dass ich Recht auf einen Französischkurs für erwachsene Analphabeten habe, der dreimal pro Woche stattfindet.
Ich bin etwas beleidigt:
»Aber ich habe Abitur und ein abgeschlossenes Studium, ich bin Schriftsteller, Romanautor …«
»Völlig unwichtig, mein Junge«, antwortet die Frau. »Hier beginnt für dich ein neues Leben.«
*
Mein Zimmer gleicht einer Mönchszelle: ein Metallbett, ein kleiner Tisch, ein Stuhl und ein Fenster mit Blick auf den Parkplatz eines Supermarkts. Ich bin erschöpft, ich bin wütend, auf mich, auf den Krieg, auf die ganze Welt. Ich gehöre ganz offensichtlich nicht hierher. Ich fühle mich den anderen Flüchtlingen im Heim überlegen. Ich habe Edgar Allan Poe und Kafka gelesen, ich kenne den Unterschied zwischen Realismus und Surrealismus. Ich habe bereits einen Literaturpreis erhalten, einen sehr bedeutenden, in Jugoslawien. Ich höre Jazz, Miles, Mingus und Coltrane, und um mich herum sind nur arme Bauern, Hirten und Notleidende aus der Dritten Welt. Momentan sitze ich in der Klemme, zugegeben, aber ich habe so viel beizutragen, so viel zu erzählen, dass ich meine neuen Lebensumstände als erniedrigend empfinde. Ich stelle meine Tasche ab und mache auf dem Absatz kehrt.
*
Mit fünfzig Mark in der Tasche gehe ich in Richtung Stadtzentrum. Unterwegs bete ich zu John Fante und Julio Cortázar, zum großen Baudelaire und zum unsterblichen Apollinaire; ich flehe zum Bart von Hemingway und zu Balzacs Bauch, zur Unerträglichen Leichtigkeit des Seins von Kundera und zu Sábatos Abaddon, sie mögen mir zu Hilfe kommen. Ich balle vergeblich die Fäuste, ich fluche. Ich kann meinen wachsenden Frust nicht kanalisieren. Ich habe nur meinen dummen, unnützen Stolz, die Nicht-Annahme meines Schicksals, kalten Zorn. Ich bin verkrampft, verängstigt von meinem neuen Leben ohne Morgen.
*
Gegen zwei Uhr morgens werde ich aus der Bar geworfen, ich erinnere mich vage, dass ich brülle: »Dazu haben Sie kein Recht, ich bin Jacques Dutronc«, trotz meines Widerstands ist der Rausschmeißer unerbittlich. Ergebnis meines Ausflugs ins Stadtzentrum: Ich bin immer noch Flüchtling und wütend, aber jetzt bin ich voll wie eine Haubitze, und meine fünfzig Mark sind weg. Meine Rückkehr ins Heim ist lang und mühsam. Irgendwie suche ich mir meinen Weg durch den dichten Nebel der Nacht und des Biers. In der ersten halben Stunde singe ich jugoslawische Lieder, dann verlaufe ich mich in einem Vorort, und als ich endlich das Schild Foyer Guy Houist Rennes sehe, bin ich sehr müde.
Unter dem finsteren Blick des Nachtwächters gehe ich in mein Zimmer, ziehe die Schuhe aus und falle sofort in einen tiefen, traumlosen Schlaf.
*
Nach einer Woche habe ich zwei neue Freunde. Zwei russische Ex-Soldaten, die über die Berliner Mauer gesprungen und durch Belgien und die Niederlande nach Frankreich gelangt und in diesem Heim gelandet sind. Alexander Terohin ist groß und stämmig, blond wie der Sommer, sein Gesicht schon vom Alkohol zerstört. Er spaziert mit nacktem Oberkörper durch die Flure, muskulös und glänzend wie ein slawischer Gott. Auf seiner hellen Haut sind ein paar blaue Flecken zu sehen – eine zitternde, unsichere Hand hat ihm den Namen einer Stadt und den eines Mädchens eintätowiert: Samara und Tamara, das reimt sich wie der Anfang eines Gedichts von Sergej Jessenin. Weiter unten, auf seinem Unterarm, gibt es einen Kommunistenstern und eine sehr schlecht gezeichnete Sirene, der Künstler der russischen Marine wurde wohl von hohen Ostseewellen bei der Arbeit gestört. Sein Freund Wolodja Kudaschow ist sein Sancho Pansa. Er ist klein, gedrungen, ziemlich fett und erinnert mich an eine wohlgenährte Ratte. Er hat ungesunde Schweinsäuglein und lange gelbe Zähne, die aus seinem Mund ragen. Nach jedem Glas klatscht er sich auf den Bauch und rühmt sich seiner sexuellen Eroberungen in Berlin.
»Nicht alle deutschen Frauen sind Nutten«, erzählt er, »manche machen es auch umsonst.«
Wir verständigen uns in einer Mischung aus Russisch, Serbokroatisch und einfachen Sätzen auf Deutsch. Ich bin froh, dass ich zu einer Bande gehöre, auch wenn ich mich nie an den Prügeleien mit den Schwarzen und den Arabern beteilige, die meine neuen Freunde regelmäßig vom Zaun brechen.
»Wir sind hier in Europa«, wiederholt Alexander ständig. »Die sollen gefälligst zu ihren Scheißstämmen zurückgehen.«
Manchmal verbringen wir eine ruhige, angenehme Nacht. Wir sitzen auf dem Parkplatz hinter unserem Heim und trinken, singen und vergleichen unsere schönen Länder mit diesem eigenartigen Frankreich.
»Frankreich ist wirklich ein komisches Land«, schwafelt Alexander los. »Hier ist Weißbrot billiger als Schwarzbrot.«
»Außerdem essen sie den Salat vor dem Fleisch«, sagt Wolodja, »nicht dazu, wie wir.«
»Ja, ja«, bestätige ich mit ernster Miene, »die Franzosen und ihre tausend Sorten Stinkekäse … Bei uns gibt es zwei Sorten Käse – gesalzen und halbgesalzen – und ansonsten sieh zu, Kamerad.«
Dann stoßen wir an und trinken aus der Flasche, auf slawische Art.
*
Meine russischen Freunde und ich folgen immer demselben Ritual. Zwei Sixpacks vom billigsten Bier, dazu mixen die Russen ihren fighting cocktail (eine Flasche billige Limonade mit Alkohol aus der Apotheke, 75 Prozent), und ich nehme eine Flasche vin de pays, am liebsten roten, um meine Integration zu beschleunigen. Dann pflegt jeder seinen Rausch. Die Russen brüllen im Flur rum, ich weine, den Kopf im Kissen versteckt, in meinem Zimmer.
»Wenn du noch einmal sagst, dass du Dichter bist, schlage ich dir die Fresse ein!«, warnt mich Alexander regelmäßig.
»Ich bin Dichter«, entgegne ich.
Und er verpasst mir einen freundschaftlichen, aber festen Schlag ins Gesicht. Und wieder stoßen wir an, trinken und singen aus voller Kehle Kalinka, Kalinka maja …
Ich lasse das Blut laufen und auf mein Hemd tropfen. Mein Blut, mein Gesicht und mein Körper, das ist alles nicht mehr wichtig. Nur ein kleiner Preis dafür, dass ich den endlosen Nächten der Einsamkeit in meinem Heimzimmer entfliehe. Ich lasse mein Blut laufen, na und? Betäubt vom Alkohol und der schrecklichen metaphysischen Kälte in mir, erfahre ich, dass alles hier auf Erden etwas kostet. Verglichen mit den zerbrochenen Schicksalen eines Schalamows oder Pasternaks ist eine blutende Nase nichts!
*
Manchmal gehen wir abends in die Stadt. Wir laufen immer in einer festgelegten Ordnung, vorn Alexander und ich, ein paar Schritte dahinter Wolodja. Wir sind laut und arrogant. Alexander ist überdreht, Wolodja dick, und ich bin mit ihnen zusammen.
In den dunklen Kneipen sorgen wir für Aufsehen. Wir bestellen drei Gläser, dann füllen wir sie direkt aus unserer Flasche mit Industriewodka wieder auf. Wir reden laut und unterstreichen jedes Wort mit großen Gesten. Es ist eine bittere Zeremonie. Alexander zieht sein Hemd aus, Wolodja versucht, ein paar Aschenbecher vom Tresen zu stehlen, und ich bin immer noch mit ihnen zusammen.
Wenn wir ordentlich blau sind, warten wir, bis wir aus der Kneipe geworfen werden.
»Es gibt einen Betrunkenen als Schutzpatron für jeden Gott«, spinne ich, während ich mit meinen Freunden nach Hause torkle.
*
Eines schönen Morgens werden wir ins Büro der Direktorin gerufen. Hinter dem Schreibtisch sitzt ein Oberst der Fremdenlegion und raucht eine dicke kubanische Zigarre. Stumm betrachte ich sein Gesicht. Es ist das Gesicht eines Mannes mittleren Alters, das gelassene Sicherheit ausstrahlt, oval, Mund und Nase korrekt, die graumelierten Haare militärisch kurz geschnitten, blaue Augen. Drei Schritte hinter ihm steht sein Adjutant. Gerade wie ein Dreitagebart und tadellose Uniform. Irgendwas sagt mir, dass sein hinter der Sonnenbrille versteckter Blick ständig ausweicht und dass sich hinter seinen roten, fleischigen Lippen vergilbte, kranke Zähne verbergen.
Die Frage, die der Oberst stellt, ist einfach: »Wollt ihr in die ruhmreiche Fremdenlegion eintreten?«
Meine beiden russischen Freunde stehen sofort stramm, und ich vollführe eine der schönsten Pirouetten meines Lebens. Ich drehe mich um und verlasse das Zimmer, ohne auch nur »auf Wiedersehen« zu sagen. Ich bin achtundzwanzig, ich habe schon in der Jugoslawischen Volksarmee gedient und anschließend in der dahingeschiedenen bosnischen Armee. Ich habe die Nase gestrichen voll von Waffen und Fahnen, von endlosen Nächten, die die Hände zerbeißen, und violetten Morgendämmerungen, die mit feindlichen Granaten beginnen. Ich will kein Kommando keines Hauptmanns, keinen Schrei keines Verwundeten mehr hören. Nie mehr will ich schwarzes Blut über die Knie eines Kindersoldaten fließen sehen, der überrascht und lautlos stirbt. Ich will nicht mehr die nackten Grundmauern meines von einem Panzer zerstörten Elternhauses und die vor Hunger durchgedrehten Hunde sehen und nie mehr den stahlschweren Regen, der auf unsere Gräben fällt, fällt, fällt …
Ich kann kein fauliges Wasser mehr trinken und keinen ungesalzenen Reis mehr essen, keine Fahne und keinen Helm tragen; ich will nie mehr ein Gewehr reinigen und die Kugeln zählen – die kleinen Todeswürmer, genährt vom Fett und den Muskeln, vom Blut und vom Speichel unserer künftigen Opfer.
Ich gehe die Treppe hoch, den Flur entlang und in mein Zimmer. Ich lege mich auf mein Bett. Dann strecke ich den Arm aus und greife nach meinem ganz neuen, sicher wunderbaren Gedichtband mit dem Titel Jaguar, Februar, März, April …
Lange, eine kleine Ewigkeit studiere ich meine eigenen Verse. Das gibt mir wieder Hoffnung und Mut. Himmelherrgott, ich bin ein Dichter! Ich schließe das Heft und ziehe mir die Decke bis zum Kinn. Alles in Butter, alles gut. Meine Verbündeten, meine Schutzheiligen, Prévert, Camus, Celan, Pound sind wieder da. Nichts zu befürchten.
Im letzten Jahr war ich noch etwas anmaßend, aber in diesem Jahr bin ich perfekt.