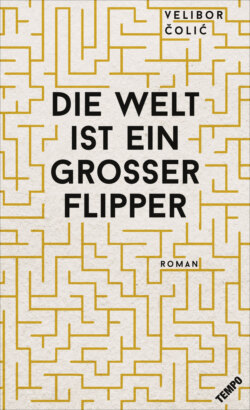Читать книгу Die Welt ist ein großer Flipper - Velibor Colic - Страница 9
6
ОглавлениеZuerst sehe ich ihren Rücken, dann ihre langen, zu einem Knoten aufgesteckten Haare. Ich lehne an der Bar und betrachte ihren weißen Nacken, die kräftigen Schultern und das elegante Kleid, das kaum ihre berauschenden Hüften verhüllt. Es ist Freitagabend, sie ist mit Freundinnen unterwegs, und ich blase vor meinem schalen Bier Trübsinn. Ihr Körper ist ein dicht neben mir vertäutes Schiff, ihr Parfum ein Köder. Die kleinen Schweißtropfen, die über ihren Nacken perlen, erinnern mich an ein wunderbar feuchtes Sternbild.
Ich leere mein Glas, hebe die Hand und lege sie sanft auf ihre Schulter. Zu meiner Überraschung sagen ihre Haut, ihr Rücken und ihr Atem, ihr Körper und ihre Hüften ja. Ihr Profil, dann ihr Gesicht, das rote Lächeln und ihr schielender Blick sind wie durch Zauber ein weibliches Ja geworden.
»Hier kann die Nacht beginnen«, sagt sie lächelnd.
*
Isabelle gleicht einem schielenden Engel, einer wohlgenährten Mona Lisa mit ein paar Tropfen spanisch-republikanischen Blutes in den Adern. An den Spitzen ihrer Brüste schmecke ich etwas Säuerliches, einen metallischen Orangengeschmack. Sie ist üppig, doch nicht dick, obwohl ich zwei Speckwülste über ihren Hüften und eine weniger poröse Haut auf ihren Schenkeln bemerke. Isabelle hat zarte Finger, ihre Hände sind ägyptisch, katzenhaft. Sie bewegt sich wie ein kompassloses trunkenes Schiff … Ihre Röcke sind geradezu obszön, kurz, schwarz oder rot und umschließen ihren ebenso starken wie weiblichen Rubenskörper wie ein Handschuh. Isabelle trägt Seidentücher, afrikanische Ohrringe und knallroten Lippenstift wie eine Spanierin. Sie ist nicht vulgär. Zu Hause und abgeschminkt sieht sie aus wie eine frühreife Göre, die nicht recht weiß, was sie mit ihrer neuen Anatomie anfangen soll.
Wir verstehen uns schlecht, ich spreche wenig und sie wiederholt ständig, dass ich abwesend sei:
»Ich weiß nicht, wo du bist, aber du bist nicht hier. Das Problem ist, dass du auch nicht woanders bist. Du bist einfach abwesend. Und kalt. Kalt wie Asche.«
*
In ihrer Miniwohnung steht ein kleines Regal mit Büchern. Phonetisch und ohne zu verstehen lerne ich die Tristesse der großen Dichter auswendig. Spät in der Nacht rezitiere ich, mit meinem Bier in der Hand und meinem Kosakenakzent: »Il pleure dans mon cœur / Comme il pleut sur la ville / Quelle est cette langueur / qui pénètre mon cœur?
Es weint in meinem Herzen / wie es regnet auf die Stadt / Was ist dies wehe Schmerzen / das mich durchbohrt im Herzen?«
Isabelle lacht mit dem ganzen Körper, nackt und langsam, fast eingeschlafen nach dem Sex.
»Was für ein Bär«, murmelt sie, »du bist ein echter Balkanbär.«
»Rappelle-toi Barbara«, brülle ich, »Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là / Et tu marchais souriante / Épanouie ravie ruisselante.
Erinnere dich, Barbara / Es regnete ohne Unterlass auf Brest an jenem Tag / und du gingst lächelnd / Entspannt, glücklich, nass«, und Isabelle lacht noch lauter.
*
Mein Flirt mit Isabelle entfernt mich noch weiter von den anderen Flüchtlingen. Ich fühle mich überlegen, nicht dazugehörig. In den wenigen Nächten, die ich im Heim verbringe, verlange ich Nachtruhe ab zwanzig Uhr und Klosterstille für mein literarisches Schaffen.
»Wo waren Sie die ganze Zeit?«, fragt mich eines Morgens die Direktorin.
»Ich gehe, wohin ich will, ich mache, was ich will. Ich bin ein Dichter.«
»In Ordnung«, entgegnet sie, »wie Sie wollen. Ich weise Sie nur darauf hin, dass Sie Ihre Sozialhilfe verlieren, wenn Sie so weitermachen.«
*
In der übrigen Zeit blättere ich in meinem Wörterbuch Französisch-Kroatisch oder Französisch-Serbisch für Grundschüler und lerne wie ein Papagei Wörter auswendig: DER Ochse, DER Apfel, DIE Sonne, DAS Haus … Ich bin schon ein versierter Tim- und Struppi-Leser. Ich habe, nicht ohne Mühe, drei Bände ihrer unglaublichen Abenteuer gelesen: Die sieben Kristallkugeln, Der Arumbaya-Fetisch und Die Zigarren des Pharaos. Jetzt nehme ich mir vor, meinen ersten ganzen Roman auf Französisch zu lesen. Aber ich schaffe es nicht. Auch wenn mir die Sätze des großen Camus einfach vorkommen, verliere ich mich ständig in seinem Fremden.
Mir fehlen Wörter, ich habe nichts als meine Hartnäckigkeit, um die Klassiker zu verschlingen. Ich begreife, dass mir die ganze französische Literatur verschlossen ist. Je weiter ich im Wald der Verben und der Alchemie der Grammatik, in der Umgangssprache wie im literarischen Französisch vorankomme, desto offensichtlicher wird es.
Ich bin kein Mensch, ich bin eine Anekdote.
*
An einem schönen, hellen und feierlichen Sonntag bin ich bei Isabelles Eltern eingeladen. Sie hat alles organisiert: Da ihr Vater herzkrank ist, wird sie mich als Kommilitonen vorstellen, als polnischen Studenten.
»Kann ich nicht Däne sein?«, bitte ich sie mit meinem schönsten Lächeln. »Ich könnte doch auch als Skandinavier durchgehen.«
»Nein. Warum will niemand Pole sein? Du bist Pole und Schluss.«
»Na gut, wenn ich Pole sein muss, darf ich mir wenigstens einen Namen ausdenken. Guten Tag, Madame, ich heiße Franciszek Frederyk Balcrowiak.«
»Von mir aus«, seufzt sie.
*
Das Haus ihrer Eltern liegt in einem Vorort von Rennes. Eine lange Reihe identischer Einfamilienhäuser im pseudo-bretonischen Stil, mit kleinen Gärten, Blumen und dem obligatorischen Willkommen-Fußabtreter vor jeder Tür. Isabelles Eltern haben einen Hund, Casimir, wahrscheinlich das hässlichste Tier auf der Welt. Casimir ist von undefinierbarer Farbe, sagen wir beige, hat Glubschaugen, eine Hornhauttrübung im linken Auge und räudige Kaninchenohren. Sein kurzer, formloser Körper wird von Rattenbeinen getragen. Sein Kiefer ist verschoben, es sieht aus, als gehöre er nicht zu seinem Gesicht. Seine kleine Zunge ist mit mehreren Schichten weißen Schaums und Trauben winziger violetter Pilze bedeckt.
Während uns Isabelles Vater – er sieht aus wie Jean Gabin – aus lauwarmem Weißwein Kir zubereitet, legt der kleine hässliche Hund eine besondere Anhänglichkeit für mein linkes Bein an den Tag. Das ist so unangenehm, als würde eine stinkende Riesennacktschnecke an meinen Jeans kleben. Aber ich tue so, als wenn nichts wäre, und sehe mich im Wohnzimmer um. Madame hat jede Glasscheibe, die uns ein bisschen Licht bringen könnte, mit Gardinen zugehängt. An den Fenstern, an der Tür zwischen Wohnzimmer und Küche, an der zwischen Flur und Toilette, am kleinen Geschirrglasschrank, überall hängen mauvefarbene Gardinen mit gelben Rosen. Die Möbel sind rustikal, was mich an mein Elternhaus erinnert. Vier in Kunstledersessel verwandelte Bulldozer und ein langer, schwerer Tisch beherrschen den Raum.
Isabelles Mutter ist ein roter Zwerg. Sie ist rund und klein, trägt eine purpurrote Schürze, eine scharlachrote Kette und eine burgunderrote Plastikblume in ihrer Sauerkrautfrisur.
Natürlich nennt sie ihren Mann Papa.
»Siehst du, Papa«, ruft sie unsichtbar aus der Küche, »diesmal ist mir das Karottenpüree nicht danebengegangen.«
»Prima«, antwortet Jean Gabin, »wir trinken aus, dann kommen wir!«
*
Der Küchentisch wird von einer durchsichtigen Plastikdecke geschützt. Ihr sogenanntes Großmuttergeschirr besteht aus vier Tellern, jeder für drei Liter, und einem Arsenal verschiedener Gabeln und Löffel, so groß und schwer, dass ich mir vorkomme wie bei einem Mahl Gargantuas.
Wir reden wenig, eigentlich überhaupt nicht. Als der rote Zwerg seinen Braten rausholt, springt Jean Gabin auf.
»Jetzt passt mal auf«, ruft er.
Gleich darauf hält er ein elektrisches Messer in der Hand.
Mit geradezu sadistischer Sorgfalt schneidet er gigantische blutige Fleischscheiben, groß wie Elefantenohren, und legt sie auf unsere mit Weinlaub verzierten Teller.
»Hebt euch noch ein bisschen Hunger auf«, sagt der rote Zwerg lächelnd, »zum Dessert gibt es Zitronentarte.«
*
Die Tarte ist schwer und trostlos, und der in pantagruelischen Tassen servierte Kaffee schmeckt nach Mittelklasse.
»Und jetzt die Briefmarken!«, ruft Jean Gabin.
Mit einer für seinen massigen Körper erstaunlichen Geschmeidigkeit verschwindet er irgendwo im Flur.
»Papa«, protestiert Isabelle schwach.
»Und jetzt«, wiederholt der rote Zwerg entschlossen, »die Briefmarken!«
Casimir klebt immer noch an meinem Bein, ich tue, als würde ich das lauwarme Gesöff trinken, und habe plötzlich ein Briefmarkenalbum auf dem Schoß.
»In einem Album hat jede Marke einen festgelegten Platz«, hebt der Alte an. »Der Platz ist durch eine Reproduktion der Marke in Schwarzweiß oder Farbe markiert. An jedem Platz ist eine durchsichtige Hülle, in die man die Marke schiebt, um sie zu schützen. Früher gab es das, was der Philatelist den Briefmarkenfalz nannte, gefaltete und gummierte Papierstreifen, die auf einer Seite an die Rückseite der Marke und auf der anderen an das Album geklebt wurden. Die Verwendung des Briefmarkenfalz ist zu unterlassen, denn er verunstaltet die Marke, weil er Spuren darauf hinterlässt. Grundsätzlich kann man in Alben die Marken nach Jahren sortieren. Jedes Jahr verkaufen die Hersteller Ergänzungsblätter, in die man die Marken einordnen kann, die im Laufe des Jahres herausgegeben wurden. Aber man muss aufpassen, die Sortierung der Marken in den Alben wird recht teuer. Und hier, junger Mann, ein seltenes Stück. Eine Marke aus Französisch-Polynesien!«
Ich sehe ein völlig ausgeblichenes Stückchen Papier mit dem aufgedruckten Wert von 20 Francs und einer traurigen Palme vor blassblauem Meer.
*
Auf dem Rückweg gehen wir stumm nebeneinander her. Ich versuche mehrmals, nach Isabelles Hand zu greifen, aber sie wehrt ab.
Ich bin enttäuscht, sehr enttäuscht.
Bis dahin war ich überzeugt, alle Franzosen seien ein bisschen Künstler, Maler und Dichter.