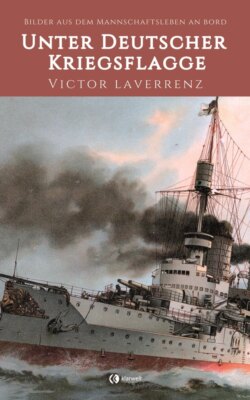Читать книгу Unter deutscher Kriegsflagge - Victor Laverrenz - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Arbeitsverteilung.
Оглавлениеur Arbeitsverteilung gehört an Bord jeder Dienst, der nicht militärisch ist, also in erster Linie der wirtschaftliche. Der Matrose ist nämlich sozusagen sein eigenes Mädchen für Alles und hat, da es an Bord keine Weiber gibt — „leider“ sagen die Jungen, „Gott sei Dank“ die Alten — auch die Frauenarbeit mit zu verrichten; diese ist dem Seemann die unangenehmste, ein Umstand, den ihm auch der Laie wird nachfühlen können.
Zu dem Allerschrecklichsten für den Matrosen aber gehört das Zeugwaschen, mit dem auch das Waschen der Hängematten und Bezüge verbunden ist. Eine bittere Ironie des Schicksals hat es gefügt, dass der Seemann, umgeben von einer ungeheuren Menge von Wasser, den Dualen des Durstes und des Waschwassermangels ausgesetzt ist, wie kein anderer Mensch auf der Erde, denn das Salzwasser ist trotz des besten Willens nicht zum Waschen zu gebrauchen, weil es sich mit keiner Seife verbindet und noch manche anderen unangenehmen Eigenschaft an sich hat.
Hunderte von Chemikern und tausende von Seeleuten, denn jeder Seemann ist auch ein bisschen Erfinder, haben sich schon vergeblich bemüht, eine Seife zusammenzustellen, welche in Seewasser löslich ist. Vergebliche Mühe, der starke Salzgehalt spricht allen Anstrengungen Hohn.
Süßwasser, oder wie es an Bord heißt, Frischwasser — auch wenn es Wochen und Monate alt und vollständig lauwarm ist — gehört aber auf einem in Fahrt befindlichen Schiff zu den seltenen Artikeln. In neuerer Zeit ist es freilich besser geworden; jedes Schiff ist mit einem oder mehreren guten Destillier-Apparaten versehen, welche dem Meerwasser den Salzgehalt entziehen und es bis zu einem gewissen Grade trinkbar machen; aber einen vollständigen Ersatz für Süßwasser bildet es trotzdem nicht, und die Schiffskommandanten benutzen daher jede Gelegenheit, ihre Wassertanks mit frischem Quell- oder Flusswasser aufzufüllen.
Schmutzig wird die Wäsche an Bord doch, trotzdem man glauben sollte, dass es hierzu wenig Gelegenheit gibt, da eigentlicher Staub ja vollständig fehlt; indessen sorgen jetzt schon die Schornsteine aus den unzähligen Maschinen für die nötige Rußablagerung und die unausgesetzten Arbeiten hinterlassen auch auf dem Zeug des reinlichsten Mannes ihre Spuren.
Zwei Stücke extra weißes Paradezeug, zwei Stücke hellgraues Arbeitszeug, zwei Stücke weißes Unterzeug, Exerzierkragen, Strümpfe und so weiter sind wöchentlich zweimal zu waschen. Hierzu kommen die Hängematte und der Matratzen-Überzug, die alle vierzehn Tage an der Reihe sind. Kein Wunder, dass den Leuten das Herz in die Hosen fällt, wenn das allerdings längst erwartete Kommando erschallt“ „Alle Mann sich, Zeug, Hängematten und Bezüge waschen!“ Denn woher das Wasser nehmen und nicht stehlen?
Im Wasser-„Besorgen“ ist allerdings der Matrose ziemlich skrupellos, und da er auf direktem Wege selten zum Ziel kommt, so schlägt er allerlei Schleichwege ein, ohne dass sich bei ihm das Gewissen sonderlich regt. „Die Anderen machen‘s ja ebenso.“ Er schreckt weder davor zurück, nächtlicher Weile seinem Kameraden das mühsam „gesparte“ und sorgsam verborgene Seifenwasser „auszuspannen“, noch heimlich dem Koch etwas aus dem großen Kessel abzuknöppen, und die Erfindungen, welche gemacht werden, um gelegentlich niederkommendes Regenwasser aufzufangen und in irgend einem versteckten Winkel bis zum Waschtag aufzubewahren, sind geradezu bewunderungswürdig. Im Hafen ist es ja besser; dort hat man an Frischwasser keinen Mangel zu leiden und hier tritt auch die Wäscherin am Lande in ihr Recht. Hat sie eine Tochter, was manchmal vorkommen soll, und man ist ein hübscher Kerl, so ist die Geschichte sogar außerordentlich preiswert und man kann vor den Kameraden in tadellos strahlendem Zeuge glänzen.
Zeugwaschen.
Unter dem Äquator, wo das Wasser wolkenbruchweise vom Himmel stürzt, wird das Waschen zum Fest. Dann werden die Speigatten an der Reling, welche für gewöhnliche Fälle dazu da sind, das Wasser von Deck nach außenbords abfließen zu lassen, verstopft, und das Oberdeck gleicht dann einem großen Badebassin, in dem die Leute nicht nur ihr Zeug waschen, sondern gleichzeitig ein Bad nehmen; das Kostüm besteht dann lediglich aus einer Badehose. Und wie die Mannschaft auf dem Vordeck, so benutzen die Herren Offiziere auf dem Achterdeck den Tropenregen zur körperlichen Erfrischung und lassen sich von Petrus ordentlich abduschen. Leider ist aber für die Leute die Zeit zum Zeugwaschen nur knapp bemessen. Früher, als ihnen lieb ist, erschallt das Kommando: „Ausscheiden mit Zeugwaschen! Alle Mann klar bei Waschjollen!“ Waschjollen sind die Leinen, an welchen das Zeug zum Trocknen aufgehängt wird. Aber es ist niemandem zu raten, sein frisch gewaschenes Zeug mit Kabelgarn zu befestigen, denn erstens ist es verboten und die Herren Maate passen mit Luchsaugen auf, und zweitens gibt es unweigerlich Teerstreifen, so dass das weiße Zeug aussehen würde, wie ein Zebrafell. Hierzu sind die aus ungeteertem Garn gedrehten „Nitzel“ notwendig, die jeder Mann in der erforderlichen Anzahl besitzen muss, und wehe ihm, wenn das nicht der Fall ist. Er verrät sich ja bei der nächsten Musterung durch das streifige Aussehen seines Zeuges selbst. „Heiß Waschjollen“, ertönt das Kommando des ersten Offiziers; die Leinen gehen nach oben und nun beginnt eine fürchterliche Musterung, denn ein großer Teil des Zeuges ist voller Flecken und gewissenhaft notiert der Stabswachtmeister auf Anordnung des ersten Offiziers diejenigen Nummern, welche schmuddelig sind, denn er muss sich ja die Augen aus dem Kopf schämen, mit so dreckigem Zeug an den Waschjollen zum Skandal der Menschheit in der Welt herumzusegeln. Ach, und wie oft schreitet das Unglück so schnell! Denn die Elemente hassen, wie schon Schiller vor mehr als hundert Jahren ganz richtig erkannt hat, das Gebild von Menschenhand, und ehe man‘s gedacht, reißt einmal die unklar gewordene Waschjolle, an der zu kräftig gezogen wird, und das rein gewaschene Zeug fällt auf den frisch gemalten Schornstein, nicht nur sich selbst bis zur Unkenntlichkeit entstellend, sondern auch dem Schornsteine ein Aussehen gebend, als hätte er das Fleckfieber. Kein Wunder, wenn dem Matrosen eine Gänsehaut über den Rücken läuft, wenn er nur an das Zeugwaschen denkt. Auch das Zeugflicken ist eine schwere Arbeit für den Matrosen, obgleich er sich damit schon lieber befasst, als mit dem Zeugwaschen. Braucht man doch zum Zeugflicken kein Frischwasser, das an Bord so schwer zu bekommen ist; Nähzeug muss sich jeder Mann so wie so halten. Das Zeugflicken wird gewöhnlich Sonnabends Nachmittags vorgenommen, und da sehen wir denn die Mannschaften mit ihren Kleiderkisten an Deck sitzen und liebevoll in ihren Sachen kramen. Die Kleidungsstücke sind seit einiger Zeit Eigentum der Mannschaft, welche sie kaufen muss und dazu einen Kleiderzuschuss erhält. Früher wurden sie vom Staate geliefert, aber bei dem neuen Modus stehen sich Staat und Mannschaft besser, denn letztere nimmt jetzt ihr Zeug sorgsamer in Acht und ein ordentlicher Matrose kann immerhin von seinem Kleiderzuschuss im Jahre noch bis 50 Mark erübrigen.
Es ist eigentümlich, welche stille, innige Liebe der Seemann seinem Kleiderkasten entgegenbringt. Bildet es z. B. doch am Sonntagnachmittag ein Hauptvergnügen für ihn, in seinen Sachen zu kramen und mit ihnen zu liebäugeln. Früher, als die Kleidersäcke noch Mode waren, wurden die darin verpackten Gegenstände durch die primitive Art ihrer Verstattung geradezu mit Gewalt verdorben. Auf den modernen Panzern besitzt jeder einzelne Matrose sein Spind, das, wie alles an Bord, von Eisen ist. Die Spinden werden in ihrem Inneren meist in musterhafter Ordnung gehalten; freilich gibt es auch wieder Kerle, die weder mit Güte noch Gewalt dahin zu bringen sind, ihre Sachen sauber und ihr Spind in Ordnung zu halten. Diese erhalten bald den Namen „Divisionsferkel“, während die anderen, die sich durch tadellos weißes Zeug auszeichnen zu „Musterknaben“ avancieren. Die Musterknaben erfreuen sich aber in den Reihen ihrer Kameraden durchaus nicht sehr großer Beliebtheit; vielmehr genießen sie den Ruf als Drückeberger und Augendiener, denn wer es mit seiner Arbeit ernst meint, wird schwerlich immer sauber bleiben können.
Die Prügel, welche früher im Leben des Seemanns eine so große Rolle spielte, — wer hätte nicht von der berüchtigten neunschwänzigen Katze gehört, die namentlich auf englischen Schiffen mit großer Ausgiebigkeit angewandt worden sein soll — ist glücklich abgeschafft, wenigstens bei uns, denn der deutsche Seemann ist mit Liebe und Freundlichkeit viel besser zu behandeln, als durch Strenge; nur im Stillen gibt es hier und da noch einen „unbeabsichtigten“ Stoß, namentlich können die Schiffsjungen hiervon erzählen, denn ihnen gehen bei solcher freundschaftlichen Belehrung manchmal die Augen über. Offiziere dürfen indessen von solchen heimlichen Zurechtweisungen nichts merken.
Ein Rest der alten Prügelei aber hat sich erhalten und das ist eine Prozedur, welche die Mannschaft selbst an einem der ihrigen vornimmt. Ist da z. B. so ein unverbesserliches Laster vorhanden, das sich aus Disziplinarstrafen nichts mehr macht und die Hälfte seiner Dienstzeit in der Arrestzelle verlebt, wenn es sich im außergewöhnlichen Zustande der Freiheit befindet, aber bei Vorgesetzten und Kameraden nur Ärgernis erregt und über die letzten durch sein Betragen manche Unbequemlichkeit heraufbeschwört, so wird ihm der „Jungfernkranz“ gesungen. Eines Tages sieht es sich plötzlich von einer Anzahl handfester Matrosen von allen Seiten umzingelt, und diese stimmen nun mit kräftigen Stimmen die bekannte Arie aus dem Freischütz an.
Der Bursche weiß, was dies zu bedeuten hat, und macht einen ohnmächtigen Versuch, seinem Verhängnis zu entfliehen; aber undurchdringlich erweist sich die Mauer der ihn Umgebenden. Da fühlt er sich von kräftigen Fäusten ergriffen, ein Sack fliegt über seinen Kopf und sein Oberkörper wird derart mit unwiderstehlicher Gewalt über eine Kanone gezogen, dass dessen weichster Teil sich prachtvoll zum Empfang der freundschaftlichen Schläge bereit legt, die nun mit Tauenden oder Scheiden von Seitengewehren hageldicht auf ihn herniedersausen.
Das kräftig gesungene Lied übertönt das Klatschen der Schläge und das Schreien des Gemaßregelten. Richtet er sich sodann nach vollzogener Prozedur empor und beabsichtigt vielleicht, seine Richter zur Anzeige zu bringen, so schaut er in so viele ironisch lächelnde Gesichter, dass ihm die Lust vergeht, mit irgendjemand anzubinden; es würde ihm auch schlecht bekommen.
In der Anwendung des Jungfernkranzes ist die Mannschaft vollständig souverän und lässt sich von keinem Vorgesetzten beeinflussen.
Das Strafgericht wird nur über einen Matrosen verhängt, der sich in hässlicher Weise gegen einen Kameraden vergangen oder fortgesetzt Bestrafungen der Mannschaft verursacht hat. Beschwerden über das Lynchgericht kommen fast nie vor, da die Missetäter gewöhnlich wissen, dass sie die Lektion sehr wohl verdient haben und durch eine Anzeige nur eine verbesserte, stark vermehrte Auflage veranlassen würden. Der „Jungfernkranz“ ist natürlich verboten, aber trotzdem wird er mit unverminderter Kraft gesungen, und merkwürdig genug ist es, dass weder Offiziere noch Unteroffiziere jemals davon Kenntnis erhalten, wenn das Strafgericht losgeht, Sie hören wohl das Lied singen, aber — sie wissen nicht, was es zu bedeuten hat(!).
Taklerarbeiten.
Schornsteinmalen.
Die sogenannten Takelarbeiten, das Splissen und Knoten von Enden, das Segelflicken und Nähen hat auf den modernen Schiffen fast ganz aufgehört, da die Takelage bis auf Kleinigkeiten weggefallen ist. So nehmen diese Arbeiten heut nur einen geringen Bruchteil von ehemals ein. In voller Blüte sind sie noch auf den Schulschiffen, die als Vollschiffe getakelt sind. Dort müssen die Seekadetten und Schiffsjungen alle diese seemännischen Arbeiten gewissenhaft lernen, um später das Meiste davon wieder zu vergessen. Wie sagte doch jener vorlaute Sextaner, als er sich mit den lateinischen Genusregeln so quälen musste? „Non vitne, sed scholae discimus!“ Wir lernen — nicht für das Leben, sondern für die Schule.
Die Reinlichkeit und Sauberkeit an Bord eines Kriegsschiffes hat längst einen Weltruf erworben, obwohl sie jetzt durch den Ruß, der aus den Schornsteinen hernieder fällt, zum großen Teil illusorisch wird.
Die Reinlichkeitswut, so kann man es getrost nennen, erstreckt sich aber nicht nur auf das peinlich saubere Scheuern der Holzteile, besonders der Decke, das Putzen der Kanonen und aller Metallteile an Bord, das sorgfältige Aufschießen des Tauwerks an Deck zu kunstvollen Figuren, sondern in fast noch höherem Grade auf das Sauberhalten grade derjenigen Teile, die am leichtesten schmutzig werden, nämlich der Schornsteine und derjenigen Teile der Masten, welche von dem Qualm der ersteren am meisten getroffen werden.
Hier hilft kein Scheuern, kein Putzen, kein Wischen, hier muss zu anderen Mitteln gegriffen werden. Kommandanten und erste Offiziere, welche ihr Schiff gern als ein Schmuckkästchen hinstellen und die Welt glauben machen wollen, es gäbe überhaupt keinen Rauch, wenden daher sehr häufig das Mittel des Schornsteinmalens an. Da wird denn der Schornstein von oben bis unten schön mit grauer Farbe gestrichen, und denselben Anstrich erhalten auch die Masten, wenn sie aus Eisen bestehen. Sind sie dagegen aus Holz gefertigt, so werden sie mit einem besonders hierzu konstruierten Instrument, dem Schraper, sauber abgeschabt und geschmiert; letzteres geschieht mit der berüchtigten Stengenschmiere, die jeder Bootsmann nach seinem eigenen „Rezepft“ zusammengestellt, in so reichlichem Maße, dass sie in der Sonne glänzen, als wären sie frisch poliert.
„Aber wie sehen denn die Kerle aus, welche diese Arbeit versehen? Es lässt sich ja denken, dass man hierbei nicht sonderlich reinlich bleiben kann. Aber solchen Schmutz hätten wir uns doch nicht vorgestellt!“ So höre ich lebhaft im Geiste meine schönen Leserinnen ausrufen, denn ich habe ihnen ja schon etwas von der schier übergroßen Reinlichkeit der Seeleute erzählt. Ja, meine verehrten Damen, wo gehobelt wird, fallen Späne, und wo Schornsteine gemalt, Tauwerk (mit Teer) gelabsalbt und Masten und Stengen geschmiert worden, da gibt es Flecke, Flecke, Flecke!
Kommt es doch vor, dass eine Pütze mit grauer Farbe von oben kommt (herunterfällt) und sich hierbei gewissenhaft an allen möglichen Tauen und sonstigen Gegenständen stößt, damit nur ja nichts von Farbe oder Fett in dem Gefäß zurückbleibt, sondern hübsch breit über das Deck gesprengt wird, unbekümmert darum, ob vielleicht der erste Offizier grade nach einer nicht weiß genug gescheuerten Stelle des Decks sah, oder der Wachhabende zum ersten Mal einen neuen Rock an hatte. Die Leute sind bei solchen Arbeiten, wo es, wie wir gesehen haben, unter Umständen Farbe oder Fett regnet, mit ganz besonderem Zeug angetan, es ist das sogenannte „Takelpäckchen“, auch „Takelzeug“ genannt.
Dies wird zum Schutz über das gewöhnliche Arbeitszeug gezogen, und von einem so kostümierten Mann kann man getrost sagen, er hat nichts menschliches mehr; grauend wendet sich jeder von solch einer schmutzstarrenden Gestalt und geht ihr weit aus dem Wege, aus Furcht, sie könnte ihn berühren.
Doch trösten wir uns mit dem alten Sprichwort: „Durch Nacht zum Licht“. Wenn diese notwendigen Reinigungs- und Auffrischungsarbeiten, welche begreiflicher Weise eine Unsumme von Unordnung und Schmutzerei verursachen, vorüber sind, dann wird das Schiff erst wahrhaft das sein, wozu Kommandant und erster Offizier es haben machen wollen, nämlich eine Zierde der deutschen Flotte, ein Schmuckkästchen im verwegensten Sinne des Wortes.