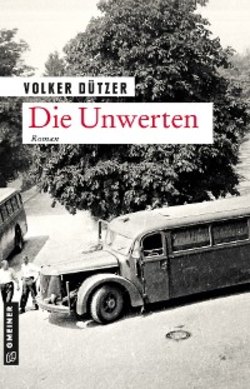Читать книгу Die Unwerten - Volker Dützer - Страница 11
4
ОглавлениеDas Columbushaus am Potsdamer Platz war ein modern anmutendes, beinahe futuristisches Bürogebäude. Lubeck war von der hoch aufragenden, fast vollständig verglasten Fassade beeindruckt. Seine Heimatstadt Würzburg war kein Dorf, konnte sich mit Berlin jedoch nicht messen. Berlin, das bedeutete eine Fülle an Möglichkeiten, Abenteuer und eine strahlende Zukunft, ein Tor zur Welt, das sich für ihn öffnen sollte.
Er stieg aus dem Fond des Maybach und legte den Kopf in den Nacken. In den vergangenen Tagen hatte er so viele imposante Bauwerke und Monumente gesehen, dass ihm von der schieren Größe der Stadt schwindelig war. Hier also sollte sich sein weiterer Lebensweg entscheiden. Beim Anblick des mit Hakenkreuzfahnen beflaggten Platzes glaubte er beinahe an das Gerede seines Vaters. Vor Lubecks Abreise hatte er wieder von Vorsehung und der Führungsrolle der deutschen Rasse gefaselt. Nun glaubte er selbst zu spüren, dass etwas Großes bevorstand, an dem er teilhaben durfte. Ja, das er sogar mitbestimmen durfte.
»Nun kommen Sie schon, Lubeck. Oder wollen Sie hier Wurzeln schlagen? Ihr alter Herr hat mich gewarnt, dass Sie ein Träumer sind.« Werner Heyde lachte, schlug ihm auf die Schulter und schob ihn auf den Eingang des Columbushauses zu. »Na, wir werden Ihnen die Flausen schon austreiben«, fuhr er fort. »Hier beginnt der Ernst des Lebens, große Aufgaben erwarten Sie, der Führer braucht jeden Mann.«
Lubeck lächelte und murmelte etwas von Überwältigung angesichts des historischen Augenblicks – Phrasen voller Superlative, von denen er wusste, dass sie bei Leuten wie Heyde gut ankamen.
Er kannte den Mann kaum, der seine Zukunft entscheidend mitbestimmen sollte. Sein Vater hatte Heyde an die Universität nach Würzburg geholt, wo er an den wissenschaftlichen Veröffentlichungen Hermann Lubecks mitgearbeitet hatte. Heyde besaß einen messerscharfen Verstand und einen ebenso bezwingenden Charme, mit dem er den Alten um den Finger gewickelt hatte. Eben diese Zielstrebigkeit und Klarheit war es, die Heyde ihm voraushatte.
Schnell war Lubeck klar geworden, warum ihn sein Vater nach Berlin geschickt hatte. Heyde besaß beste Kontakte zur Kanzlei des Führers und kannte Gott und die Welt. Um Karriere zu machen, konnte es keinen besseren Mentor geben.
Trotzdem empfand Lubeck das vertraute Gefühl der Demütigung. Sein Vater traute ihm nicht zu, sich allein durchzusetzen und eine Laufbahn als Psychiater aufzubauen. Also hatte er Heyde beauftragt, ihn in die höchsten Berliner Kreise einzuführen. Im Gegenzug teilte er den Ruhm seiner zweifelhaften Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Psychiatrie und Rassenkunde mit Heyde, was für sich genommen schon erstaunlich war. Der Alte war eitel, überheblich und beanspruchte alle Aufmerksamkeit für sich. Nichts machte ihm mehr Vergnügen, als im Rampenlicht zu stehen.
Seit drei Tagen hetzten sie von Termin zu Termin. Heyde schleppte ihn hinter sich her wie einen Kofferträger – eine Funktion, die er zuweilen tatsächlich erfüllen musste. Vom Anhalter Bahnhof war es im Eiltempo zur Tiergartenstraße Nummer 4 gegangen. Lubeck hatte erfahren, dass das geheime Projekt, an dem er mitarbeiten sollte, seinen Namen T4 eben jener Adresse verdankte. Von hier aus waren sie in die Reichskanzlei gestürmt, wo sich Heyde alle Türen von selbst öffneten. Man stellte ihnen einen eleganten Maybach nebst Fahrer zur Verfügung, und Lubeck fand kaum Zeit, Luft zu holen, da stoppten sie schon am Potsdamer Platz. Hier sollte er endlich erfahren, was die Zukunft für ihn bereithielt.
Für die Organisation von T4 hatte man im Columbushaus mehrere Büros und Besprechungsräume angemietet. Vor ihm öffnete sich eine Doppeltür, die in einen kleinen Saal führte. Lubeck zählte über zwanzig Männer, teils in den schwarzen Uniformen der SS, teils in Zivil. Sie standen in lockeren Gruppen zusammen, es roch nach Zigarrenrauch, Cognac und Kaffee. Er war 1932 selbst in die SA eingetreten und hatte es nach dem Röhm-Putsch bis zum SS-Untersturmführer gebracht. Der affige Pomp begeisterte ihn wenig, er sah seine Mitgliedschaft lediglich als Mittel zum Zweck. Was ihn dagegen faszinierte, war die Macht, die mit den Privilegien der SS einherging.
Ein Mann mit dunklem, streng gescheiteltem Haar und Hitlerbärtchen begrüßte sie. Heyde stellte ihn als Dr. Irmfried Eberl vor, Direktor der Anstalt in Brandenburg. Eberl machte sie mit den Anwesenden bekannt. Heyde schien die meisten zu kennen und organisierte Cognac. Während er den Branntwein hinunterstürzte, nippte Lubeck nur daran. Er vertrug keinen Alkohol und brauchte seine volle Konzentration.
Schüchtern schüttelte er Hände und versuchte, sich Namen und die dazu passenden Gesichter zu merken – hochrangige Parteimitglieder, die er nur vom Hörensagen kannte. Darunter der verkniffen dreinschauende Viktor Brack, Oberdienstleiter der Kanzlei des Führers Amt 2, und Philipp Bouhler, enger Vertrauter von Hitler und Leiter der geheimnisvollen Aktion T4.
Lubeck schüttelte die schlaffe Hand von Werner Blankenburg, Bracks Vertretung, und begrüßte ehrfürchtig Karl Brandt, den chirurgischen Begleitarzt des Führers. Die Namen der Psychiater und promovierten Ärzte vergaß er so schnell, wie sie genannt wurden – von Hegener, Conti, Linden, Ernst Baumhard und andere. Wozu mochte diese außergewöhnliche Versammlung von Akademikern dienen? Lubeck fühlte sich gehemmt. Er hatte keine Ahnung, was von ihm erwartet wurde. Angesichts der Prominenz war ihm klar, dass seine Laufbahn als Mediziner enden würde, bevor sie begonnen hatte, falls er hier versagen sollte.
Philipp Bouhler klopfte mit den Fingerknöcheln auf die Tischplatte. Als Chef der KdF eröffnete er die Zusammenkunft.
»Meine Herren, Obersturmführer Blankenburg wird Ihnen nun im Einzelnen erläutern, was von Ihnen erwartet wird. Im Anschluss darf ich Sie zu Tisch bitten, für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt. Außerdem wartet da noch eine kleine Vorführung auf Sie, damit Sie sehen, wie die Aktion in der Praxis durchgeführt werden wird.«
»Na, mit deutscher Gründlichkeit, hoffe ich doch«, dröhnte jemand. Die Bemerkung rief allgemeines Gelächter hervor.
Lubeck lachte mit, um seine Anspannung zu lösen. Er schien der Einzige im Raum zu sein, der nicht locker war. Schwatzend und scherzend nahmen alle an den T-förmig aufgestellten Tischen Platz. Bouhler, Brandt und Brack saßen an der Kopfseite, Blankenburg in ihrer Mitte. Er sortierte Unterlagen und begann mit seinen Einführungen.
»Es sind verschiedenste Maßnahmen zur Aufartung des deutschen Volkes unternommen worden, die sich in der Summe aber als unzureichend erwiesen haben«, leitete er in nasalem Tonfall ein. »Aufbauend auf den großartigen Grundsatzwerken zur Rassenhygiene von Hermann Lubeck – und ich freue mich, dass sein Sohn Joachim in seine Fußstapfen tritt und heute anwesend ist – darf ich sagen, dass wir Methoden entwickelt haben, die es nun in der Praxis zu erproben gilt.«
Alle Augen richteten sich einen Moment lang auf Lubeck. Bei der Erwähnung seines Namens schoss ihm das Blut ins Gesicht, eine Schwäche, der er seit seiner Kindheit hilflos ausgeliefert war. Sein hellblondes Haar verstärkte den Kontrast zusätzlich. Die Blicke von Conti und von Hegener ruhten prüfend auf ihm.
Heyde, der neben Lubeck saß, lehnte sich zu ihm herüber. »Blankenburg liebt Schachtelsätze«, bemerkte er glucksend. »Und er macht es gerne spannend.«
»Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 1. Januar 1935 ist hier ein erster, wenn auch unvollständiger Schritt, und dennoch eine legitime, brauchbare und notwendige Grundlage, um Schaden vom deutschen Volk abzuwenden.« Blankenburg nahm seine Brille ab und blinzelte. »Nun, wovon reden wir hier? Wir müssen jede Art von vererblicher Geisteskrankheit sowie Alkoholismus und andere Suchtkrankheiten als Gefahr für die Reinheit der arischen Rasse ansehen. Wir befinden uns im Krieg, der Feind ist mitten unter uns. Der Vermischung des deutschen Volkskörpers mit minderwertigem Erbgut wird durch das oben genannte Gesetz begegnet, aber das reicht nicht aus. Unser Führer und Reichskanzler Adolf Hitler hat somit in weiser Voraussicht Reichsleiter Philipp Bouhler und Dr. Karl Brandt damit beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte dergestalt zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. Dazu installieren wir ein System, um Volksschädlinge frühzeitig zu erkennen und auszusondern. Kommen wir nun zur praktischen Durchführung und Organisation.«
Lubeck versuchte, das Gehörte zu verarbeiten. Es hatte bereits Gerede gegeben. Er hatte Statistiken von Heilanstalten und psychiatrischen Einrichtungen studiert, die eine signifikante Zunahme an Todesfällen aufwiesen. Was er geahnt hatte, wurde in diesem Moment zur Gewissheit. Wen die Nazis als krank oder unbrauchbar einstuften, der sollte vom Erdboden getilgt werden.
»Endlich hat man sich in der KdF zu einem entschlossenen Handeln durchgerungen«, raunte Heyde ihm ins Ohr. »Das ist die Gelegenheit für Sie, Ihrer Karriere einen ordentlichen Schub zu verpassen.«
Lubeck nickte stumm. Ein Schweißtropfen rann kitzelnd an seinem Rückgrat herab.
»Eine vernünftige Sache ist das«, murmelte Heyde, »und längst überfällig dazu. Denken Sie nur, welche immensen Kosten so ein Schwachsinniger erzeugt – das Essen, die Unterbringung, Medikamente, die das Leiden nur verlängern.«
Blankenburg erklärte die Mechanismen hinter der Aktion T4. Lubecks Aufgabe würde es sein, Patienten zu begutachten und Meldebogen auszufüllen. Mit anderen Worten: Er war fortan Herr über Leben und Tod. Das Blut rauschte in seinen Ohren, Blankenburgs Worte drangen kaum bis zu ihm vor.
Bouhler ließ Muster der Meldebogen austeilen. Alles war bis ins Detail durchgeplant worden, und Lubeck würde ein wichtiges Rad im Getriebe dieser Todesmaschinerie sein.
»Haben Sie, meine Herren, als Gutachter ein Urteil über den Patienten gefällt, tragen Sie es hier in dem vorgedruckten schwarzen Kasten ein«, fuhr Blankenburg fort. »Ein Plus bedeutet, der Gnadentod wird gewährt – bitte mit Rotstift vermerken –, ein blaues Minus, und der Patient darf weiterleben. Wenn Sie unsicher sind, genügt ein Fragezeichen, und der Fall wird vorerst zurückgestellt. Sie haben jetzt Gelegenheit, Fragen zum Ablauf zu stellen.«
Lubeck wagte nicht, bei all der Prominenz nachzufragen, aus Angst, sich zu blamieren. Es würde sich ohnehin nach und nach alles von selbst erklären. Bouhler und Brandt hatten bereits alles bis ins Letzte durchorganisiert und die einzelnen Abteilungen mit ihren jeweiligen Leitern und Ansprechpartnern eingerichtet, es gab sogar schon Briefköpfe. Für einen Transport der Kranken zu ihren Bestimmungsorten hatte man eine eigene Transportfirma ins Leben gerufen, die Gemeinnützige Krankentransport-GmbH, kurz Gekrat.
»Sie werden verstehen, dass wir für die einzelnen Abteilungen Tarnnamen verwenden«, referierte Blankenburg, »in der KdF ist man sich nicht sicher, ob das deutsche Volk den Weitblick besitzt, die Aktion in vollem Umfang zu unterstützen.«
Das wird es nicht, dachte Lubeck, man muss sich das mal vorstellen: Hier wird tausendfacher Mord geplant. Reiß dich zusammen. Schau dir Heyde an, der ist eiskalt. Dennoch, wenn das eines Tages rauskommt, sind wir alle erledigt.
Der Gedanke an absolute Macht gewann schließlich die Oberhand in ihm. Niemand würde ihn mehr verspotten, wenn er errötete wie ein Schuljunge. Mit einem Federstrich bestimmte er, wer leben durfte und wer sterben sollte. Er dachte an die Ratten, die er als Kind in Fallen gefangen und bei lebendigem Leib angezündet hatte, um seine Wut und das Gefühl der endlosen Demütigungen des Alten loszuwerden.
Aber hier ging es nicht um Ratten oder ein paar überzählige Katzen, die man in einen Sack steckte und ertränkte, sondern um Menschenleben. Und gerade das machte den Reiz unwiderstehlich.
Er versuchte, in den Mienen der anderen Ärzte zu lesen. Was ging in ihnen vor? Waren sie so abgebrüht wie Heyde?
Ich weiß nicht, ob ich das kann, dachte er. Lähmende Zweifel plagten ihn. Blankenburg hatte von einem neuen Verfahren gesprochen, einer Methode, die weitaus effizienter war, als Patienten mit einer Überdosis Luminal oder Scopolamin zu töten. Er versuchte, sich vorzustellen, wie er die tödliche Nadel in die Vene eines zur Euthanasie bestimmten Kranken einführte. In ihm kämpfte die Angst zu versagen gegen eine sexuelle Erregung, die wie ein Stromschlag seine Nervenbahnen entlang raste. Sicher würden auch Frauen unter den Opfern sein.
In Gegenwart einer schönen Frau setzte sein Denken aus und er brachte nichts weiter als dümmliches Gestammel hervor. Anschließend brannte meist heiße Wut in seinem Bauch, und er verspürte eine irrsinnige Lust zu bestrafen und zu töten. Wenn er offizieller Gutachterarzt der Aktion T4 war, würden die Frauen ihn anflehen, sie am Leben zu lassen. Dafür wären sie zu allem bereit. Ob es nur um Schwachsinnige ging? Blankenburg hatte erwähnt, dass auch Alkoholiker und notorische Querulanten ins Visier gefasst wurden.
»Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass die Teilnahme an der Aktion T4 freiwillig ist«, sagte Blankenburg. »Sollten Sie also zu dem Entschluss kommen, dass Sie Ihre Pflicht als Nationalsozialist nicht erfüllen können, dann verlassen Sie jetzt den Saal. Selbstverständlich haben Sie über das soeben Gehörte Stillschweigen zu bewahren. Andernfalls müssen Sie mit erheblichen strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die Aktion T4 ist geheime Reichssache. Wir haben uns verstanden.«
Blankenburg setzte sich. Niemand verließ den Saal. Detailfragen wurden diskutiert, anschließend wurde jedem der anwesenden Psychiater ein Gebiet zugeteilt. Lubeck würde nach Frankfurt gehen.
»Ich bat Blankenburg, Sie zu Landesrat Brunner zu schicken. Er ist Dezernent für das Anstaltswesen in Hessen-Nassau. Schöne Gegend übrigens. Der Fritz ist genau der Richtige, um Sie in die besten Kreise einzuführen«, erklärte Heyde lächelnd.
»Und nun«, er rieb sich mit der flachen Hand über den Bauch, »lassen Sie uns etwas essen gehen. Dieses Gerede macht hungrig.«
Stühlerücken setzte ein, Lubeck folgte den anderen in einen extra für die Gesellschaft hergerichteten Speisesaal. Es gab Gulaschsuppe, die in einem riesigen Kessel dampfte, dazu ofenfrisches Brot. Er musste sich zwingen, einen Bissen herunterzuwürgen. Was mochte es mit der Vorführung auf sich haben? Er kaute auf einem Stück Kruste und schluckte. Der klebrige Teig verstopfte seine Kehle, er hatte das Gefühl zu ersticken und spülte den Klumpen mit Mineralwasser hinunter.
Am Nebentisch unterhielten sich zwei Ärzte über die Vorzüge und Nachteile der verschiedenen Gifte und Narkosemittel, mit denen sie bereits Patienten getötet hatten. Sie sprachen so beiläufig darüber, als ob es darum ging, wie man ein Schwein am besten schlachtete.
Heyde berichtete von seiner Arbeit in Würzburg und lobte den Alten in höchsten Tönen. Lubeck hörte kaum zu, langsam geriet er in Panik. Mitgefangen, mitgehangen. Aber denk an die Frauen. Denk an die Macht in deinen Händen!
Er schaffte es schließlich, den Teller auszulöffeln. Heyde paffte eine Zigarre, Bouhler quatschte von der Überlegenheit der arischen Rasse.
Nach dem Essen fuhren sie mit einem gemieteten Omnibus der Reichspost nach Brandenburg an der Havel, wo die Vorführung, von der Blankenburg gesprochen hatte, stattfinden sollte. Das ehemalige Zuchthaus an der Neuendorfer Straße glich einem gewaltigen Ziegelstein, in den Hunderte Arbeiter Schlitze und Fenster gemeißelt hatten. Die Vorstellung, dass sich hier an diesem 4. Januar 1940 sein Schicksal erfüllen könnte, erzeugte in Lubeck eine Mischung aus Furcht und Erregung. Von der Vorsehung ausgewählt worden zu sein, erfüllte ihn mit Stolz, aber auch mit einer gehörigen Portion Unsicherheit. Ach, Unsinn … Es kam nur darauf an, sich rechtzeitig auf die richtige Seite zu stellen.
Lubeck konnte sich später nicht erinnern, wie er in das Kellergeschoss gelangt war. Es stank nach Desinfektionsmitteln, Schweiß und Angst. In die Zellentüren auf beiden Seiten des schmalen Ganges waren vergitterte Fenster eingelassen. Von Zeit zu Zeit hörte man Wimmern oder irres Gemurmel, ab und zu einen gedämpften Schrei, die meiste Zeit aber herrschte Stille.
Sie verließen den Kellertrakt wieder und betraten einen zentralen Lichthof, wo sie ein Glatzkopf mit Zweifingerschnauzer und Brille empfing. Er schlug die Hacken zusammen und stellte sich als SS-Obersturmführer Christian Wirth vor. Lubeck atmete dankbar die frische Luft ein, ihm war leicht übel.
Wirth führte sie in einen Trakt im gegenüberliegenden Gebäude und stoppte vor einer offenen Tür, hinter der er ein gekachelter Raum lag. Er erklärte, was nun folgen sollte. Seine Worte drangen bald nicht mehr bis an Lubecks Ohren, denn ein Wärter trieb ein Dutzend Menschen den Gang entlang und in den gekachelten Raum. Sie waren nackt und hielten schützend die Hände vor ihre intimsten Stellen. Lubeck starrte eine junge Frau von etwa zwanzig Jahren an, sie wirkte apathisch, in ihre innere Welt zurückgezogen. Doch schien sie zu wissen, was passieren würde.
Die Tür schloss sich. Wirth erklärte die Wirkung des Kohlenmonoxidgases, das nun in die Kammer geleitet wurde. Heyde und Blankenburg drängten sich vor ein Guckloch, das in den Stahl eingelassen war. Lubecks Magen verkrampfte sich. Er machte kehrt, rannte den Korridor entlang, durch den sie gekommen waren, und fand eine Tür mit der Aufschrift Klosett.
Explosionsartig übergab er sich in die stinkende Kloschüssel und würgte, bis sein Magen leer war. Er wollte raus, wollte alles, was er gesehen und gehört hatte, ungeschehen machen und aus seiner Erinnerung verbannen. Er ahnte, dass sich die Bilder der Tür, die sich schloss, für immer in sein Gedächtnis eingefressen hatten. Das Letzte, was er wahrgenommen hatte, waren die Augen der jungen Frau gewesen, teilnahmslos, ergeben und von der fiebrigen Schönheit einer Schwindsüchtigen. Sie hatte ihr Schicksal akzeptiert. Er war überzeugt, dass sie den Tod als Erlösung empfand. Nicht wegen einer unheilbaren Krankheit, die ihr Schmerzen bereitete, sondern weil das Leben in der Welt, die Brandt, Bouhler und er selbst gerade erschufen, für sie nicht schlimmer sein konnte als die Hölle.
Er stemmte sich hoch und drehte den Hahn über dem Waschbecken auf. Dann schöpfte er kaltes Wasser in die hohlen Hände und spülte sich den Mund aus. Die Teilnahme an der Aktion T4 war freiwillig, Blankenburg hatte es bestätigt. So sehr ihn die Vorstellung lockte, Macht über Leben und Tod zu erlangen, war er nicht hart genug dafür. Er würde sich der Schande aussetzen und um seine Entlassung bitten.
Lubeck wischte sich die Lippen mit dem Handrücken ab und verließ den Waschraum. Im Korridor begegnete ihm Heyde, den nach dem vielen Cognac offenbar ein Bedürfnis quälte.
»Wo stecken Sie denn? Sie haben das Beste verpasst. Großartig, das Gas wird die Effizienz der Aktion enorm steigern.« Er runzelte die Stirn. »Geht’s Ihnen nicht gut? Was Falsches gegessen?«
»Es war wohl der Cognac«, antwortete Lubeck. »Ich vertrage keinen Alkohol, trinke sonst nie welchen.« Wie sollte er Heyde beibringen, dass er zu weich war? Was seinem Vater sagen, wenn er nach Würzburg zurückkehrte?
»Sie machen mir doch wohl nicht schlapp?« Heyde legte ihm die Hand auf die Schulter. »Sie müssen härter werden, Mann. Das deutsche Volk braucht Sie!« Er deutete den Gang entlang. »Das sind doch gar keine richtigen Menschen – Schwachsinnige, Epileptiker, Juden und Unruhestifter, die sich nicht anpassen wollen. Sehen Sie es so: Wir tun ihnen einen Gefallen und beenden ihre Leiden auf humane Weise. Sie hätten es erleben müssen, dann würden Sie verstehen, was wir hier leisten.«
Lubeck nickte, unfähig, etwas zu entgegnen.
Heyde trat dicht an ihn heran. »Ich kann Sie zu nichts zwingen«, sagte er leise, »aber wenn Sie jetzt nicht die Arschbacken zusammenkneifen, kann nicht mal ich Sie vor dem Fronteinsatz retten. Oder wollen Sie, dass die Wehrmacht Sie einkassiert? Polen ist erst der Anfang, da kommt noch mehr auf uns zu, glauben Sie mir. Die meisten Ärzte Ihres Jahrgangs schuften schon in den Feldlazaretten. Ich konnte gerade noch verhindern, dass Ihr Einberufungsbescheid rausging – von wegen unabkömmlich aufgrund von T4 und so weiter, Sie verstehen?«
»Es war wirklich nur der Cognac«, versicherte Lubeck.
»Dann lassen Sie in Zukunft die Finger von dem Zeug. Ich dachte schon, ich müsste mir Sorgen machen. Wüsste nicht, wie ich das Ihrem Vater beibringen sollte. Morgen früh ist Abmarsch Richtung Frankfurt. Melden Sie sich bei Landesrat Fritz Brunner. Sie werden dort Meldebogen erstellen, bis Sie zusammenbrechen, haben Sie das verstanden?«
»Jawohl, Hauptsturmführer Heyde.«
»Gut, gut. Und machen Sie mir keine Schande, Lubeck.«