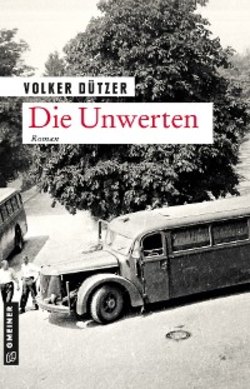Читать книгу Die Unwerten - Volker Dützer - Страница 14
7
Оглавление»Ich will nicht, dass du mit diesem Mann ausgehst.«
Hannah sah zu, wie Malisha mit einem Kajalstift die Konturen ihrer Augenlider nachzog. Insgeheim bewunderte sie die Art, in der ihre Mutter mit wenigen gezielten Strichen eine große Wirkung erzielte. Sie wünschte sich, sie wäre alt genug, um es selbst zu versuchen. Aber Malisha wollte nicht, dass sie sich schminkte.
»Ich habe es dir doch erklärt, Hannah. Wir können im Augenblick das Land nicht verlassen. Sie haben Heinz, Chang und die anderen verhaftet. Ohne ihre Hilfe komme ich nicht einmal aus der Stadt heraus. Bis mir etwas einfällt, bietet uns Dr. Lubeck den besten Schutz, den wir bekommen können.«
»Er hat gedroht, mich zu sterilisieren. Wie kannst du ihm vertrauen?«
Malisha blickte in den Spiegel, ihre Blicke trafen sich. Sie lächelte. »Hältst du mich für so unvorsichtig? Ich kann den eitlen Kerl nicht ausstehen und traue ihm nicht über den Weg. Aber er will etwas von mir, und so lange er glaubt, dass er es bald bekommen wird, sind wir in Sicherheit.« Sie seufzte und überprüfte mit einem kritischen Blick ihr Erscheinungsbild. »Manchmal muss man Dinge tun, die man nicht will, um ein Ziel zu erreichen.«
»Und wenn er sich mit Gewalt nimmt, was er haben will?«
Malisha drehte sich zu ihr um und fasste sie bei den Schultern. Hannah sog den Duft ihres Parfums ein. Ihre Mutter benutzte Csardas, was sie sehr mochte. Ihre Augen wirkten durch die schwarze Umrandung groß und feucht. Das Weiß kontrastierte wunderbar mit den haselnussbraunen Iris.
»Es ist unsere einzige Chance. Die Amerikaner stellen keine Visa mehr aus, und auch die Engländer lassen keine Emigranten mehr ins Land.«
»Warum gehen wir nicht in dein Heimatland? Nach Palästina?«
»Ich bin in Deutschland geboren, Hannah. Ich kenne niemanden dort. Außerdem ist Palästina britisches Mandatsgebiet.«
»Dann gehen wir zu meinem Vater. Er wird uns helfen. Er ist Pilot, er kann uns überall hinbringen.«
»Wenn es nur so einfach wäre.«
Malisha streifte die schwarze Jacke mit dem Zobelkragen über. Hannah hatte nur zweimal erlebt, dass sie das kostbare Kleidungsstück getragen hatte.
Ihre Mutter hauchte ihr einen Kuss auf die Wange. »Spätestens gegen Mitternacht bin ich zurück. Öffne niemandem die Tür.«
»Wenn wenigstens Joschi hier wäre.«
Auf Malishas Stirn erschien eine Sorgenfalte. »Ich habe seit zwei Tagen nichts von ihm gehört. Ich hoffe, er konnte sich in Sicherheit bringen.« Sie sah auf ihre Armbanduhr. »Lubeck wird gleich kommen. Ich gehe hinunter.«
»Ich mag ihn nicht, und ich habe Angst um dich«, beharrte Hannah.
»Ich kann auf mich aufpassen. Leg die Kette vor, wenn ich draußen bin.«
»Sag mir wenigstens, wo ihr hingeht.«
»Ich weiß es nicht. Er hat es mir nicht verraten.«
Malisha trat in das Treppenhaus, in dem es nach Kohl und Bohnerwachs roch, und schloss die Wohnungstür hinter sich. Sie lügt, dachte Hannah. Malisha lügt, weil sie mich beschützen will. Aber diesmal bin ich diejenige, die auf sie aufpassen muss.
Sie lief ins Wohnzimmer und spähte durch einen Spalt in der Gardine. Ihre Mutter hatte sie aus einem schweren, steifen Stoff genäht, damit kein Licht nach außen drang. Sie war vorsichtig geworden, misstrauisch gegenüber Fremden und ängstlich in der Dunkelheit. Nicht nur die kalte Januarnacht war mondlos und schwarz, auch die Zeit, in der sie lebten, war finster.
Sorgenvoll beobachtete Hannah die Straße. Eine schwarze Limousine hielt vor dem Haus. Malishas Silhouette erschien im Lichtkegel einer Straßenlaterne. Der Fahrer stieg aus, umrundete den Wagen und öffnete die Beifahrertür. Lubeck hob den Kopf und starrte zum Fenster herauf, als wüsste er genau, dass Hannah hinter dem Vorhang stand und ihn nicht aus den Augen ließ. Im Licht der Laterne schien sein ausdrucksloses Gesicht bleich und wächsern.
Malisha stieg ein, Lubeck schloss die Tür, und der Wagen fuhr los.
Hannah nahm ihren Mantel vom Garderobenhaken und stülpte eine Wollmütze über das Haar. Dann steckte sie den Zweitschlüssel der Haustür ein, eilte die Stufen hinunter und lief auf die Straße. Sie musste Joschi finden. Er würde auf Malisha aufpassen, ihm fiel immer etwas ein, was man tun konnte.
Sie wusste, dass Malishas Freunde nach dem Brand in der Pagode einen neuen Treffpunkt vereinbart hatten, eine unauffällige kleine Kneipe, nicht weit von dem zerstörten Nachtklub entfernt. Wenn sie sich beeilte, könnte sie in einer Viertelstunde dort sein. Die frostige Luft brannte bei jedem Atemzug in ihren Lungen, aus dem Nachthimmel segelten winzige Schneekristalle.
Hannah hielt den Kopf gesenkt, benutzte Nebenstraßen, wenn sie keinen großen Umweg bedeuteten, und näherte sich langsam ihrem Ziel. Ein vierzehnjähriges Mädchen hatte zu dieser Uhrzeit auf den Straßen Frankfurts nichts zu suchen und musste unweigerlich Aufmerksamkeit erregen – was sie unter allen Umständen vermeiden wollte.
Atemlos erreichte sie den Platz, auf dessen Nordseite sich die Pagode befunden hatte. Verkohlte Dachbalken ragten wie faule Zahnstümpfe in den Nachthimmel, leere Fensteröffnungen gähnten in der von Rauch und Feuer geschwärzten Fassade. Die Braunhemden hatten das Haus bis auf die Grundmauern niedergebrannt.
Hannah glaubte, die Hitze des Feuers noch zu spüren. Je näher sie der Ruine kam, desto stärker wurde der Brandgeruch. Sie blickte sich suchend um. Mehrere Gassen zweigten von dem Platz ab, in denen es ein Dutzend Kneipen gab. Ihr überhasteter Plan drohte zu scheitern, weil sie nicht einmal den Namen des Lokals kannte, ihre Beine waren schneller als ihr Kopf gewesen. Wo sollte sie Joschi in diesem Labyrinth finden?
Vorsichtig wagte sie sich in eine der Gassen hinein. Aus einer Gastwirtschaft drangen laute Stimmen und Musik und übertönten die Gefahr, die ihr drohte. Hannah spürte eine schwielige Hand auf ihrem Mund. Jemand zog sie in das Dunkel der Durchfahrt und hielt sie fest. Instinktiv versuchte sie, sich zu befreien, trat um sich und griff nach der Hand, die sie zu ersticken drohte.
»Schsch«, machte eine heisere Stimme.
Die Hand löste sich von ihrem Mund, der Unbekannte drehte sie um und tätschelte ihren Rücken.
»Joschi!«
Sein linkes Auge war blutunterlaufen, ein tiefer Kratzer zog sich von der Braue bis zum Ohr. Im Halbdunkel sah er zum Fürchten aus. Offenbar war es ihm gelungen, der SA um Haaresbreite zu entkommen.
Er legte einen Finger an die Lippen und deutete auf den Platz hinaus. Aus der Kneipe quoll ein Haufen Braunhemden. Sie waren betrunken, grölten und sangen laut und falsch. Joschi musste sie schon vorher gesehen haben. Hätte er nicht so schnell reagiert, wäre die Horde über sie hergefallen.
Er tippte ihr spielerisch an die Schulter.
Was machst du hier?
»Ich habe dich gesucht. Und du?«
Beobachten, signalisierte er. Ich suche Chang und die anderen.
Aus Hannah sprudelten die Ereignisse hervor, von denen er nichts wissen konnte. Als er den Namen Lubeck hörte, verdüsterte sich seine Miene.
»Bitte. Du musst Malisha suchen. Ich habe Angst um sie.«
Nachdenklich rieb er sich das Kinn. Dann drehte er sich im Kreis und sah Hannah fragend an.
Wo sind sie hingegangen?
»Ich weiß es nicht. Bitte, du musst sie finden.«
Joschi hob beruhigend die Hände und deutete an, dass Hannah nach Hause gehen solle.
»Kann ich nicht mitkommen?«
Er schüttelte entschieden den Kopf und schob sie sanft von sich.
Geh jetzt! Ich werde sie suchen.
Er streckte den Kopf aus der Toreinfahrt und schnüffelte in der kalten Luft wie ein Terrier, der Beute witterte. Die Braunhemden waren fort.
Hannah machte sich auf den Rückweg. Sie drehte sich noch einmal um und sah, dass Joschi im Eilschritt über den großen Platz lief. Er hatte viele Freunde und kannte eine Menge Leute, die bereit waren, ihm zu helfen. Er würde Malisha finden und beschützen. Er musste einfach.
Zwanzig Minuten später betrat sie die Wohnung im ersten Stock des Mietshauses. Da sie ohnehin nicht schlafen konnte, erwärmte sie in einem Kessel auf dem Gasherd Wasser und bereitete Tee zu, um die Kälte der Winternacht zu vertreiben. Dann setzte sie sich in den Sessel neben dem Fenster und wartete, den Zeiger der Standuhr im Blick.
Früher hatten sie einen Volksempfänger besessen, abends hatten sie Musik gehört und dazu getanzt. Malisha war eine gute Tänzerin und brachte ihr alles bei, was sie wissen musste, und Hannah erwies sich als gelehrige Schülerin. Sie mochte Foxtrott, den neuen Boogie und vor allem Swing. Wie alles, was nicht Einförmigkeit und stupides Marschieren erforderte, hatten die Nazis die Negermusik verboten. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, breitete sie sich in den Nachtklubs und Tanzlokalen ungehindert aus.
Vor vier Monaten hatten sie den Juden den Besitz eines Radios verboten. Wer seinen Apparat nicht freiwillig abgab, musste damit rechnen, dass er konfisziert wurde. Empfindliche Geldstrafen waren die Folge. Hannah summte eine Melodie, die ihr in den Sinn kam. Der Minutenzeiger kroch dahin, und irgendwann zwischen elf und Mitternacht schlief sie ein.
Eine Stunde später schreckte sie aus dem Schlaf hoch. Die Standuhr zeigte 00.45 Uhr an. Aus dem Laden, der sich im Erdgeschoss unmittelbar unter der Wohnung befand, drang Lärm. Ein schwerer Gegenstand wurde umgeworfen, ein dumpfes Klopfen, ein Scharren und Stoßen folgte. Glas zerbrach klirrend. Hannah hielt den Atem an und lauschte, ihr Herz klopfte aufgeregt gegen die Rippen. Wahrscheinlich zogen die Braunhemden durch die Straßen, um die wenigen jüdischen Geschäfte und Einrichtungen zu attackieren, die ihnen bis jetzt entgangen waren. Sie lief zum Fenster und spähte durch einen Spalt in der Gardine. Draußen war alles ruhig, niemand grölte oder schrie Naziparolen. Auch konnte sie keinen Fackelschein erkennen.
Wieder grollte ein schweres Rumpeln durch den Laden, die Teetasse klirrte auf dem Porzellanuntersetzer. Seit Wochen waren Einbrecherbanden unterwegs, die jüdische Läden, Handwerksbetriebe und Wohnungen ungestraft ausräumten. Sie gaben sich nicht einmal mehr Mühe, ihr Treiben zu verheimlichen, denn niemand kümmerte sich darum. Die Polizei zu alarmieren war sinnlos, kein deutscher Beamter würde einen Finger rühren, um ein jüdisches Geschäft zu schützen.
Vielleicht war es Malisha, und sie schwebte in Gefahr. Hatte Joschi sie nicht finden können? Die Stadt war groß. Aber wenn ihre Mutter den Krach verursachte, war sie sicher nicht allein. War Lubeck mit ihr unten im Laden?
Seit ihrem Zusammenbruch in der Schule begleitete Hannah eine ständige Furcht. Sie brodelte mal stärker, mal schwächer in ihrem Bauch. Niemals verschwand sie ganz. Wurde sie zu mächtig, kehrte der Schwindel zurück und sie torkelte am Rand einer Ohnmacht dahin. Seit sie den Namen der Krankheit kannte, die sich in ihrem Kopf eingenistet hatte, kämpfte sie verbissen gegen die Phasen drohender Bewusstlosigkeit an. Vor ein paar Tagen war Malisha mit ihr noch einmal zu Dr. Blumberg gegangen. Er hatte ihr erklärt, dass Aufregung und Angst die Attacken verstärken konnten; und genau das geschah in diesem Moment mit ihr.
Hannah kniff sich in den Arm, bis der Schmerz für kurze Zeit die aufkommende Panik verdrängte. Manchmal funktionierte dieser Trick.
Leise zog sie die Vorlegekette aus der Sicherungsschiene der Wohnungstür. Dann schlüpfte sie durch den Türspalt und schlich auf Zehenspitzen nach unten, ohne das Licht anzuschalten. Sie zählte die Stufen und achtete auf die dritte und achte, die laut knarrten, wenn man auftrat. Schließlich stand sie im Korridor, der durch ein kleines Stofflager zur Hintertür des Schneiderladens führte. Durch den Türspalt fiel Licht in den Flur, ein schwerer Gegenstand kippte im Laden um und fiel zu Boden. Weicher Stoff schien das Poltern zu dämpfen. Das Licht unter der Tür flackerte, verlosch und flammte wieder auf. Die Aufregung schärfte Hannahs Sinne. Jemand schrie leise auf, rang nach Luft, es klang gequält und schmerzvoll. Malisha!
Die Tür zum Laden war unverschlossen. Ohne sich zu erinnern, wie sie hierhergelangt war, stand Hannah in dem kleinen Lagerraum. Der vertraute, trockene Geruch von Stoffen und Wolle kroch in ihre Nase. Sie durchquerte den Raum und schob vorsichtig die Tür zum Laden auf. Stoffballen waren aus ihren Fächern gezerrt worden und lagen ausgerollt und zerknüllt auf dem Boden. Zwei Gestalten rangen in dem Durcheinander. Lubeck kniete auf Malisha, presste ihre Arme auf den Boden und versuchte, ihre Beine auseinanderzudrücken. Sein blasses Gesicht war puterrot, die Augen traten ihm aus den Höhlen, Speichel tropfte aus seinem Mundwinkel. Er ließ sich stöhnend nach vorne fallen und presste seinen Mund auf Malishas Lippen. Sie versuchte, sich zu befreien, kam aber gegen seine rohe Kraft nicht an.
Hannahs Herzschlag beschleunigte sich, aus den Augenwinkeln kroch die Schwärze heran wie zähflüssiger Teer. Mechanisch ging sie auf den Tisch zu, auf dem ihre Mutter die Stoffbahnen zurechtschnitt, und griff nach der großen, scharfen Schneiderschere.
Ein Irrenhaus kostet eine Million Reichsmark. Wie viele deutsche Familien könnten von dem Geld eine Wohnung bekommen?, schoss es Hannah durch den Kopf.
»Zweitausendzwölf«, sagte sie laut. Es waren zweitausendzwölf.
Lubeck grunzte und fuhr herum. Überrascht glotzte er sie an und entdeckte die Schere in ihrer Hand.
»Hannah, nein!«, rief Malisha.
Lubeck stieß Malisha auf den Boden zurück und bemühte sich, auf die Beine zu kommen. Ein Lichtreflex blitzte auf der Scherenklinge und stach schmerzhaft in Hannahs Augen. Ihr Arm beschrieb einen Bogen, ohne dass sie ihm befohlen hätte, sich zu bewegen. Auf Lubecks linker Wange erschein wie von Geisterhand ein roter Strich. Er schrie auf, taumelte und presste die Hand auf das Gesicht, zwischen seinen Fingern quoll Blut hervor. Sehr viel Blut. Er jammerte und schluchzte wie ein Kind, das sich die Knie aufgeschlagen hat. Schreiend torkelte er im Laden umher und griff nach einem Stofffetzen, um ihn auf die Wunde zu pressen. Hannah ließ die blutige Schere fallen und verlor das Bewusstsein, gnädige Finsternis umfing sie.