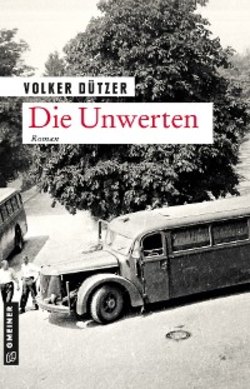Читать книгу Die Unwerten - Volker Dützer - Страница 17
10
ОглавлениеDie nächsten Wochen verbrachte Hannah in fieberhafter Erwartung. Joschi brachte schlechte Nachrichten, die Polizei suchte noch immer nach ihnen. Die Situation der Juden in Deutschland verschlechterte sich mit jedem Tag, und damit die Aussicht, das Land verlassen zu können. England, Frankreich und Amerika weigerten sich, die große Zahl von Emigranten aufzunehmen. Viele Juden irrten auf der Suche nach Zuflucht durch Europa. Auf dem Mittelmeer kreuzten Schiffe mit Flüchtlingen wochenlang, ohne die Erlaubnis zu erhalten, einen Hafen anzulaufen. Joschi hatte versucht, Hannah in einem der Kindertransporte unterzubringen, die der Londoner Börsenmakler Otto Schiff organisierte, aber Kinder mit Behinderungen wurden nicht angenommen. Aufgrund ihrer epileptischen Anfälle zählte Hannah zu dieser Gruppe. Sie hätte sich ohnehin geweigert, das Land ohne Malisha zu verlassen. So suchte Joschi weiter nach einem Ausweg.
Hannah verschlang die Bücher, die Schwester Katharina ihr lieh schneller als das karge Klosteressen. Sie las über Franz von Assisi, der mit den Tieren sprach, wohnte in Onkel Toms Hütte, jagte mit Ahab den weißen Wal und streifte mit Robin Hood durch den Sherwood Forest.
Schwester Katharina entdeckte Hannahs Karikaturen – darunter eine Zeichnung der dicken Nonne Gertrud – und erstickte beinahe an einem Lachanfall. Sie drückte ihr Die letzten Tage von Pompeji von Edward Bulwer-Lytton in die Hand und sagte feierlich: »Die Feder ist mächtiger als das Schwert.«
Über diesen sonderbaren Satz sann Hannah lange nach, ohne ihn wirklich zu begreifen.
Schwester Gertrud begann, ihr das Leben schwer zu machen. Hannah ging ihr aus dem Weg, wo sie konnte, deutlich spürte sie die wachsende Abneigung der Nonne. Gertrud trug ihr die schwersten und unangenehmsten Arbeiten auf, die sie stoisch erduldete und ausführte. Hannah musste die Körperausscheidungen von verwirrten und inkontinenten Pfleglingen beseitigen und stundenlang Toiletten, Böden und Flure putzen. Je schmutziger die Arbeit war, umso mehr Genugtuung schien sie Gertrud zu bereiten. Die Aussicht auf ein neues Buch ließ Hannah die anstrengenden Tage überstehen. Ihr Hunger auf weiteres Lesefutter war kaum zu stillen. Sie begleitete Odysseus auf seiner gefahrvollen Heimfahrt, arbeitete sich verbissen durch die schwierige Sprache Shakespeares und gewann Freunde in Der Wind in den Weiden.
Anfang Mai gab der Winter endlich auf und machte zaghaften Frühlingsboten Platz. Hannah sehnte sich danach, im Gras zu liegen, sich im weiten blauen Himmel zu verlieren und in den dahinjagenden Wolkenformationen nach vertrauten Umrissen und Bildern zu suchen.
Am Morgen des 10. Mai, einem Freitag, klopfte sie an die Tür zur Bibliothek. Als niemand sie aufforderte einzutreten, drückte sie die Klinke nach unten und schlüpfte leise durch den Türspalt. Zu ihrer Bestürzung erblickte sie nicht Schwester Katharina, sondern Getrud, die ächzend einen Stapel Bücher schleppte und auf das Lesepult donnerte.
»Was willst du?«, fragte sie mürrisch.
»Ich möchte ein Buch zurückgeben, das Schwester Katharina mir geliehen hat.« Sie legte eine zerlesene Ausgabe des Nibelungenlieds auf den Tisch. »Soll ich es an seinen Platz stellen?«
»Nein. Ich erledige das.« Getrud wandte sich dem Bücherstapel zu. Achtlos und ohne Katharinas Behutsamkeit stopfte sie die Bücher in Lücken in den Regalen.
»Wo ist Schwester …«
»Sie ist krank. Ich übernehme jetzt die Leitung der Bibliothek.«
Hannah wandte sich um. Es hatte keinen Sinn, die Nonne um ein neues Buch zu bitten, sie würde ihr keins geben. Sie schloss die Tür hinter sich und ging zum ersten Mal seit vielen Wochen ohne neue Lektüre in den Gästetrakt zurück.
Funkelndes Sonnenlicht überflutete den Kreuzgang, der Duft von Kräutern und Heilpflanzen erfüllte die Luft. Auf dem Weg zu ihrer Zelle kam sie an einer Pforte vorbei, die stets verschlossen war. Durch die Fenster der Klostertrakte hatte sie gesehen, dass sich dahinter Felder und Wiesen erstreckten, die sanft zum Horizont anstiegen. Sie blieb stehen. Seit drei Wochen warteten sie auf Neuigkeiten von Joschi. Malisha bemühte sich, ihre Sorge zu verbergen, aber Hannah war klar, dass sie sich nicht ewig bei den Schwestern verstecken konnten.
Der Wind trug das Morgenkonzert der Vögel aus dem nahen Wald herüber. Draußen, jenseits der Klostermauern, musste es jetzt herrlich sein. Hannah blickte sich verstohlen um; sie war allein, keine der Nonnen arbeitete im Garten. Die Pforte lag tief im Schlagschatten des Pultdachs verborgen. Hannah konnte der Versuchung nicht widerstehen und zog den Riegel zurück. Die schmale Tür schwang leise knarrend auf. Das eindringende Licht fiel als helles Rechteck auf den Boden und hob sich lockend vom Halbdunkel des Kreuzgangs ab.
Sollte sie es wagen? Nur eine Stunde, die ihr gehören würde und die sie unter dem weiten, freien Himmel verbringen könnte.
Ihr Herz pochte heftig, als sie durch die Pforte schlüpfte und über die Wiesen auf den Wald zulief. Im Schatten von Kiefern und Buchen, an denen erstes zartes Grün spross, schöpfte sie Atem und lief weiter die bewaldeten Hügel hinauf bis zu einer Lichtung, auf der Hahnenfuß und Klatschmohn blühte. Dort ließ sie sich in das Gras sinken, drehte sich auf den Rücken und wartete, bis sich ihr rasender Herzschlag verlangsamte. Hannah tauchte in den fast wolkenlosen Himmel ein, der sich über ihr wölbte wie eine Kuppel aus blauem Glas. Alles schien von den Füßen auf den Kopf gestellt, so wie die aus den Fugen geratene Welt, in der sie lebte.
Nachdem sie sich sattgesehen hatte, sprang sie auf die Füße, pflückte Maiglöckchen und Margeriten, die sie Malisha mitbringen wollte, und wanderte an den Rand der Wiese. Zu ihren Füßen lag das Kloster, das sie zum ersten Mal von außen sah. Es lag in einer Senke und hatte die Form eines schiefen Quadrats.
Hannah schlenderte weiter zur Kuppe des Hügels. Dörfer, deren Namen sie nicht kannte, lagen winzig wie Spielzeugstädte zwischen den Feldern. Irgendwo im Westen, unsichtbar hinter dem Horizont, lagen Frankreich und Belgien. Wenn nur Joschi endlich mit einer guten Nachricht käme.
Ein leises, weit entferntes Brummen riss sie aus ihren Gedanken. Sie hob den Kopf und blinzelte in die Sonne. Hoch am Himmel zog ein Flugzeug seine Bahn. Wie wunderbar musste es sich anfühlen, von dort oben auf die Welt hinabzublicken. Sie schirmte die Augen mit der Hand ab und ging langsam rückwärts, um das winzige Kreuz nicht aus den Augen zu verlieren, und stieß gegen ein Hindernis.
Erschrocken drehte sie sich um und ließ den Blumenstrauß fallen. Ein Junge mit flachsblondem Haar, ein, zwei Jahre älter als sie selbst, stand vor ihr. Er trug eine kurze Lederhose, ein khakibraunes Hemd und ein schwarzes Halstuch. In einer Scheide an seinem Gürtel steckte ein Fahrtenmesser. Er bückte sich nach den Blumen und reichte sie ihr.
»Du hast was verloren«, sagte er.
Hannah nahm den Strauß an sich. »Da… danke.«
»Ich bin Peter.«
»Hallo.«
»Ich hab dich hier noch nie gesehen.«
Sie antwortete nicht, in ihrem Kopf drehte sich alles. Wenn sie nur ein Wort zu viel von sich preisgäbe, konnte das schreckliche Folgen haben … für sie und Malisha … und für die Mutter Oberin.
Der Junge legte den Kopf in den Nacken. »Das ist ein Aufklärer«, sagte er, »’ne Heinkel He 70. Sieht man an den Flügelenden.«
Hannah war einer Panik nahe und suchte nach einem Fluchtweg. Sie konnte nicht geradewegs durch die Wiesen ins Tal laufen, sonst würde er wissen, dass sie zum Kloster wollte.
Er schien ihre Panik nicht zu bemerken, schwatzte munter drauf los und gab sich wichtig.
»Jetzt geht der Krieg richtig los. Der Führer hat den Westfeldzug gestartet. Ich wette, die Holländer ergeben sich in den nächsten zwei Tagen.«
»West…feldzug?«
Er sah sie an, als hätte sie etwas furchtbar Dummes gesagt. »Das kam über den Rundfunk. Der Führer hat eine Rede gehalten. In höchstens einer Woche stehen unsere Truppen am Atlantik. Dann rollen wir die Franzmänner von Norden her auf. Kluger Schachzug vom Führer übrigens. Alle haben gedacht, er zaudert, dabei hat er nur den richtigen Moment abgepasst. Trotzdem wird der Krieg sich noch ’ne Weile hinziehen. Das hoffe ich wenigstens.«
»Warum?«, fragte sie instinktiv.
»Na, sonst krieg ich ja keine Gelegenheit mehr zu zeigen, dass ich ein guter Soldat bin. Schließlich will ich Deutschland dienen und meine Pflicht erfüllen.«
»Du willst dich erschießen lassen?«, platzte sie heraus.
Er verdrehte die Augen. »Mädchen! Vom Soldatenleben versteht ihr eben nichts. Ich schieße natürlich als Erster. Außerdem kann uns Deutsche sowieso keiner besiegen. Wir sind vom Schicksal dazu bestimmt, über die niederen Rassen zu herrschen. Wir können den Krieg gar nicht verlieren.« Er deutete auf die Blumen. »Was machst du eigentlich hier?«
»Ich … besuche meine Tante«, erwiderte sie schnell. Ausgerechnet an einen Kerl wie Koschka musste sie geraten.
Über der Nase des Jungen bildete sich eine steile Falte.
»Jetzt sind doch gar keine Ferien.«
»Mein Onkel ist gestorben. Ich durfte zur Beerdigung herkommen.« Sie biss sich auf die Lippen, weil sie einen Fehler gemacht hatte. Wenn auf dem Land jemand starb, sprach sich sein Tod schnell herum. Der Junge musste wissen, dass niemand in der Nachbarschaft gestorben war.
»Wo wohnt denn deine Tante?«, fragte er.
Hannah überlegte fieberhaft. Sie kannte nicht eines der Dörfer mit Namen. Wenn sie auf das falsche zeigte, würde er sie sofort bei einer Lüge ertappen. Schließlich streckte sie den Arm aus und deutete auf eine Ortschaft, die in einer Senke zwischen zwei Waldstücken lag.
»Seck«, sagte der Junge. »Ich komme aus Stahlhofen, mein Vater ist dort Bürgermeister.«
Hannah senkte den Blick und starrte auf einen flachen Stein zu ihren Füßen. »Ich muss jetzt los.«
»Man kann gar nicht vorsichtig genug sein, sagt mein Alter immer«, fuhr der Junge fort. »bei uns werden wir mit dem Judenpack schon aufräumen.«
Ein Eichelhäher flog aus dem Gebüsch auf und krächzte. Der Junge hob einen Stein vom Boden, warf ihn nach dem Vogel und verfehlte ihn nur knapp.
»Wie meinst du das?«, fragte Hannah. Die Frage kam wie von selbst über ihre Lippen.
»Ich hab gehört, wie sich mein Vater mit dem Meissner unterhalten hat – der ist bei der SS. Mit zweiundzwanzig ist er schon Untersturmführer. Das schaffe ich auch! Er hat jedenfalls gesagt, dass die Juden bald abgeholt werden.« Er spuckte aus. »Gut so.«
»Was geschieht denn … mit den Juden?«
»So genau weiß das keiner. Der Meissner sagt, sie sollen umgesiedelt werden, damit sie sich nicht mit dem deutschen Volkskörper vermischen. Man muss auf die Reinheit des Blutes achten.«
Er blickte sie misstrauisch an. »Wo kommst du eigentlich her?«
»Aus dem Süddeutschen«, log sie, »von einem Bauernhof in den Bergen. Da kriegen wir nicht so viel mit, was in der Welt passiert.«
Er sah sie zweifelnd an, gab sich aber offenbar mit der Antwort zufrieden.
»Ich muss jetzt gehen«, sagte sie.
Mit jedem Augenblick stieg das Risiko, dass sie sich verplapperte. Sie drehte sich um und ging den Weg zwischen den Wiesen entlang.
»Nach Seck geht’s da lang«, rief der Junge.
Sie spürte, dass ihr das Blut ins Gesicht schoss und zwang sich zu einem Lächeln. »Danke. Ich kenn mich hier nicht aus, war erst einmal hier. Und da war ich noch ganz klein.«
Sie wandte sich in die Richtung, in die er deutete, und lief den gewundenen Weg entlang. Als der Junge außer Sicht war, schlug sie sich in die Büsche und wartete.
Er schien ihr nicht zu folgen. Nach ungefähr einer Viertelstunde wagte sie sich aus ihrem Versteck. Er war nirgends zu sehen. So schnell sie konnte, lief sie durch die Felder auf das Kloster zu, schlüpfte durch die Pforte und stand heftig atmend im Kreuzgang. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie den Blumenstrauß vergessen hatte. Er musste zwischen den Büschen liegen. Wenn der Junge ihn fand, würde er sich fragen, warum sie ihn fortgeworfen hatte.
»Hannah!« Malisha kam quer durch den Kräutergarten auf sie zu. »Jede Nonne im Kloster sucht nach dir. Wo bist du gewesen?«
»Das würde ich ebenfalls gerne wissen.«
Schwester Agnes stand wie aus dem Boden gewachsen vor ihr.
»Ich … habe einen Spaziergang gemacht. Es ist so ein schöner Tag.«
»Wir hatten vereinbart, dass du das Kloster nicht verlässt. Bist du jemandem begegnet?«
Hannah senkte schuldbewusst den Kopf. Eine Lüge kam ihr nur schwer über die Lippen, sie weigerte sich einfach herauszukommen. Ihr war leicht schwindelig, an den Rändern ihres Blickfelds kroch die Finsternis heran. Seit Wochen hatte sie keinen Anfall mehr erlitten. Musste ihr blöder Kopf ausgerechnet jetzt seine Streiche spielen?
»Nein«, sagte sie leise. »Ich bin vorsichtig gewesen. Niemand hat mich gesehen.«
Die Oberin atmete erleichtert aus. »Die Menschen auf dem Land sind sehr neugierig. Wenn sie auf jemanden treffen, der ihnen fremd ist, fragen sie ihm ein Loch in den Bauch. Das kann schnell ins Auge gehen, wenn man auf den Falschen trifft. Es gibt nicht nur in der Stadt Nationalsozialisten. Mach das nie wieder!«
Bei uns im Ort werden wir mit dem Judenpack schon aufräumen. Das waren die Worte des Hitlerjungen gewesen.
»Komm jetzt«, sagte Malisha. »Joschi ist da. Er hat Neuigkeiten.«
»Müssen wir noch lange bleiben?«, wollte Hannah wissen.
»Genau darum geht es«, antwortete Malisha.
»Deutsche Truppen sind im Morgengrauen in Luxemburg, Belgien und den Niederlanden einmarschiert«, sagte die Oberin. »Wir müssen eine andere Fluchtroute für euch finden.«
»Wir hätten nicht so lange warten dürfen«, sagte Malisha.
»Das Risiko war zu groß. Aber ich denke, wir haben einen Weg gefunden«, antwortete Schwester Agnes.
Hannah und Malisha betraten hinter ihr die Eingangshalle des Hauptgebäudes.
»Joschi!«
Hannah lief auf den Riesen zu, der sie hochhob, herumwirbelte und zärtlich an sich drückte.
»Wir sollten uns beeilen«, sagte die Oberin.
Joschi stellte Hannah auf den Boden und nickte. Sie bemerkte einen schmächtigen Mann, der mit ihm gekommen war. Er nestelte an seiner randlosen Brille und trat nervös von einem Bein aufs andere. Sein abgewetzter, taubenblauer Anzug schlotterte um seine dünne Gestalt und war ihm mindestens zwei Nummern zu groß. Er hatte schütteres dunkelblondes Haar und trug einen altmodischen, an den Enden gezwirbelten Schnurrbart. In der linken Hand hielt er einen kleinen braunen Koffer.
Nervös zupfte er Joschi am Ärmel. »Können wir jetzt mit der Arbeit beginnen? Ich muss noch heute Abend nach England zurück.«
»Nach England?«, rief Hannah.
»Wir werden deinen Vater um Hilfe bitten«, erklärte Malisha.
Die Aussicht, ihn endlich kennenzulernen, ließ Hannahs Herz schneller schlagen.
»Hier entlang.«
Die Oberin führte sie in einen Raum im Kellergeschoss. Es gab einen Tisch, zwei Stühle und einen stockfleckigen Sisalteppich. Eine nackte Glühbirne unter der Decke spendete trübes Licht.
Joschi stellte eine große Reisetasche auf den Tisch. Er zog den Reißverschluss auf und begann, ein Stativ aufzubauen. Hannah schaute zu, wie er einen elektrischen Scheinwerfer daran befestigte und das Kabel in eine Steckdose steckte. Grelles Licht flammte auf. Auf einem zweiten Stativ befestigte er eine Kamera und richtete sie auf die weiß getünchte Längswand des Kellers aus.
»Wir brauchen neue Papiere«, erklärte Malisha. »Mister Smith wird sie uns verschaffen.«
Joschi beschrieb in seiner Gebärdensprache, was geschehen würde.
»Natürlich heißt er nicht wirklich Smith«, fuhr Malisha fort. »Aber er besitzt einen Diplomatenpass auf diesen Namen. Wir werden als seine Familie mit ihm reisen. Setz dich jetzt.«
Smith stellte einen Stuhl vor die Wand. Hannah nahm darauf Platz und sah in das Objektiv der Kamera. Joschi korrigierte ihre Haltung, bis er zufrieden war, und drückte auf den Auslöser. Als Nächstes nahm Malisha Platz, die er ebenfalls fotografierte.
»Wie werdet ihr den Film entwickeln?«, fragte Malisha.
»Wir besitzen alles Nötige«, entgegnete die Oberin. »Offiziell nutzen wir die Gerätschaften für das Ablichten alter Dokumente unserer Bibliothek. Wir haben eine Dunkelkammer und einen Vergrößerer, um Abzüge herzustellen. Schwester Katharina wird sich darum kümmern.«
Sie nahm die Kamera mit und kehrte eine Stunde später mit den entwickelten Fotografien zurück.
Der Mann, den Malisha Mister Smith nannte, rieb sich die Hände. »Gut, fangen wir an. Meine Arbeit wird einige Zeit in Anspruch nehmen.«
»Ich will zusehen«, bat Hannah.
»Habe nichts dagegen«, entgegnete Smith. »Wenn du geschickte Hände hast, kannst du mir helfen.«
»Was soll ich tun?«
»Mir Kaffee besorgen. Am besten eine ganze Kanne.«
Die Schwester Oberin entfernte sich mit Malisha. Hannah lief in die Küche und kochte Kaffee. Kurz darauf verfolgte sie neugierig, wie Mister Smith den kleinen Koffer öffnete und merkwürdige Utensilien auf den Tisch legte, darunter ein Federmesser, eine Art Schusterahle, feine Pinsel und eine Pinzette. Das Wichtigste präsentierte er zum Schluss: ein Dutzend amerikanische Pässe.
»Wozu brauchen Sie die elektrische Heizplatte?«, fragte Hannah.
»Alles der Reihe nach.«
»Woher stammen diese Ausweise?«
»Sagen wir, ich habe sie gefunden.«
»Gefunden? Wo denn?«, löcherte sie ihn.
Mister Smith grinste. Es ließ seinen Schnurrbart noch breiter erscheinen. »Du bist ja ganz schön neugierig. Auf einem Dachboden. Mehr brauchst du nicht zu wissen.
Er blätterte die Pässe durch. »Ah, dieser passt am besten. Je weniger ich verändern muss, desto leichter wird die Angelegenheit.«
Hannah beugte sich vor. Der Pass war am 08.01.1933 ausgestellt worden und am 07.01.1938 abgelaufen. Er enthielt das Bild einer jungen Frau, die ihr entfernt ähnelte. Sie hatte das gleiche dunkle Haar und war den Angaben zufolge genauso groß. Ihr Name lautete Susan Smith.
»Smith ist einer der häufigsten Namen in Amerika«, erklärte er, »ich habe gleich vier Pässe mit diesem Namen herausgesucht. Dieser hier passt am besten.«
»Dann heiße ich jetzt Susan Smith?«
»Ja. Der Name muss dir in Fleisch und Blut übergehen. Du bist Susan und hast niemals anders geheißen. Ist das klar?«
Hannah nickte stumm. Fasziniert beobachtete sie, wie er die konische Ahle durch die Öse des Passbilds steckte. Vorsichtig bog er mit dem Federmesser die Dornen auf. Dann legte er ein Stück Pappe auf die Heizplatte, und darauf den Ausweis.
»Er muss gut durchwärmen. Das Papier wird weicher und nimmt die Tinte besser auf. Ich werde einige Einträge ändern müssen.«
Er sprach von seiner Arbeit wie ein Koch, der ein Rezept erklärt, rauchte eine Zigarette und trank tassenweise Kaffee.
»Wenn wir in eine Kontrolle geraten, denk daran, dass ich dein Vater bin«, schärfte er ihr ein, »und deine Mutter ist meine Ehefrau. Wir sind eine Familie, hast du das verstanden?«
Hannah nickte. Smith zählte weitere Einzelheiten auf. Sie lebten in Pittsburgh im Osten der USA und wurden nun nach London versetzt. John Smith war amerikanischer Diplomat mit deutschen Wurzeln.
»Ich nehme an, du sprichst kein Englisch?«
»Ein bisschen. Meine Mutter kann es besser.«
»Gut. Du wirst eine Halsentzündung haben – gefährliche, ansteckende Sache. Du darfst nicht sprechen, kannst nur krächzen. Du bringst kein Wort heraus, bis wir in England sind.«
Smith nahm den Pass von der Heizplatte und begann, mit der Pinzette vorsichtig das Bild abzulösen. Nach und nach trug er mit einem Pinsel eine ätzend riechende Flüssigkeit auf die Rückseite des Fotos, bis er es entfernt hatte.
Smith hatte Pässe ausgesucht, in denen nicht nur die körperlichen Merkmale möglichst mit denen von Hannah und ihrer Mutter übereinstimmten, sondern auch das Alter. Sie prägte sich ihr neues Geburtsdatum ein. Dem Pass zufolge war sie schon sechzehn.
Malisha hieß Marlene Smith, ihr Geburtsname musste noch ergänzt werden. Smith wählte den Namen Jones – wie Smith einer der häufigsten Namen in den Vereinigten Staaten und dadurch am schwierigsten zu überprüfen.
Smith schnitt die neuen Passfotos zurecht, etwas größer als das Originalbild. Er legte hauchdünnes Seidenpapier über das alte Foto und zog mit einem Achatstift die Konturen des Stempels nach, die er dann mittels Stift und Kohlepapier in der passenden Farbe auf Hannahs Bild übertrug. Schließlich fixierte er die Fälschung mit Malerfixativ. Danach brauchte er nur noch das gelochte Bild im Pass zu befestigen. Er bördelte die Metallzähne um die Öse zurück und betrachtete seine Arbeit. Die Konturen des Stempels deckten sich genau mit denen des Passes. Er nickte zufrieden und machte sich an den Pass für Malisha.
»Pässe fälschen erfordert eine ruhige Hand und viel Geduld«, erklärte er, »einen Stempel nachmachen ist dagegen ein Kinderspiel.«
»Wie macht man das?«, fragte Hannah.
Smith lachte. »Da die Deutschen so viele Kartoffeln essen, ist es in diesem schönen Land besonders einfach. Man nimmt eine heiße Kartoffel, die in der Mitte noch recht fest ist, schneide sie in zwei Hälften und drücke sie auf das Dokument, auf dem sich der Stempelabdruck befindet. Dann wartet man eine Viertelstunde und schon hat man einen seitenverkehrten Abdruck. Nun muss man nur die Kartoffel wieder erwärmen und die aufgesaugte Farbe wird wieder feucht. Man drückt die Kartoffel auf das gewünschte Papier, das war’s.«
Hannah prägte sich jeden Arbeitsschritt ein. Wer konnte schon wissen, ob sie nicht irgendwann selbst einen Pass oder vielleicht einen Meldebogen würde fälschen müssen?
Am frühen Abend klappte Smith den zweiten Ausweis zu und reichte ihn Malisha.
»Macht dreihundert Reichsmark. Dafür bringe ich Sie bis nach Calais und von dort mit der Fähre nach England.«
»Das ist mehr als ich Ihnen geben kann.«
»Geben Sie mir hundert«, sagte er grinsend. »Joschi hat den Rest bereits bezahlt.«
Malisha fuhr zu dem Riesen herum. »Das kann ich nicht annehmen. Ich …«
Joschis vernarbtes Gesicht verfinsterte sich. Er machte eine abwehrende Geste.
Smith rieb sich die Hände. »Gut, das hätten wir geklärt. Zur Erinnerung: Wir befinden uns auf der Reise nach London und genießen diplomatische Immunität. Reden Sie möglichst wenig, wenn Sie gefragt werden. Und vermeiden Sie es unter allen Umständen, deutsch zu sprechen.«
Im Hof des Klosters parkte eine schwarze Limousine mit der Aufschrift Packard. Auf den Kotflügeln waren kleine amerikanische Flaggen befestigt. Hannah verabschiedete sich von Joschi, der sie heftig an sich drückte. Die Mutter Oberin wünschte ihnen viel Glück.
Der Wagen rollte vom Hof und tauchte in die Dämmerung ein. Smith saß am Steuer, Malisha auf dem Beifahrersitz und Hannah auf der breiten Rückbank.
»Der deutsche Angriff auf Luxemburg und Belgien verkompliziert die Lage«, erklärte Smith. »Wir fahren die Mosel stromaufwärts nach Trier. Dann halten wir uns südwestwärts und überqueren die Grenze. Wenn wir nicht aufgehalten werden, nehmen wir ab Metz den Zug über Reims nach Calais.«
»Aber Frankreich hat Deutschland schon im vergangenen Jahr den Krieg erklärt«, sagte Malisha. »Ich habe von Truppenbewegungen entlang der Grenze gehört.«
»Noch ist in Frankreich alles ruhig. Aber mit dem heutigen Angriff auf die Niederlande und Belgien wird sich das ändern. Die Franzosen können ihren Drôle de guerre – den seltsamen Krieg – so nicht weiterführen. Wir müssen uns beeilen, bevor die Fahrt nach Calais unmöglich wird.
»Die Grenzübergänge werden doch sicher bewacht.«
»Natürlich. Aber Sie vergessen, wir genießen diplomatische Immunität. Schließlich arbeite ich im Konsulat der Vereinigten Staaten in Frankfurt und werde im Auftrag meiner Regierung nach London beordert.«
»Sie werden uns kontrollieren. Man wird feststellen, dass es dort keinen Mister Smith gibt«, warnte Malisha.
»Machen Sie sich keine Sorgen. Wenn Sie Ihre Rolle gut spielen, winken sie uns schnell durch. Und falls sie nachfragen werden: In Frankfurt gibt es einen Mister Smith, sogar zwei davon. Bis die Deutschen rauskriegen, dass es sich dabei nicht um mich handelt, sind wir längst über alle Berge. Sie werden unsere Geschichte schlucken, ich mache das nicht zum ersten Mal. Halten Sie sich an das, was wir abgesprochen haben, dann kann nichts passieren.« Er runzelte die Stirn. »Was mir mehr Sorgen bereitet, ist der schnelle Vormarsch in Holland und Belgien. Wenn die Wehrmacht weiter in diesem Tempo vorrückt, stehen deutsche Landser in ein paar Tagen vor Dünkirchen. Von dort ist es nur ein Katzensprung nach Calais. Hitler will die Atlantikhäfen unter seine Kontrolle bringen. Diese Fahrt wird die letzte sein, mir wird in Deutschland der Boden unter den Füßen zu heiß. Es wird Zeit für eine Luftveränderung.«
»Hitler wird nicht vor dem Kanal Halt machen«, prophezeite Malisha.
Smith lachte. »Sie meinen, er plant eine Invasion Englands? Das wagt er nicht. Haben Sie nichts davon gehört?«
»Wovon?«
»Chamberlain ist heute zurückgetreten. Churchill ist jetzt Premierminister. Er gilt als harter Hund und erbitterter Gegner Hitlers, der sich auf keine Verhandlungen einlassen wird.«
»Ich hoffe, Sie irren sich nicht«, antwortete Malisha. »Ich traue den Nazis alles zu.«
Ja, dachte Hannah fröstelnd. Ich auch. »Ist mein Vater wirklich Pilot?«, fragte sie.
Malisha drehte sich um. »Ja, das ist er.«
»Ob er sich freut, dass wir kommen?«
»Er weiß es nicht. Ich hoffe, dass er uns wenigstens so lange unterstützt, bis wir auf eigenen Füßen stehen können.«
»Warum können wir nicht bei ihm leben?«
»Das ist … kompliziert. Versuch zu schlafen, die Fahrt dauert lange.«
Hannah machte es sich auf der Rückbank bequem. Bald wich die Dämmerung einer mondlosen, pechschwarzen Nacht. Wenn sie durch eine Ortschaft oder eine größere Stadt fuhren, zogen vor den Wagenfenstern kleine Lichtpunkte vorbei. Links von ihnen glitzerte die Mosel im Schein der Straßenlampen und floss träge dem Rhein entgegen. Hannah schloss die Augen und dachte an den blauen Himmel über den Hügeln oberhalb des Klosters. Sie träumte davon, dass ihr Vater sie in seinem Flugzeug mitnahm, und dass er ihr beibrachte, wie man es steuerte. Sie würden gemeinsam um die Welt fliegen.
Der Packard wurde langsamer, Smith bremste ab und riss Hannah unsanft aus ihren Träumereien. Der Wagen stoppte, das grelle Licht eines Scheinwerfers huschte über die Frontscheibe.
»Malisha, Sie verstehen kein Deutsch und antworten nur auf Englisch. Hannah, stell dich schlafend.«
Sie blinzelte zwischen den Augenlidern hindurch. Ein Mann beugte sich zu Smith herunter und leuchtete mit einer Taschenlampe ins Wageninnere. Er trug eine Wehrmachtsuniform mit den Rangabzeichen eines Oberleutnants. Joschi hatte ihr die Dienstgrade erklärt. Eine Maschinenpistole hing an einem Riemen vor der Brust des Offiziers.
Smith kurbelte das Seitenfenster herunter. »What’s going on?«, fragte er, als würde er Kaugummi kauen.
»Fahrzeugkontrolle. Ihre Ausweispapiere! Papers please!«