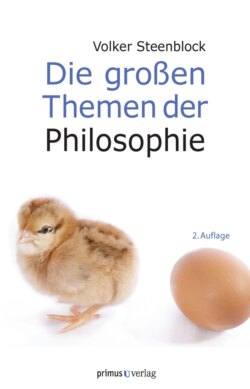Читать книгу Die großen Themen der Philosophie - Volker Steenblock - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 Die Neuzeit: Natur wird zum Objekt
ОглавлениеSeit dem Spätmittelalter, vor allem aber in der Neuzeit verändern sich die naturphilosophischen Vorstellungen in einer zwar sukzessiv erfolgenden und im einzelnen wissenschaftshistorisch umstrittenen, aber dennoch, insgesamt betrachtet, derart grundlegenden Weise, dass man von einer wissenschaftlichen Revolution spricht. Bis heute bestimmt diese Revolution das Verhältnis des Menschen zur Welt und seine Stellung in der Welt in entscheidender Weise.
Zugleich mit der Ausbildung der experimentellen Naturwissenschaft entwickelten sich in der Renaissance zunächst neue naturphilosophische Auffassungen, so bei Agrippa von Nettesheim (Heinrich Cornelius, 1486–1535) oder bei dem Schweizer Arzt Paracelsus (eigentlich Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, 1493–1541) sowie bei Jacob Böhme (1575–1624). Ein besonders interessanter Mann ist in diesem Zusammenhang der Provence-Pestarzt, Astrologe und Untergangsprophet Michel de Notredame (1503–1566) oder latinisiert Nostradamus. Vom verkrachten Medizinstudenten der Universität Montpellier zu einer von Frankreichs Königshaus umworbenen Berühmtheit aufgestiegen, zugleich aber in steter Angst vor Inquisition und Hexenwahn lebend, ist Nostradamus Repräsentant jener geheimnisvollen Welt, die den Übergang begleitet zwischen dem aristotelischen und mittelalterlichen naturphilosophischen Denken und den Naturwissenschaften, wie sie sich mit der Neuzeit entwickeln. Ohne deren bis heute vielfach bestätigtes Instrumentarium eröffnet sich ein phantastisches Feld von Erwartungen an neue Möglichkeiten des Forschens, deren Potentiale man ahnt, ohne schon die exakten Mittel eines Galilei in der Hand zu haben oder um deren dann so ganz andere Ergebnisse und ihr so ganz anders geartetes Weltbild zu wissen. Nostradamus’ geheimnisvolle Prophezeiungen sind zugleich bis heute ein Medium der Zukunftsängste und Zukunftssehnsüchte vieler Menschen geblieben, wie sie die Faszination durch die Astrologie antreiben. Der Glaube, durch göttlich inspiriertes oder aus der Sternendeutung gewonnenes Wissen die Zukunft erschauen zu können, stellt in eben dem Maße die Endlichkeit menschlicher Arbeit am Wissen vor Augen, wie sie sie zugleich sozusagen „kurzzuschließen“ wünscht, um jenseits aller irdischen Erkenntnis höchster Wahrheit teilhaftig zu werden.
Der eigentlich weltgestaltende Weg des Umgangs mit der Natur ging dann so: Bereits die Skizzen des Malers Leonardo da Vinci (1452–1519) zeigen eine Vielzahl oft noch phantastischer, aber prophetisch anmutender Möglichkeiten (Hubschrauber, Kriegsmaschinen usw.). Eine programmatische Umkehr traditioneller Auffassungen von der richtigen Art und Weise, die Natur zu erkunden, betreiben vor allem zwei wichtige Philosophen: Francis Bacon (1561–1626) schreibt sein „Neues Organon der Wissenschaft“ – eine Kampfschrift gegen den bisherigen Wissenschaftsbetrieb und ein Plädoyer für eine verbesserte Wissenschaftsorganisation, für Empirie [konsequente Erfahrungsorientierung] und Experiment. Und René Descartes (1596–1650) verfasst circa 17 Jahre später weithin im Stile einer intellektuellen Autobiographie die Schrift „Von der Methode“, in der er wie Bacon einen neuen „Königsweg“ nützlicher Wissenschaft anvisiert, ganz anders als dieser aber sich allen Fortschritt vom Denken selbst, aus dessen Methodisierung nach dem Vorbild der Mathematik erwartet (siehe auch Textteil Zum Weiterdenken im Kapitel 6: Wissenschaft und Technik).
Empirie und Mathematik: beides wird in besonderer, außerordentlich erfolgreicher Weise zusammenkommen. Inbegriff dieser neuzeitlichen Revolution wissenschaftlicher Welterfassung ist die Gestalt Galileo Galileis (1564–1642) durch seine Nutzung von Fernrohr und Experiment, durch seine Erforschung des Falles der Körper, sein Eintreten für das Kopernikanische Weltbild und seine legendenumbildete Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche geworden. Die großen Astronomen Kopernikus (1473–1543) und Kepler (1571–1630), der mit Galilei in Briefkontakt stand, mussten zuerst das geozentrische Weltbild und dann auch noch die seit Platon mit hoher spekulativer Bedeutung besetzte und als göttlich angesehene Kreisform der Planetenumläufe preisgeben. Indem Isaac Newton (1643–1727) seine die Galileischen Fallgesetze wie die Keplerschen Gesetze des Planetenumlaufs verbindende Gravitationstheorie formuliert, gibt er dem neuen Weltbild eine bis ins 20. Jahrhundert gültige Grundlage; mit der Brechung des Lichts im Prisma beginnt der Siegeszug der Anwendung der neuen experimentellen Befragung der Natur auf praktisch alle Gebiete ihrer erfahrungswissenschaftlichen Erforschung. Newtons Name wurde synonym mit der heute so genannten „klassischen Physik“. In der deterministischen Version des Franzosen Pierre-Simon de Laplace (1749–1824) wurde der Newtonianismus zur umfassenden Welterklärungstheorie. Die Welt erwies sich im 19. Jahrhundert mehr und mehr als eine gigantische Maschine, deren Funktionsweise mathematisch formulierbar war.
Ein Prozess der „Entzauberung“ des Wissens erfasst den alsbald als Uhrwerk oder Weltmaschine angesehenen Kosmos ebenso wie die Physiologie der Lebensvorgänge. Die Lokalisierungen des „Paradieses“ am Himmel und einer „Hölle“ tief unten in der Erde, wie sie das mittelalterliche Weltbild bestimmt hatten, werden zu bloßen Metaphern; die Erde, einst Mittelpunkt und Grund des ganzen Alls, wird zu einem bloßen Gesteinsbrocken, der relativ um so kleiner wird, je mehr sich das Bild des Universums erweitert. Es kommt zur fortschreitend mechanischen Auffassungsweise immer weiterer Bereiche des Stofflichen und des Lebendigen.
Experiment und Technik liefern auch die Grundlagen für die im 18. Jahrhundert beginnende und seither in Wellen, unsere Lebensverhältnisse bestimmend, über uns hinwegrollende „Industrielle Revolution“. Unlösbar ist die neuzeitliche Naturerkenntnis mit der Technik verknüpft: Seit Galilei hätte sie nicht einmal den Zugriff auf ihren Gegenstand ohne technisches Handeln. Denn während das antike Erkennen den Wurf oder Fall eines Steines, wie er in der Natur oder in Lebenszusammenhängen vorkommt, so hatten wir ja gesehen, „nachvollzieht“, so stellt Galilei auf seiner schiefen Ebene im Experiment die Bewegung der Kugel für seine Erkenntniszwecke allererst her. Das Naturphänomen wird nicht mehr als etwas Unangreifbares respektiert, sondern bestimmten Bedingungen unterworfen und zerlegt; die gewonnenen Einsichten werden mathematisch formuliert. Die Natur wird, so hat Kant in der Vorrede zur zweiten Auflage seiner „Kritik der reinen Vernunft“ (zustimmend) formuliert, „genötigt“ (B XIII), auf die Fragen der Forscher zu antworten.