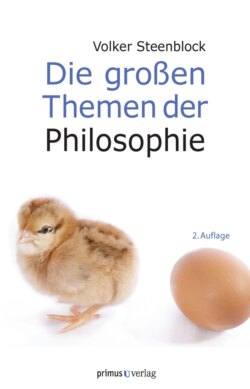Читать книгу Die großen Themen der Philosophie - Volker Steenblock - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.1 Auf der Suche nach dem höheren Sinn – Aufstieg und Herrschaft der Metaphysik
ОглавлениеEs gibt keinen verbindlichen Kanon von Inhalten für die Metaphysik – so wenig wie eine exakte Definition. Um aber einen vorläufigen Begriff von ihrer Sache zu vermitteln, kann man für die „klassische“, „alteuropäische“ Metaphysik seit der griechischen Antike doch in etwa Folgendes festhalten: Während einige Philosophen wie Demokrit und Epikur die Welt für eine zufällige Atomkomposition erklärten und die Seele für etwas hielten, das sich in gleich zufälliger Weise, wie es sich zusammengesetzt hat, auch wieder auflösen kann, und während diese Philosophen auch die Götter in eine folgenlose jenseitige Existenz hinweg komplimentierten, so ging es einer idealistischen Metaphysik in ihren Hauptlinien doch immer darum, die objektive Weltordnung im ganzen auf eine letzte, über das bloß Materielle und Vergängliche hinausweisende Sinnebene zu verweisen, die häufig mit den Vorstellungen einer unsterblichen Seele und eines göttlichen Urgrundes verbunden wurde. Die verwirrende Wechselhaftigkeit der irdischen und menschlichen Welt – muss sie nicht mit allem Recht den Eindruck nahe legen, all dies sei nur ein gewaltiges sinnloses Getöse, ein oft genug groteskes Schauspiel, vorgetragen auf der Bühne einer stummen, zufälligen und verständnislosen Natur? Muss nicht ein ambitioniertes Denken durch die Erscheinungswelt hindurch nach einem letzten Grund suchen, von dem her sich das scheinbar Chaotische aufhebt?
Von besonderer Bedeutung für diese Fragen der nachmalig so genannten „Metaphysik“ und für die spezifische Art und Weise, in der sie sich ausprägte, ist Platon, der ihren Gegenstand bestimmt hat als das eigentliche Wissen („episteme“) gegenüber dem bloßen Meinen („doxa“) von einem Bleibenden, Idealen und Normativen in der Welt des Wechsels, unserer alltäglichen Welt. Im berühmten „Höhlengleichnis“ (als erster Text im Anschluss Zum Weiterdenken abgedruckt) hat dieses Konzept einen sinnfälligen Ausdruck gefunden. Den Status der wahren Welt des Seins beschreibt die im Zentrum der platonischen Philosophie stehende „Ideenlehre“. Die „Ideen“ sind nicht bloße Vorstellungen, sondern sie haben in der Art eines „idealen Seins“, als Ur- und Vorbilder aller Dinge in der Welt einen ontologischen Status von höchster Bedeutung. Die höchste Idee, zugleich Ermöglichungsgrund der Ideen insgesamt, ist die Idee des Guten. Denn wie, fragt Platon, sollte jemand, der von der Idee des Guten als der höchsten Idee nichts weiß, die anderen richtig kennen können?
Im Denkhorizont der Metaphysik befindet sich in der Antike neben der Ideenlehre Platons auch die „erste Wissenschaft“ des Aristoteles. Im Denkhorizont der Metaphysik befindet sich im Weiteren ebenso das theoretische Rüstzeug, in das das Mittelalter die Rede von Gott kleidet. Die Metaphysik fällt hier weitgehend mit der Theologie zusammen. Die platonischen Ideen werden zu „Gedanken Gottes“. Wenn die „Summe der Theologie“ des Thomas von Aquin (1225–1274) die Existenz Gottes nachzuweisen sucht, geschieht dies in einer dem Aristoteles verpflichteten Weise (Textauszug Zum Weiterdenken im Anhang).
Die Fragen, Grundthemen und -motive der Metaphysik haben sich dann in der abendländischen Geistesgeschichte, z.B. in der sogenannten „Schulphilosophie“ des 18. Jahrhunderts, weiter ausgeprägt. Man unterscheidet vor allem die „allgemeine Metaphysik“ („metaphysica generalis“) von der „speziellen“ („metaphysica specialis“). Erstere, die auch unter dem Begriff „Ontologie“ firmiert, fragt nach dem Seienden, insofern es „ist“, nach dem „Sein des Seienden“. Ontologie ist also in einem bestimmten Sinne die Metaphysik des Seins. Die spezielle Metaphysik gliedert sich in rationale Theologie (die Gott als Ursache der Welt benennt), rationale Psychologie (die über Seele und Unsterblichkeit handelt) und rationale Kosmologie (Thema: die Welt). Die Neuzeit ist in der Geschichte der Metaphysik einerseits die Zeit der sogenannten „Barocksysteme“ des Descartes, Spinozas (1632–1677), von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) und Christian Wolff. Zugleich bekommt die Metaphysik nun aber eine nach der Möglichkeit der Erkenntnis des Wirklichen, wie es bis dato behauptet worden war, fragende Richtung. Dies geschieht zunächst bei René Descartes (1595–1650), der erstmals vom erkennenden Subjekt ausgeht, d.h. nicht mehr nur den Theoretiker als Korrespondenten einer vorgegebenen Wahrheit ansieht, sondern im „cogito ergo sum“ („Ich denke, also bin ich“; soll heißen: indem ich denke, erfahre ich mich als einen, der an seiner Existenz nicht zweifeln kann) den „Referenzort“ für „Wirklichkeit“ zugleich in das denkende Ich hinein verlegt (auch wenn im Zuge seiner weiteren Argumentation Gott für Descartes weiterhin eine große Rolle spielt und er damit grundsätzlich auch in die Geschichte der Metaphysik eingeordnet werden kann). Die Metaphysik zu stürzen, unternahm der Aufklärungsphilosoph Kant.