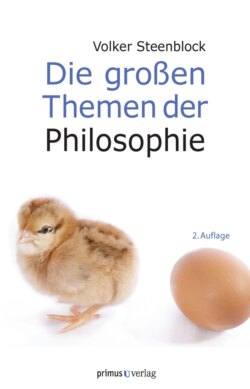Читать книгу Die großen Themen der Philosophie - Volker Steenblock - Страница 43
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kritik der reinen Vernunft (Vorrede; Transzendentale Dialektik)
ОглавлениеDie menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse: dass sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft.
In diese Verlegenheit gerät sie ohne ihre Schuld. Sie fängt von Grundsätzen an, deren Gebrauch im Laufe der Erfahrung unvermeidlich und zugleich durch diese hinreichend bewährt ist. Mit diesen steigt sie (wie es auch ihre Natur mit sich bringt) immer höher, zu entfernteren Bedingungen. Da sie aber gewahr wird, dass auf diese Art ihr Geschäft jederzeit unvollendet bleiben müsse, weil die Fragen niemals aufhören, so sieht sie sich genötigt, zu Grundsätzen ihre Zuflucht zu nehmen, die allen möglichen Erfahrungsgebrauch überschreiten und gleichwohl so unverdächtig scheinen, dass auch die gemeine Menschenvernunft damit im Einverständnisse steht. Dadurch aber stürzt sie sich in Dunkelheit und Widersprüche, aus welchen sie zwar abnehmen kann, dass irgendwo verborgene Irrtümer zum Grunde liegen müssen, die sie aber nicht entdecken kann, weil die Grundsätze, deren sie sich bedient, da sie über die Grenze aller Erfahrung hinausgehen, keinen Probierstein der Erfahrung mehr anerkennen. Der Kampfplatz dieser endlosen Streitigkeiten heißt nun Metaphysik. Es war eine Zeit, in welcher sie die Königin aller Wissenschaft genannt wurde und, wenn man den Willen für die Tat nimmt, so verdiente sie, wegen der vorzüglichen Wichtigkeit ihres Gegenstandes, allerdings diesen Ehrennamen. Jetzt bringt es der Modeton des Zeitalters so mit sich, ihr alle Verachtung zu beweisen […]
Indessen ist diese Gleichgültigkeit […] doch ein Phänomen, das Aufmerksamkeit und Nachsinnen verdient. Sie ist offenbar die Wirkung nicht des Leichtsinns, sondern der gereiften Urteilskraft des Zeitalters, welches sich nicht länger durch Scheinwissen hinhalten lässt und eine Aufforderung an die Vernunft, das beschwerlichste aller ihrer Geschäfte, nämlich das der Selbsterkenntnis aufs Neue zu übernehmen und einen Gerichtshof einzusetzen, der sie bei ihren gerechten Ansprüchen sichere, dagegen aber alle grundlosen Anmaßungen, nicht durch Machtsprüche, sondern nach ihren ewigen und unwandelbaren Gesetzen, abfertigen könne, und dieser ist kein anderer als die Kritik der reinen Vernunft selbst.
Ich verstehe aber hierunter nicht eine Kritik der Bücher und Systeme, sondern die des Vernunftvermögens überhaupt, in Ansehung aller Erkenntnisse, zu denen sie unabhängig von aller Erfahrung, streben mag, mithin die Entscheidung der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Metaphysik überhaupt. […]
Ich kann also Gott, Freiheit und Unsterblichkeit zum Behuf des notwendigen praktischen Gebrauchs meiner Vernunft nicht einmal annehmen, wenn ich nicht der spekulativen Vernunft zugleich ihre Anmaßung überschwänglicher Einsichten benehme, weil sie sich, um zu diesen zu gelangen, solcher Grundsätze bedienen muss, die, indem sie in der Tat bloß auf Gegenstände möglicher Erfahrung reichen, wenn sie gleichwohl auf das angewandt werden, was nicht ein Gegenstand der Erfahrung sein kann, wirklich dieses jederzeit in Erscheinung verwandeln, und so alle praktische Erweiterung der reinen Vernunft für unmöglich erklären. Ich muss also das Wissen aufheben, um für den Glauben Platz zu bekommen. […]
Eben daher sind wir auch berechtigt, die Weltursache in der Idee nicht allein nach einem subtileren Anthropomorphism (ohne welchen sich gar nichts von ihm denken lassen würde), nämlich als ein Wesen, das Verstand, Wohlgefallen und Missfallen, imgleichen eine demselben gemäße Begierde und Willen hat etc., zu denken, sondern demselben unendliche Vollkommenheit beizulegen, die also diejenige weit übersteigt, dazu wir durch empirische Erkenntnis der Weltordnung berechtigt sein können. Denn das regulative Gesetz der systematischen Einheit will, dass wir die Natur so studieren sollen, als ob allenthalben ins Unendliche systematische und zweckmäßige Einheit, bei der größtmöglichen Mannigfaltigkeit, angetroffen würde. Denn, wiewohl wir nur wenig von dieser Weltvollkommenheit ausspähen, oder erreichen werden, so gehört es doch zur Gesetzgebung unserer Vernunft, sie allerwärts zu suchen und zu vermuten, und es muss uns jederzeit vorteilhaft sein, niemals aber kann es nachteilig werden, nach diesem Prinzip die Naturbetrachtung anzustellen. Es ist aber, unter dieser Vorstellung, der zum Grunde gelegten Idee eines höchsten Urhebers, auch klar: dass ich nicht das Dasein und die Kenntnis eines solchen Wesens, sondern nur die Idee desselben zum Grunde lege, und also eigentlich nichts von diesem Wesen, sondern bloß von der Idee desselben, d. i. von der Natur der Dinge der Welt, nach einer solchen Idee, ableite. Auch scheint ein gewisses, obzwar unentwickeltes Bewusstsein, des echten Gebrauchs diesen unseres Vernunftbegriffs, die bescheidene und billige Sprache der Philosophen aller Zeiten veranlasst zu haben, da sie von der Weisheit und Vorsorge der Natur, und der göttlichen Weisheit, als gleichbedeutenden Ausdrücken reden, ja den ersteren Ausdruck, so lange es um bloß spekulative Vernunft zu tun ist, vorziehen, weil er die Anmaßung einer größeren Behauptung, als die ist, wozu wir befugt sind, zurück hält, und zugleich die Vernunft auf ihr eigentümliches Feld, die Natur, zurück weiset.
Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft A VII–VIII; A XI–XII, B XXIXf., B 729. Kants Gesammelte Schriften hrsg. Von der Kgl. Preuß. Akad. der Wissenschaften Bd. IV, Berlin, Verlag von Georg Reimer 1911, 7f., S. 8f.; Bd. III, S. 19f., 459f.