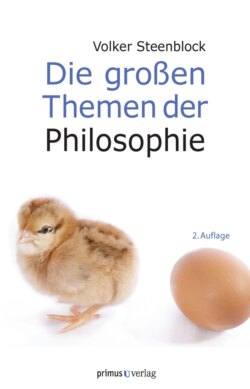Читать книгу Die großen Themen der Philosophie - Volker Steenblock - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2 Der Sturz der Königin: Die Bestreitung der Metaphysik
ОглавлениеBei Immanuel Kant vollzieht sich endgültig ein fundamentaler und epochemachender Bruch: die Metaphysik wird erkenntnistheoretisch-kritisch untersucht und am Ende im bis dato angestrebten Sinn für unmöglich erklärt. Was von ihr bleibt, wird von theoretischen Erkenntnisansprüchen fort und auf praktische Orientierungserfordernisse hin umgelenkt. Die Welt wird damit nicht sinnlos, sie wird zuvörderst zu einer moralischen Verpflichtung und zu einer Aufgabe. „Die menschliche Vernunft“, so schrieb Kant in der Vorrede zur ersten Auflage seiner „Kritik der reinen Vernunft“ (1781; die zweite Auflage kam 1787 heraus), hat zwar „das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse: dass sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft“. Da aber diese – wiewohl uns als Menschen ureigenen – metaphysischen Fragen „allen möglichen Erfahrungsgebrauch überschreiten“, stürzen sie die Vernunft „in Dunkelheit und Widersprüche“ – „Der Kampfplatz dieser endlosen Streitigkeiten heißt nun Metaphysik.“ So weit ist es mit der einstmaligen Königin aller Wissenschaft also gekommen: Von unabweisbaren Fragen verführt, ist die Metaphysik nach Kant der gescheiterte Versuch der Vernunft, über das letztbestimmende Sein, über Gott, Seele und Welt definitive theoretische Aussagen zu machen. Insbesondere kann man die Existenz Gottes nicht beweisen. Aus diesem Scheitern folgert Kant dann als Programm seiner Philosophie die Untersuchung des Erkenntnisvermögens überhaupt, eine kritische Selbstanalyse der Vernunft. In ihr wird dann die Entscheidung über Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Metaphysik fallen. Als Wissenschaft und „sicherer Gang der Erkenntnis“ kann an der Metaphysik mit anderen Worten gerade soviel gelten, wie Kritik ihrer selbst ist; diese Funktion übernimmt die Transzendentalphilosophie Kants, die nach der Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis fragt. Die Erkenntnisgegenstände der einstigen Königin verlieren ihre Denkbarkeit als theoretische Wahrheiten analog zu Erfahrungstatsachen und gewinnen den Status regulativer Ideen: „Ich kann also Gott, Freiheit und Unsterblichkeit zum Behuf des notwendigen praktischen Gebrauchs meiner Vernunft nicht einmal annehmen, wenn ich nicht der spekulativen Vernunft zugleich ihre Anmaßung überschwänglicher Einsichten benehme […] Ich musste also das Wissen aufheben, um für den Glauben Platz zu bekommen“ – so heißt es im nachstehend Zum Weiterdenken empfohlenen Textauszug.
Kann man die Metaphysik nun noch bewahren? Hegel gebraucht für seine Philosophie den Terminus „Metaphysik“ zwar kaum. Er erhebt aber metaphysische Ansprüche, die noch einmal Kants Begrenzung aufzuheben suchen. Von den traditionellen Metaphysiken vor ihm unterscheidet sich Hegel aber auch, und zwar vor allem durch eine gewisse „Dynamisierung“ ihrer Grundannahmen. Hatten Erstere in Gegensätzen wie denen zwischen Mensch und Gott, Endlichem und Unendlichem, vergänglicher und ewiger Welt usw. gedacht, so will Hegel mit Hilfe der „modernen“ Figur von Entzweiung und Versöhnung die christliche Lehre von Schöpfung und Erlösung philosophisch so reformulieren, dass der ursprüngliche absolute Geist (Gott in seiner Ewigkeit, vor Erschaffung der Welt) sein ewiges Leben entfaltet, das eine Entwicklung und zugleich Zurückführung dieser Entwicklung in sich selbst ist.
Während Hegel also noch einmal ein grandioses System aller Wirklichkeitsdeutung erbaute, das auch die Einzelwissenschaften zu umfassen suchte, so ging nach seinem Tod der rapide Verfall der Metaphysik ungebremst weiter. „Der einzige wirkliche Fortschritt der Metaphysik seit Hegels Zeiten“, so mag heute ein Kritiker denken, „war ihr Untergang“. Denn durch die Entwicklung der empirischen Fachwissenschaften wird die Problematik eines Denkens immer schärfer herausgearbeitet, das umfassendste Wirklichkeitsaussagen machen will und dabei nicht auf gegebene Sinnesdaten rekurriert. Die Metaphysik, der es nicht mehr, wie noch bei Aristoteles und im Mittelalter, gelingt, sich zu den Untersuchungen der Einzelwissenschaften in ein konsistent scheinendes Verhältnis zu setzen, wird nun zunehmend als bloße „Begriffsdichtung“ und als im Sinne der neuen Auffassung unwissenschaftlich angegriffen. Vor allem seit Galilei setzen sich die Naturwissenschaften von der Unterordnung unter das Dach der mittelalterlichen theologischen Metaphysik ab; bis ins 20. Jahrhundert reicht die Kette der Metaphysikkritik unter dem Banner der mathematischen und empirischen Wissenschaft.
Symptomatisch hierfür sind die Worte des schottischen Philosophen David Hume (1711–1776): „Sehen wir […] die Bibliotheken durch, welche Verwüstungen müssen wir da nicht anrichten? Greifen wir irgendeinen Band heraus, etwa über Gotteslehre oder Schulmetaphysik, so sollten wir fragen: Enthält er irgendeinen abstrakten Gedankengang über Größe und Zahl? Nein. Enthält er irgendeinen auf Erfahrung gestützten Gedankengang über Tatsachen und Dasein? Nein. Nun, so werft ihn ins Feuer, denn er kann nichts als Blendwerk und Täuschung enthalten.“1
Im 20. Jahrhundert ist die Kritik an der Metaphysik als einem reinen Begriffsdenken auf einen sehr polemischen Punkt gebracht worden: Sie ist für den deutsch-amerikanischen Wissenschaftstheoretiker Rudolf Carnap (1891–1970) die unstatthafte Theoretisierung eines bloßen Lebensgefühls, dessen angemessene Ausdrucksform eher die Kunst, z.B. die Musik wäre: Metaphysiker sind für ihn darum Musiker ohne musikalische Fähigkeit, die stattdessen theoretisieren, und damit weder für das Lebensgefühl noch für die Theorie einen Gewinn erbringen.2 Die Begriffe und Sätze der Metaphysik sind ohne Sinn. Der Stein, den die Naturwissenschaften auf das Grab der Metaphysik legen, trägt die Inschrift: „Keine Aussagen über eine letzte Bedingtheit der Wirklichkeit, die sich methodisiertem Erfahrungsbezug vorgängig dünken“.
Sodann bilden auch die Geisteswissenschaften ihre eigenen, anti-metaphysischen und ebenfalls empirischen (philologischen und hermeneutischen) Methoden aus. Auch sie antworten dem „Zusammenbruch“ der Hegel’schen Metaphysik und seines grandiosen Konzeptes, das noch einmal alle Wirklichkeit – der Natur wie des Geistes – unter die Kategorie eines hypostasierten „Geist“begriffes zu fassen versucht hatte. Wie die Theoretiker der Naturwissenschaften der Erfahrung der Natur, so wenden sich auch die der Geisteswissenschaften, z.B. Wilhelm Dilthey (1833–1911), der konkret erfahrbaren Seite der geistigen Welt zu und von der Metaphysik fort. Der geisteswissenschaftliche Historismus dieser Zeit, das Denken in geschichtlichen Kategorien, besteht darauf, dass jedes „dualistische“ Ansinnen, ein Absolutes in unserer Welt wirkungsmächtig einzuklagen, unweigerlich als seinerseits historisch entstehendes und damit den Bedingungen der Historizität unterworfenes Handeln zu erweisen ist und damit am Widerspruch zwischen seiner angeblichen übergeschichtlichen Universalgeltung und seiner faktischen Überholbarkeit scheitert. Dilthey hatte etwa den Begriff der Metaphysik unter anderem von der Denkfigur eines solchen „Dualismus“ aus kritisch anvisiert: Der Schwerpunkt der, wie er sich ausdrückt, „großen geschichtlichen Masse von Metaphysik“ liege jenen „gewaltigen Spekulationen“ nahe, „welche nicht nur die Erfahrung überschreiten, sondern ein von allem Sinnfälligen unterschiedenes Reich von geistigen Wesenheiten annehmen. Diese Spekulationen blicken also in ein hinter der Sinnenwelt Verborgenes, Wesenhaftes: eine zweite Welt.“ Vollends aber für den Italiener Benedetto Croce (1866–1952) wird die Etablierung einer solchen zweiten Welt zu einem Kardinalfehler. Der Gegner des Historismus, der diesem Denkfehler unterliegt, ist „die Philosophie oder richtiger gesagt die traditionelle Vorstellung von der Philosophie, die ihren Blick himmelwärts richtet und vom Himmel die höchste Wahrheit empfängt und erwartet. Diese Trennung von Himmel und Erde, diese dualistische Auffassung von einer Wirklichkeit jenseits der Wirklichkeit, von einer Metaphysik jenseits der Physik, von einer Schau des Begriffs jenseits des Urteils und ohne das Urteil – das ist es, was dieser Philosophie ihren eigenartigen Charakter verleiht, der immer der gleiche bleibt, wie man die transzendente Wirklichkeit nennen mag, Gott oder Materie, Idee oder Wille – jedesmal wird angenommen, dass unterhalb ihrer oder ihr gegenüber eine niedrigere oder rein phänomenale Wirklichkeit bestehe.“3 Der Stein, den die Geisteswissenschaften auf das Grab der Metaphysik legen, trägt die Inschrift: „Keine Aussagen über eine überhistorische letzte Totalität aller Wirklichkeit, die sich der Einsicht in die Gewordenheit, Überholbarkeit und Endlichkeit allen menschlichen Wissens vorgängig dünken“.