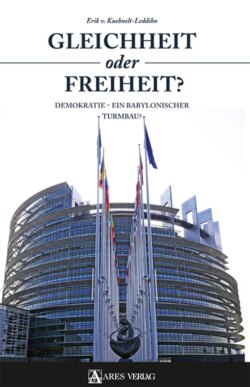Читать книгу Gleichheit oder Freiheit? - Von Kuehnelt-Leddihn Erik - Страница 11
3.Demokratie und Unfreiheit
ОглавлениеDas unvermeidliche Resultat dieser nivellierenden Grundrichtungen und Eingriffe ist eine steigende antiliberale Haltung – eine Einstellung, die auch ursächlich mitgewirkt hat. Schon früher in der Geschichte hören wir Klagen über die Gleichgültigkeit der Freiheit gegenüber, und diese Klagen sind oft nicht einmal politischer, sondern philosophischer oder theologischer Natur. Dante, zum Beispiel, hat uns daran erinnert, daß die Willensfreiheit (libertas arbitrii, um genauer zu sein) nicht immer ernst genommen wurde58. Gerard Winstanley, ein religiös-politischer Führer im englischen Bürgerkrieg, schrieb im Jahre 1649, daß er vom leeren Geschwätz über die Freiheit angewidert sei. Er wollte Taten sehen59.
Doch gerade die englischen freireligiösen, politisch linkseingestellten Gruppen dachten an eine Synthese demokratischer und liberaler Grundsätze und ahnten nichts von dem inneren Gegensatz dieser zwei Begriffswelten. Ein Denker wie Donoso Cortés hingegen hatte keine Illusionen über die harte Alternative zwischen der Gleichheit, die erzwungen werden muß, und der Freiheit, die dem Zwang abhold ist60. Auch John C. Calhoun, der intellektuelle und politische Führer der amerikanischen Südstaaten im zweiten Viertel des vorigen Jahrhunderts, wußte von dieser Schwierigkeit. Er schrieb:
»There is another error, not less great and dangerous, usually associated with the one which has just been considered. I refer to the opinion, that liberty and equality are so intimately united, that liberty cannot be perfect without perfect equality.«61
Moderne Autoren gehen viel weiter als diese vorsichtigen Worte Calhouns62; auch die Zahl derer, die zwischen Demokratie und Liberalismus scharf unterscheiden, ist nicht unbedeutend63. Und obzwar manchmal ein Übermaß an Freiheit in antinomistischer Reaktion eine bewußte Tendenz zur Knechtschaft aufkommen ließ, so wird es wenig denkende und kritische Beobachter geben, die unsere moderne, so oft sich demokratisch nennende Tyrannis nicht von den demokratischen (plebiszitären, majoritären, egalitären) Grundsätzen ableiten. Hingegen hat die moderne Tyrannis es nie gewagt, sich mit den Federn des Liberalismus zu schmücken64. Ja, die Entwicklung, wie wir sie in unseren Tagen gesehen haben, hätte Orestes Brownson, den originellen amerikanischen Konvertiten und Pamphletisten, nicht sonderlich überrascht. Dieser schrieb schon vor hundert Jahren:
»We are republicans, because republicanism is here the established order, but we confess that we do not embrace and never have embraced, as essential to liberty, the popular democratic doctrine of this country.«65
Freimütiger, aber auch pessimistischer war Macaulay, der einem amerikanischen Freund im Jahre 1857 schrieb:
»I have long been convinced that institutions purely democratic must, sooner or later, destroy liberty, or civilization, or both. In Europe, where the population is dense, the effect of such institutions would be almost instantaneous…
…You may think that your country enjoys an exemption from these evils. I will frankly own to you that I am of a very different opinion. Your fate, I believe, is certain, though it is deferred by a physical cause.«66
Hier wie auch bei anderen Autoren, die richtig die Entwicklung vorausgesehen hatten, liegt dennoch ein Irrtum im Zeitelement vor. Das Unheil kam, aber es kam langsamer. Bezeichnend ist es immerhin, daß der Brief Macaulays an den Jefferson-Verehrer Henry S. Randall zur Zeit von Roosevelts New Deal, als die ersten Symptome eines Populärtotalitarismus auftauchten, häufig abgedruckt und als Flugschrift verbreitet wurde. Die »physischen Gründe« sind offenkundlich die sich stets verringernden, inneren Expansionsmöglichkeiten. Amerika hörte auf, territorial »unbegrenzt« zu sein.
Auch Lord Acton, der große liberale katholische Denker Englands, wußte vom Gegensatz zwischen der Freiheit und der Gleichheit. Er schrieb:
»The deepest cause which made the French Revolution so disastrous to liberty was its theory of equality. Liberty was the watchword of the middle class, equality of the lower.«67
Noch stärker und deutlicher war er in seiner Besprechung von Sir Erskine Mays Democracy in Europe:
»The effective distinction between democracy and liberty, which has occupied much of the author’s thoughts, cannot be too strongly drawn. Slavery has been so often associated with democracy, that a very able writer pronounced it long ago essential to a democratic state; and the philosophers of the Southern Confederation have urged the theory with extreme favour. For slavery operates like a restricted franchise, attaches power to property and hinders socialism, the infirmity that attends mature democracies.«68
Auch William E. H. Leckys Anschauungen mußten vielen seiner Zeitgenossen und der ihm unmittelbar folgenden Generation als übertrieben, reaktionär oder »übereilt« erscheinen. Er sagte in seinem Buch Democracy and Liberty:
»A tendency to democracy does not mean a tendency to parliamentary government, or even a tendency towards greater liberty. On the contrary, strong arguments may be adduced, both from history and from the nature of things, to show that democracy may often prove the direct opposite of liberty. In ancient Rome the old aristocratic republic was gradually transformed into a democracy, and it then passed speedily into an imperial despotism. In France a corresponding change has more than once taken place. A despotism resting on a plebiscite is quite as natural a form of democracy as a republic, and some of the strongest democratic tendencies are distinctly adverse to liberty. Equality is the idol of democracy, but, with the infinitely various capacities and energies of man, this can only be attained by a constant, systematic, stringent repression of their natural development…«69
Der demokratische Versorgungsstaat, der sich essentiell in der Massendiktatur fortsetzt, benötigt zur Durchführung seiner sozialen und gesellschaftsnivellierenden Programme eine große bürokratische Apparatur, die nur zu oft in das Privatleben des einzelnen dauernde Eingriffe macht. Lecky schrieb daher in dem obgenannten Buche ganz richtig:
»In our own day, no fact is more incontestable and conspicuous than the love of democracy for authoritative regulation.
…The expansion of the authority and the multiplication of the functions of the State in other fields, and especially in the field of social regulation, is an equally apparent accompaniment of modern democracy. This increase of State power means a multiplication of restrictions imposed upon the various forms of human action. It means an increase of bureaucracy, of the number and power of state officials. It means also a constant increase of taxation, which is in reality a constant restriction of liberty.«70
P.-J. Proudhon, der wußte, daß »tout État est de sa nature annexionniste«71, erklärte, daß gerade »die Demokratie die Idee des endlos erweiterten Staates verkörpere«72. Jacob Burckhardt allerdings formulierte seine Ideen über die totalitären Tendenzen der Demokratie mit mehr Schwung und poetischer Intuition:
»…daneben wirkt als allgemeiner Ausdruck teils der Ideen der Französischen Revolution, teils der Reformpostulate neuerer Zeit die sogenannte Demokratie, d. h. eine aus tausend verschiedenen Quellen zusammengeströmte, nach Schichten ihrer Bekenner höchst verschiedene Weltanschauung, welche aber in einem konsequent ist: insofern ihr nämlich die Macht des Staates über den einzelnen nie groß genug sein kann, so daß sie die Grenzen zwischen Staat und Gesellschaft verwischt, dem Staat alles das zumutet, was die Gesellschaft voraussichtlich nicht tun wird, aber alles beständig diskutabel und beweglich erhalten will und zuletzt einzelnen Kasten ein spezielles Recht auf Arbeit und Subsistenz vindiziert.«73
Orestes Brownson ging sogar noch weiter, als er schrieb:
»Democratic or democratically inclined governments are, for the most part, cruel and hard-hearted. Like corporations, they have no souls and are incapable of tenderness.«74
Dieses Urteil ist sehr ähnlich einem Ausspruch von Anatol France über Demokratien im Kriege und ihre Unfähigkeit, das Völkermorden durch einen humanen Verhandlungsfrieden zu beendigen75.
Ein zwar eher indirekter, aber doch um so entscheidenderer Schlag gegen die Freiheit liegt in der demokratischen »Politisierung« der Massen. Hiermit ist auch zumeist der erste Schritt zum Totalitarismus getan. Thomas Mann hegte in seinen jüngeren Jahren derartige Befürchtungen76, und diese wurden auch von manchen politischen Soziologen in unseren Tagen geäußert77. Auch Nietzsche, der dem Gedanken einer Diktatur nicht so abhold sein konnte, war beunruhigt. Er sagte:
»Die demokratische Idee läuft auf die Erzeugung eines zur Sklaverei im feinsten Sinne vorbereiteten Typus hinaus. Jede Demokratie ist zugleich eine unfreiwillige Veranstaltung zur Züchtung von Tyrannen, das Wort in jedem Sinne verstanden, auch im geistigen78.«
Die Anschauung, daß im Rahmen der Demokratie nicht nur illiberale Tendenzen, sondern auch unverhüllt totalitäre Kräfte sich ganz organisch entwickeln können, wird von einer ganzen Reihe von modernen Autoren geteilt79.
Ein Zeitgenosse Nietzsches auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans, Herman Melville, war von ähnlichen Sorgen erfüllt, doch bezogen sich diese ganz besonders auf seine Heimat. Melville, der sich während seiner Lebzeiten nur eines bescheidenen Ruhmes als Abenteurer, Romanschriftsteller und zweitklassiger Poet erfreute, ist in unseren Tagen wieder »in Mode« gekommen. Man kann in Amerika von einer ausgesprochen Melville-Renaissance reden80. In seinem »Clarel« schrieb dieser kluge Beobachter schon vor über einem halben Jahrhundert voll Bitterkeit:
»How of the teeming Prairie-Land?
There shall the plenitude expand
Unthinned, unawed?…
Myriads playing pygmy parts –
Debased into equality:
In glut of all material arts
A civic barbarism may be:
Man disennobled – brutalized
By popular science – atheized
Into a smatterer:
Dead level of rank commonplace
An Anglo-Saxon China, see,
May on your vast plains shame the race
In the Dark Ages of Democracy.«81
Diese Vision ist, zugegebenermaßen, kulturell und nicht politisch, aber die tieferen Zusammenhänge blieben weder Melville noch J. S. Mill noch Alexis de Tocqueville verborgen. Auch Mill wurde ein Opfer der Mißdeutung Chinas (ein Irrtum, der größtenteils auf dem visuellen Eindruck von Reisenden beruhte), aber die Vorahnungen dieses nur bedingt enthusiastischen Freundes der demokratischen Werte, den wohl niemand als Reaktionär bewerten kann, sind heute ebenso zeitgemäß wie damals:
»The modern régime of public opinion is, in an unorganized form, what the Chinese educational and political systems are in an organized; and unless individuality shall be able successfully to assert itself against this yoke, Europe, notwithstanding its noble antecedents and its professed Christianity, will tend to become another China.
What is it that hitherto preserved Europe from this lot? What has made the European family of nations an improving, instead of a stationary proportion of mankind? Not any superior excellence in them, which, when it exists, exists as the effect, not the cause; but their remarkable diversity of character and culture.«
Mill fuhr dann fort, die Wirkungen und Folgeerscheinungen der Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit in Europa zu untersuchen. Nachdem er den Kausalzusammenhang zwischen Vielfalt und Freiheit genügend beleuchtet hatte, gab er einen kurzen Überblick über alle diejenigen Kräfte, die der Diversität entgegengesetzt sind und die Elemente der Gleichheit und Identität mächtig fördern. Zusammenfassend schrieb er:
»The combination of all these causes forms so great a mass of influences hostile to individuality, that it is not easy to see how it can stand its ground. I will do so with increasing difficulty, unless the intelligent part of the public can be made to feel its value – to see that it is good there should be differences, even though not for the better, even though, as it may appear to them, some should be for the worse. If the claims of individuality are ever to be asserted, the time is now, while much is still wanting to complete the enforced assimilation. It is only in the earlier stages that any stand can be successfully made against the encroachment.«82
In diesen Sätzen ist es offenbar, wie weit Mill von der utilitaristischen Orthodoxie abgerückt war: zeigte er sich doch bereit, praktische Vorteile den ideellen Werten der Persönlichkeit zu opfern. Doch die egalitäre Zersetzungsarbeit der Demokratie war ihm weniger, wenn überhaupt, bewußt, und hierin trennt ihn eine Welt von Burckhardt oder dessen Freund Johann Jacob Bachofen, dem berühmten Altertumsforscher und Urvater der Kulturkreislehre. Dieser schrieb in seiner Autobiographie:
»Seit dem Siege von Luzern hat sich die Lehre von der Volkssouveränität und der Allgewalt der Demokratie zur praktischen Grundlage unserer öffentlichen Zustände ausgebildet. Ich zweifle nicht, daß sie zu allen, auch zu ihren äußersten Konsequenzen fortschreiten wird, wenn es die Gestaltung der europäischen Zustände erlaubt und nicht große Unglücksfälle das Volk wieder zu den wahren Grundlagen eines gesunden Staatslebens zurückführen. Aber vollendete Demokratie ist der Untergang alles Guten. Republiken haben von ihr am meisten zu fürchten. Ich zittre vor ihrer Ausbildung, nicht um Hab und Gutes willen, sondern weil sie uns in die Barbarei zurückwirft.
…Denn das ist der Fluch der Demokratie, daß sie ihre Verwüstungen in alle Gebiete des Lebens hineinträgt, Kirche, Haus und Familie am schwersten ergreift und für jede, auch die kleinsten Fragen den wahren Standpunkt verrückt. Weil ich die Freiheit liebe, hasse ich die Demokratie.«83
Bachofen gehört mit Burckhardt, Bluntschli, Vinet, Gonzague de Reynold84 – und in gewisser Beziehung auch mit Henri-Frédéric Amiel und Denis de Rougemont85 – zu der Schweizer antidemokratischen Schule, der man vielleicht auch Oskar Bauhofer zuzählen könnte. Diese Schule, die in einer der ehrwürdigsten geschichtlichen Vergangenheiten in Europa wurzelt, legt besonderes Gewicht auf die Person, auf das föderalistische Prinzip und auf die organische Kontinuität der Tradition. Auch ein unbewußt-bewußter Einfluß des Schweizers Carl Ludwig von Haller erscheint hie und da in ihren Ideengängen. Im Gegensatz zu Mill hatte aber Bachofens Gedankengang eine religiöse Basis. Er fürchtete nicht so sehr die spießbürgerliche Gleichmacherei als die Launen der gottlosen Massen, die in blinder irrationaler Wut alle Freiheit vernichten würden.
In Bachofens Hinweis auf seine Gleichgültigkeit gegenüber »Hab und Gut«86 fühlen wir die Andeutung einer Befürchtung, die schon Madison in einem Brief an Jared Sparks zum Ausdruck brachte, in dem er sagt, daß die Gesetze »die Macht haben müssen, das Recht auf Privatbesitz gegen den Geist der Demokratie zu verteidigen«87. Einen ähnlichen Gedanken Madisons finden wir im »Federalist« Nr. 10, wo er behauptet, eine reine Demokratie sei »incompatible with personal security or the rights of property«88. Und wenn auch Madison den Begriff der Demokratie auf ihre direkte Form beschränkte, so bleibt immer noch die Gefahr einer allmählichen »Demokratisierung« der Republik – eine Gefahr, die Senator Vandenberg wohl bekannt war89. Die Enteignung (»Verstaatlichung«, »Nationalisierung«) des Privatbesitzes seitens »fortschrittlicher, junger Demokratien« mit Billigung der Mehrheit, wie auch die Deportation ganzer völkischer Minderheiten (US-Japaner in Amerika, Sudetendeutscher in der Tschechoslowakei etc.) beweisen, daß Madisons Furcht nicht unbegründet war. Nicht umsonst war Friedrich Engels überzeugt, daß die demokratische Republik die ideale Arena für den Klassenkampf wäre, der einst in der Diktatur der besitzlosen Klassen enden würde90. Der Gedanke, daß der Sozialismus (d. h. ein autoritärer Staatskapitalismus) die letzte logische Konsequenz der demokratischen Forderungen sei, ist von den verschiedensten Denkern bejaht worden91. Freilich darf man bei dieser Betrachtung des Sozialismus auch nicht vergessen, daß ein nationaler Etatist wie Hegel sein geistiger Großvater ist; de Tocqueville, der Deutschland im Jahre 1852 besuchte, sah sehr bald die verhängnisvollen Zusammenhänge92.
Es war dies derselbe geniale Alexis de Tocqueville, der mit seltener Scharfsicht und fast übersinnlicher Genauigkeit die Entwicklung der Demokratie und insbesondere der demokratischen Republik zur Tyrannis voraussah. Diesen Vorgang stellte er sich aber nicht als dialektischen Prozeß, sondern als direkte logische Folge vor. Wegen seiner souveränen Unvoreingenommenheit, seiner manchmal trockenen Ausdrucksweise und seiner wohlabgewogenen Urteile wurde dieser normannische Edelmann oft von oberflächlichen Lesern für einen Anhänger der Demokratie gehalten, was er gewiß nicht war. (Seine entschiedene Gegnerschaft zum Regime Napoleons III. hat zu seiner schiefen Beurteilung auch beigetragen.) Lord Acton schrieb über ihn:
»For Tocqueville was a Liberal of the purest breed, a liberal and nothing else, deeply suspicious of democracy and its kindred, equality, centralisation and utilitarianism.«93
Und Antoine Redier zitiert folgendes aus einem Brief de Tocquevilles:
»J’ai pour les institutions démocratiques un goût de tête, mais je suis aristocratique par l’instinct, c’est à dire, que je méprise et crains la foule. J’aime avec passion la liberté, la légalité, le respect des droits, mais non la démocratie. Voilà le fond de l’âme… La liberté est la première de mes passions. Voilà ce qui est vrai.«94
Einer der Gründe, die de Tocqueville bewogen hatten, nach Amerika zu fahren, war die Juli-Revolution, die diesem streng legitimistischen Adeligen gegen den Strich gegangen war. Nur durch die Verwechslung von Freiheit und Demokratie konnte man diesen Denker zu einem »Demokraten« stempeln. Der damalige amerikanische Militärattaché in Paris (1834), Francis J. Lippitt, äußerte sich über ihn mit folgenden Worten:
»From the ensemble of our conversations I certainly did carry away with me an impression that his political views and sympathies were not favorable to democracy.«95
Weit davon entfernt, ein Demokrat zu sein, sah Tocqueville vielmehr mit Bangen dem kommenden Weltsieg der Demokratie entgegen, den er jedoch weniger fürchtete und haßte als den darauffolgenden Akt im Drama unserer Zivilisation. Mit melancholischer Vorahnung schrieb dieser große Liberale:
»Les monarchies absolues avaient déshonoré le despotisme; prenons garde que les républiques démocratiques ne le réhabilitent.«96
Die katholische Atmosphäre97, in der er aufgewachsen war, machte es ihm unmöglich, ein kultureller oder historischer Determinist zu werden; dennoch hielt er die Aussichten für die Freiheit in einem demokratischen Zeitalter für gering. An Gobineau schrieb er:
»À mes yeux, les sociétés humaines, comme les individus, ne sont quelque chose que par l’usage de la liberté. Que la liberté soit plus difficile à fonder et à maintenir dans les sociétés démocratiques comme les nôtres que dans certaines sociétés aristocratiques qui nous ont précédés, je l’ai toujours dit. Mais que cela soit impossible, je ne serais jamais assez téméraire pour le penser.«98
Das Bild aber, das er von der kommenden Sklaverei so großartig und bedrückend in seiner Tiefe und Klarheit malte, zeugt von einer viel pessimistischeren Stimmung. Dieses teuflische Gemälde mit seinen unerbittlichen Einzelheiten und seiner unheimlichen Übereinstimmung mit den Tatsachen finden wir am Ende des zweiten Bandes seines berühmten Werkes: De la démocratie en Amérique99.
Seine Erwägungen beginnt er mit der Bemerkung, daß er während seines Aufenthaltes in den Vereinigten Staaten (1831–1832) und noch mehr nach seiner Rückkehr von dem Schreckbild einer neuen Tyrannei verfolgt würde, eines Despotentums, das die christlichen Nationen samt und sonders zu knechten trachte. Nach sorgfältiger Untersuchung der antiken Tyrannis kam er zu dem Schluß, daß trotz aller Willkür, Grausamkeit und Rachsucht der Cäsaren das totalitäre, allumfassende Element in ihrer Regierung fast vollkommen fehlte; die geographischen, kulturellen, sprachlichen, geschichtlichen und verkehrstechnischen Hindernisse hätten alles Streben nach einer vollkommenen Regelung des gesamten bürgerlichen und politischen Lebens auf einem größeren Gebiet zunichte gemacht. Von diesen Despoten des Altertums bemerkte er:
»…leur tyrannie pesait prodigieusement sur quelquesuns; mais elle ne s’étendait pas sur un grand nombre; elle s’attachait à quelque grands objets principaux, et négligeait le reste; elle était violente et restrainte.
Il semble si le despotisme venait à s’établir chez les nations démocratiques de nos jours, il aurait d’autres caractères: il serait plus étendu et plus doux, et il dégraderait les hommes sans les tourmenter.«100
Dann besteht er darauf, daß die kommende Tyrannis eine so grundlegend neue Form haben wird, daß es ihm beim besten Willen nicht gelingen würde, für diese eine allgemein verständliche Bezeichnung zu finden.
»Les anciens mots de despotisme et de tyrannie ne conviennent point. La chose est nouvelle, il faut donc tâcher de la définir, puisque je ne peux la nommer.«101
Seine Beschreibung beginnt nun mit dem Schaubild einer einförmigen Menschenmasse, von Leuten, die semblables et égaux sind, die von kleinen, gemeinen Vergnügen angezogen werden und im Grunde genommen ein animalisches Leben führen. Jedoch…
»Au-dessus de ceux-là, s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leurs jouissances, et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux.
Il ressemblerait á la puissance paternel, si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur; mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affairs, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages: que ne peut-il leurs ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre?«102
Dies ist ein getreues Abbild des totalitären Staates, wobei uns allerdings die Betonung einer Eigenschaft, die zweimalige Erwähnung der Milde, stört. Wir dürfen nicht vergessen, daß im totalitären Staat Brutalität und Grausamkeit nur Mittel zu einem bestimmten Zweck sind. Auch beziehen sich Tocquevilles Gedankenbilder auf eine friedliche Evolution (und Degeneration), auf einen langsamen Vorgang des Wechselgeschehens und des Verfalles, in dem die Menschen allmählich zu Mikroben und der Staat zu einem Leviathan wird. Sein Irrtum ist höchstens zeitlicher Natur. Wenn der soziologische (psychologische, kulturelle, charakterhafte) Niedergang mit der stürmisch-verhängnisvollen politischen Entwicklung nicht Schritt hält – mit anderen Worten: wenn volle politische Totalität und Uniformität erreicht wird, bevor das Menschenmaterial wirklich dafür bereit ist, so muß eine Schreckensherrschaft einsetzen, damit die Bevölkerung »ausgejätet« und somit auf einen »gemeinsamen Nenner« gebracht werden kann. Diese Gewalteingriffe aber sind nicht nur selbst einengender Natur, sondern sie brauchen auch den »blassen Schrecken«, um während der Operationen zum Zwecke des »Stillhaltens« weitgehende Lähmungserscheinungen hervorzurufen. Eine solche Lage ergibt sich zum Beispiel dann, wenn die Demokratie noch nicht genug Zeit gehabt hat, die für die Tyrannis günstigen menschlichen Bedingungen zu schaffen, wenn, sagen wir, die Kräfte einer personalistischen Religion noch sehr rege oder die Volks-, Stammes- und Rassenunterschiede zu stark betont sind, wenn Klassengegensätze die nötige Uniformität stören oder wenn weltanschauliche Strömungen die Bürgerschaft in mehrere Lager trennt. Unter diesen Umständen muß die Milde durch Konzentrationslager, Massendeportationen und Gaskammern ersetzt werden, bis eine ganz neue, völlig einförmige Generation heranwächst. Wenn jedoch dieser Entwicklungsprozeß gut »synchronisiert« ist, können alle diese Gewaltmaßnahmen vermieden werden. Leute, deren Zivilcourage darin ihren prägnantesten Ausdruck findet, daß sie sich wagen, alle vier Jahre einen im Umschlag verhüllten Stimmzettel in einer Wahlurne zu verstecken, würden kaum rebellieren, und unter diesen Umständen ist das Nichtvorhandensein von Konzentrationslagern lediglich das traurige Zeichen für das Fehlen einer prinzipiellen Opposition. Es gibt eben einen »Weg zur Knechtschaft« nach deutsch-russisch-italienischem oder einen anderen nach westeuropäisch-amerikanischem Muster, wobei die Wanderer auf letzterem die Opfer des ersteren etwas hochmütig bemitleiden. De Tocqueville aber dachte prophetisch an den Westen, als er schrieb:
»L’égalité a préparé les hommes à toutes ces choses: elle les a disposés à les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfait.«103
Er fügt dem unerfreulichen Bilde noch eine Reihe weiterer Einzelheiten hinzu, die uns bald an die demokratischen, bald an die totalitären Regierungen unserer Tage erinnern. Unser Autor weiß, daß die neue Tyrannis nicht nur liberale Schlagwörter gebrauchen würde, sondern sogar im »Schatten der Volkssouveränität« errichtet werden könnte. Hin- und hergerissen zwischen dem teilweise noch überlebenden menschlichen Drang nach Freiheit und dem Wunsch, geführt zu werden, wählen die Massen gerne ein Kompromiß in Form eines Herrn, der ihnen die Illusion gibt, daß sie sich immer noch »selbst« regieren104. Am Ende dieses Kapitels beurteilt Tocqueville den Charakter einer Regierungsform, deren Haupt erwählt ist, während ein unbeugsamer Absolutismus die hervorstechende Eigenschaft ihrer Gesetzgebung und der Exekutive ist:
»Une constitution qui serait républicaine par la tête et ultramonarchique dans toutes les autres parties, m’a toujours semblé un monstre éphémère. Les vices des gouvernants et l’imbécillité des gouvernés ne tarderaient pas à en amener la ruine; et le peuple, fatigué de ses représentants et de lui-même, créerait des institutions plus libres, ou retournerait bientôt s’étendre aux pieds d’un seul maître.«105
Diese Betrachtung wird im nächsten (VIII.) Kapitel fortgesetzt, in dem der Autor von neuem darauf besteht, daß die Gefahr der neuen Tyrannis vor der Türe ist:
»Le despotisme me paraît donc particulièrement à redouter dans les âges démocratiques.
J’aurais, je pense, aimé la liberté dans tous les temps; mais je me sens enclin à l’adorer dans les temps où nous sommes.«106
Diesen Pessimismus erreichte Tocqueville allerdings erst im zweiten Band seines Werkes. Er gestand auch ein, daß sein Hauptinteresse in dieser kritischen Studie nicht den Vereinigten Staaten, sondern der Demokratie als solcher galt107. Fand er ja in Europa genau dieselben Erscheinungen und Entwicklungen wie in der Neuen Welt, und gerade diese Erfahrung brachte ihn nach einigen Jahren wieder zu seinem Thema zurück, zwang ihn aber, sich mehr mit den kulturellen und politischen und weniger mit den legalen Aspekten der wachsenden demokratischen Bewegung zu beschäftigen. Die Vereinigten Staaten lieferten ihm eine ideale »Krankengeschichte«, nicht nur weil Amerika ein miroir grossissant de l’Europe108 ist, sondern einfach weil eine neuere Entwicklung in Amerika notgedrungen deutlicher erkennbar und leichter »isolierbar« ist als in der Alten Welt. Europa mit seinen vielen »durchsichtigen« historischen Schichtungen beeinträchtigt die visuelle Klarheit politischer Erscheinungen – ist es doch leichter, Worte zu lesen, die auf einer neuen Seite geschrieben wurden, als solche auf einem über und über beschriebenen Papier.
Es kann aber nicht oft genug betont werden, daß die Ausblicke Tocquevilles evolutionär und nicht revolutionär sind. Dennoch sah er sehr deutlich, daß in der Demokratie ein autokratisches Element steckte, eine Anschauung, die auch von modernen Denkern geteilt wird. Zweifelhaft ist es aber, ob er mit Polybius übereingestimmt haben würde; dieser behauptete, daß die Demokratie in Bestialität und allgemeiner Verwilderung enden müsse109; immerhin könnte man Tocquevilles Bemerkung, daß das Volk sich vielleicht »freieren Einrichtungen zuwende«, als einen Hinweis auf ein Wiederaufleben anarchischer Tendenzen werten, eine Reaktion, die leider viel weniger wahrscheinlich ist als das Bestreben de s’étendre aux pieds d’un seul maître. Ganz davon abgesehen, gibt es auch einen sehr doktrinären Liberalismus, dessen Intoleranz auch Metternich aufgefallen war, wie man aus dessen Ausspruch ersehen kann:
»Die schiefen Ansichten der liberalen Partei werden vom Radicalismus zur tyrannischen Bevormundung der freien Bewegung der Staatsbürger benützt. Die Allmacht des Staates, dieses idealen Körpers, erwächst aus den Lehren des modernen Constitutionalismus wie die Folge aus einer Ursache, und die Folge ist die größtmöglichste Beschränkung der individuellen Freiheit unter dem Begriff der Machtvollkommenheit einer verkörperten Idee.«110
De Tocquevilles pessimistische Ansichten über die Demokratie entstammen, abweichend von Plato und Aristoteles, seiner Skepsis einer Synthese von Freiheit und Gleichheit gegenüber; den beiden Philosophen hatte er die Erfahrung der modernen, technisch bedingten Zivilisation voraus; seine Anschauungen fanden einen direkten und indirekten Niederschlag in den kritischen Werken vieler unserer Zeitgenossen111.
Auch Herman Melville, der große amerikanische Seher, wußte nur zu gut, daß das Verschwinden der alten, traditionellen Werte in der Neuen und in der Alten Welt uns nur die leere, ungute Hülle einer nackten Demokratie lassen könnte, die den. Drohungen der Zukunft blind gegenüberstehen würde:
»…Ay Democracy
Lops, lops; but where’s her planted bed?
The future, what is that to her
Who vaunts she’s no inheritor?
’Tis in her mouth, not in her heart.
The Past she spurns, though ’tis the Past
From which she gets her saving part –
That Good which lets her Evil last.«112
Dostojewskij hingegen sah noch schärfer das schicksalsschwere Keimen des Samens der zerstörenden Ideen voraus; dabei unterschied er deutlich zwischen den Gedankengängen der altmodischen Liberalen, der Vertreter der späteren russischen Aufklärung, und der nachfolgenden, nihilistisch veranlagten Generation. Wie deutlich der große russische Schriftsteller die letzten, revolutionären Folgerungen in den Grundsätzen eines wohlwollenden, aber doch schon gottlosen Liberalismus erkannte, ist aus den Worten des Altliberalen Stjepan Trofimowitsch ersichtlich, der mit Schrecken ein neuerschienenes radikales Buch durchlas:
»Ich gebe zu, daß die Grundidee des Verfassers auf Wahrheit beruht«, sagte er fieberhaft, »aber das macht sie nur um so entsetzlicher. Es ist genau unsere Idee – genau die unsere! Wir säten den Samen, pflegten ihn, bereiteten den Weg, – was konnten sie eigentlich noch Neues nach uns sagen? Aber, Himmel, wie ist das alles hier ausgedrückt, verzerrt, verstümmelt!« rief er aus, mit dem Finger auf das Buch trommelnd. »Sind das die Schlußfolgerungen, die wir anstrebten? Wer kann noch in diesem Zeug die ursprüngliche Idee erkennen?«113
Der Liberale jedoch, der auch weiterhin an einer geoffenbarten Religion festhielt und somit eine unveränderliche Grundlage für seine Glaubensphilosophie hatte, nahm natürlich eine ganz andere Stellung ein. Und dennoch verwarf Graf Montalembert, ein überzeugter Katholik und Liberaler, die Demokratie eher aus politischen und praktischen als aus religiösen Gründen. Als er zum Mitglied der Académie Française gewählt wurde, um den Fauteuil des M. Droz einzunehmen, äußerte er sich in seiner Antrittsrede folgendermaßen über die Französische Revolution:
»N’ayant pas su lire dans l’histoire du monde, qui démontre que partout la démocratie a dégénéré en despotisme, elle entreprit de fonder en France la démocratie… elle osa se condamner à combattre sous toutes les formes les deux bases de toute société, l’autorité et l’inégalité: je dis l’inégalité, qui est la condition évidente de l’activité et de la fécondité dans la vie sociale; qui est à la fois la mère et la fille de la liberté, tandis que l’égalité ne peut se concevoir qu’avec le despotisme. Non pas, certes, cette égalité chrétienne dont le vrai nom est l’équité; mais cette égalité démocratique et sociale, qui n’est que la consécration de l’envie, la chimère de l’incapacité jalouse; qui n’a jamais éte qu’un masque, et qui ne pourrait devenir une réalité que par la destruction de toute mérite, de toute vertue.
…Non, la propriété, dernière religion de sociétés abâtardies, ne résistera pas seule au bélier des niveleurs. N’a-tons pas vu de nos jours contester jusqu’au privilège de l’intelligence, et faire un appel à l’ignorance pour sauver la révolution? Tant, il est vrai que, pour rester dans la logique, le dogme de l’égalité ne doit plus respecter le mérite et la fortune que la naissance.«114
Ebenso klar war es für Fustel de Coulanges, den liberalen Historiker, daß jede Ungleichheit in einer demokratischen Zivilisation viel bitterer empfunden werden würde als unter anderen Umständen115. Um eine vollkommenere Gleichheit zu schaffen, würden sich die Massen einem Führer unterordnen, der ihre freiheitsfeindlichen Wünsche erfüllt oder doch zumindest den Anschein erweckt, daß er ihre egalitären Sehnsüchte in die Wirklichkeit umzusetzen bestrebt ist. Goethe beschrieb diese Sachlage in einfachen Worten:
»Ich habe gar nichts gegen die Menge,
Doch kommt sie einmal ins Gedränge,
So ruft sie, um den Teufel zu bannen,
Gewiß die Schelme, die Tyrannen.«116
In dieser sehr bündigen Analyse ist wohl auch Platos Einfluß unverkennbar, der uns in seinem Staat ein sehr genaues Bild von dem tyrannischen Volksführer gezeichnet hat, den sich die enteignenden und konfiszierenden Massen als Protektor gegen die Rachegelüste des früheren Patriziates erwählen. Anders aber, mit einem schärferen Sinn für die historische Dialektik, sah der Genfer Henri Frédéric Amiel die verhängnisvolle Entwicklung. Auf den Verfall echter Autorität in der menschlichen Gesellschaft hinweisend, schrieb er folgendes in sein Tagebuch:
»Le seul contrepoids de l’égalitarisme, c’est la discipline militaire. Aux galons, à la salle de police, au cachot ou au passer par les armes, il n’y a pas de réplique. Mais n’est-il pas curieux que le régime du droit individuel aboutisse simplement au respect de la force? Jacobinisme amène césarisme, avocasserie se termine en artillerie, et le régime de la langue conduit au régime du sabre. Démocratie et liberté sont deux.«117
Darum soll man nicht erstaunt sein, wenn in unserem Jahrhundert der Vorschlag gemacht wird, zur Erlangung einer bleibenden Freiheit die Monarchien zu erhalten oder zu restaurieren118. Lange Zeit hindurch war Frankreich, das »fortschrittlichste« Land Europas, auch die Nation, in der die persönlichen Freiheiten am ärgsten bedroht waren. Daher wurde dort mit stets wachsender Heftigkeit die Begeisterung für das Prinzip der Freiheit in beschwörender Eindringlichkeit betont, was als sicheres Zeichen für die bedrohte Stellung wahrer Liberalität gewertet werden muß. (Es sind nie Freiheitsstatuen in den Bergen Tirols aufgestellt worden!) Daher deckt sich ganz unheimlich die Beschreibung, die William James am Ende des vorigen Jahrhunderts vom französischen Nationalcharakter machte, mit den Schilderungen der deutschen Stammeseigenschaften, wie man sie während der letzten Kriege in England und Amerika zu lesen bekam119. Die Problematik war dieselbe.
Diese freiheitsfeindlichen Strömungen innerhalb Frankreichs fanden in der politischen Struktur des Landes ihren konkretesten Niederschlag. Ähnlich wie Leontjew kritisierte auch der russische Revolutionär Alexander Herzen die zweite Republik und, später dann, das Kaiserreich. Er schreib damals in seinem Tagebuch:
»Haben wir nicht gesehen, daß eine Republik, deren Regierung das Vorschlagsrecht hat, die politisch zentralisiert ist und eine enorme Armee besitzt, der Entwicklung der Freiheit viel weniger förderlich ist als z. B. die englische Monarchie ohne Vorschlagsrecht und ohne Zentralisierung? Haben wir nicht gesehen, daß die französische Demokratie, d. h. Gleichheit in der Versklavung, der unbegrenzten Autokratie am allernächsten steht?«120
Diese politische Entwicklung ging Hand in Hand mit einer sozialen Entwicklung; der etatistische Leviathan forderte einen sozialen Behemoth und umgekehrt. Eine monolithische Gesellschaft wurde nun durch den Aufstieg zahlreicher Riesenorganisationen und »Koalitionen« geschaffen; allenthalben schlossen sich die Menschen in kämpferische Gruppen zusammen. Tiefsinnigere Beobachter, wie Kierkegaard, Dostojewskij und Ernest Hello, der seine Essays im vorigen Jahrhundert schrieb, wurden durch diesen Wandel beunruhigt und erschreckt. Hello sagte:
»Les hommes du monde ne sonst pas amis: mais ils sont coalisés. L’unité vit d’amour. La coalition vit de haine. Les coalisés sont des ennemis privés qui se joignent ensemble contre l’ennemi public. Les hommes du monde ont une haine commune qui leur donne une occupation commune, qui détermine le point central de leur activité.«121
Kierkegaard schrieb im selben Geiste:
»Das Prinzip der Assoziation (welches höchstens bei materiellen Interessen mit Berechtigung angewendet werden kann) ist heutzutage nicht positiv, sondern negativ; es ist ein Ausweg, eine Ablenkung und eine Illusion. Vom Standpunkt der Dialektik aus ist die Lage die folgende: das Assoziationsprinzip schwächt den Einzelmenschen, indem es ihn ›stärkt‹; es stärkt zahlenmäßig und schwächt in ethischer Beziehung. Erst nachdem der Einzelne der ganzen Welt gegenüber eine ethische Anschauung gewonnen hat, kann von einer echten Vereinigung die Rede sein. Anderenfalls ist die Vergemeinschaftung von an sich schwachen und schwankenden Individuen ebenso abstoßend und schädlich wie eine Ehe, die zwischen Kindern geschlossen wird.«122
Dostojewskij ging jedoch noch weiter und versuchte selbst den Begriff der Vereinigung auf einer rein materiellen Grundlage lächerlich zu machen:
»Wenn eine Nation ihr religiöses Erbe verläßt, so entsteht ein bösartiges, von der Angst genährtes Verlangen für Zusammenarbeit, dessen Ziel die Rettung des Bauches ist. In einem solchen Fall hat die gesellschaftliche Vereinigung kein anderes Ziel.
Das ist auch der wahre Grund, warum die französische Bourgeoisie sich zusammenschart und mit dem einzigen Beweggrund, den Bauch zu retten, sich dem Proletariat entgegenstellt, das nun an ihre Tore pocht. Die ›Rettung des Bauches‹ ist jedoch das machtloseste aller Einigungsmotive. Es ist der Anfang vom Ende. Was kann denn schon durch die ›Einrichtungen‹ dieses Motivs gerettet werden, wenn man sie ganz unabhängig betrachtet? Wenn es keine Brüder gibt, wird auch keine Institution ein Gefühl von Brüderlichkeit erwecken.«123
Ob nun die Bestrebungen einer egalitären Vereinigung erfolgreich sind oder nicht, so wird jedenfalls der »waagrechte Druck« der Massen dazu beitragen, einen Menschenschlag zu schaffen, dessen Persönlichkeit so herabgemindert sein wird, daß er den Übergriffen eines totalitären Staates oder einer totalitären Gesellschaft nicht wird genügend Widerstand leisten können. Dieser Schwächezustand kennzeichnet fast alle Demokratien. Schon Alexis de Tocqueville war über die Strenge der Gruppenüberwachung in den Vereinigten Staaten erstaunt und betroffen. Er schrieb:
»Je ne connais pas de pays où il règne en général moins d’indépendance d’esprit et de véritable liberté de discussion qu’en Amérique… En Amérique, la majorité trace un cercle formidable autour la pensée…
L’inquisition n’a jamais pu empêcher qu’il ne circulât en Espagne des livres contraires à la religion du plus grand nombre. L’empire de la majorité fait mieux aux États-Unis: elle a ôté jusqu’à la pensée d’en publier.«124
Diese Feststellung wird durch die Beobachtungen James Fenimore Coopers, des Verfassers des »Lederstrumpfes«, unterstützt, der ungefähr zur selben Zeit (1838) folgendes über sein Land schrieb:
»It is a besetting vice of democracies to substitute public opinion for law. This is the unsual form in which masses of men exhibit their tyranny.
…Although the political liberty of this country is greater than that of nearly every other civilized nation, its personal liberty is said to be less. In other words, men are thought to be more under the control of extra-legal authorities, and to defer more to those around them, in pursuing ever their lawful and innocent occupations, than in almost every other country… It is not difficult to trace the causes of such a state of things, but the evil is none the less because it is satisfactorily explained.«125
Der übermäßig starke Einfluß, den die öffentliche Meinung ausüben kann, tritt besonders deutlich in der Geschichte kleiner amerikanischer Städte hervor, in denen auch physische Gewaltanwendungen häufig vorkamen und immer noch vorkommen; dies trifft nicht nur für den Süden zu, sondern auch für den Mittleren Westen und für Neu-England126. Auch ist Großbritanniens Gesellschaft trotz ihrer aristokratisch-freiheitlichen Traditionen vor den Segnungen »gutnachbarlicher« Einmischungen nicht gefeit; als Vorbereitung für die absolute Herrschaft des tyrannischen Staates spielen diese zersetzenden, »horizontalen« Kräfte mit ihrem ungeheuren, oft zermalmenden Druck auf die Persönlichkeit des Einzelnen eine verhängnisvolle Rolle. Erfolgreicher Widerstand von seiten der Zivilbevölkerung wurde während des Zweiten Weltkrieges in größerem Ausmaß nur von »rückständigen« Nationen geleistet. John Stuart Mill schrieb:
»Our mere social intolerance kills no one, roots out no opinions, but induces men to disguise them, or to abstain from any active effort for their diffusion. With us, heretic opinions do not perceptibly gain, or even lose, ground in each decade or generation; they never blaze out far and wide, but continue to smoulder in the narrow circles of thinking and studious persons among whom they originate, without ever lighting up the general affairs of mankind with either a true or deceptive light… A convenient plan for having peace in the intellectual world, and keeping all things going on therein very much as they do already. But the price paid for this sort of intellectual pacification, is the sacrifice of the entire moral courage of the human mind127.
…In England, from the peculiar circumstances of our political history, though the yoke of opinion is perhaps heavier, that of the law is lighter, than in most countries of Europe.«
Und in einer pessimistischen Anwandlung fügte er hinzu:
»The majority have not yet learnt to feel the power of the government their power or its opinions their opinions. When they do so, individual liberty will probably be as much exposed to invasion from the government, as it already is from public opinion.«128
Diese Erwägungen betonen, wie es einem Denker evangelischer Abkunft zukommt, den evolutionären eher als den revolutionären Charakter des Überganges zur totalitären Diktatur. Andererseits besteht aber kaum ein Zweifel, daß bei den katholischen Nationen des Kontinents, sobald sie »fortschrittlich« waren oder wurden, sich sehr ähnliche Vorgänge abspielten. Was Mills indirekter Hinweis auf die britische Abneigung gegen den Wechsel äußerer Formen betrifft (wobei der Inhalt ruhig zerstört oder vertauscht werden darf, solange die Etikette bleibt), so darf man nicht vergessen, daß ein derartiger Zersetzungsprozeß mit Wahrscheinlichkeit überall dort auftritt, wo neben einer konservativen Grundhaltung eine absolute Herrschaft der öffentlichen Meinung in Verbindung mit einem allgemein oberflächlichen Denken zu beobachten ist. Man muß sich nur daran erinnern, daß Thomas Huxley einst sagte: »We do not much mind heterodoxy over here if it does not proclaim itself as such.«129 Wir finden hier eine merkwürdige Parallele zu Huey Longs Feststellung, daß der Faschismus in den Vereinigten Staaten nur dann siegreich sein könnte, wenn er sich »Demokratie« nennen würde130.
Diese geistige Unehrlichkeit und der Zerfall aller inneren Substanz erschöpft aber bei weitem noch nicht das Gesamtbild unserer Zeit. Die drohenden Gefahren des Totalitarismus und der Diktatur wurden im Urteil so vieler Denker des 19. Jahrhunderts durch eine stets wachsende Homogenität, durch eine Reihe von »Gleichschaltungen« im gesellschaftlichen Bereich unausweichlich herausgefordert. Die Zerschlagung hierarchischer und klassenhafter Unterschiede erleichterte das Heranrollen des Tanks der Tyrannis. Selbst Thomas Jefferson hatte an die Notwendigkeit »natürlicher aristoi« geglaubt, und James Madison, ein anderer Gründervater der amerikanischen Republik, hatte politische Privilegien für diejenigen verlangt, die eine besondere staatsmännische Begabung zeigten131. Einem Manne wie Matthew Arnold war der Zusammenhang zwischen aristokratischen Privilegien und der Freiheit völlig klar. Sagte doch dieser von den politischen Neigungen aristokratischer Körperschaften, daß
»…they have a sense of equality among themselves, and of constituting in themselves what is greatest and most dignified in the realm, which makes their pride revolt against the overshadowing greatness and dignity of commanding executive. They have a temper of independence, and a habit of uncontrolled action, which makes them impatient of encountering in the management of the interior concerns of the country, the machinery and regulations of a superior and peremptory power.«132
Ähnliche Gedanken sind auch in unserem Jahrhundert ausgesprochen worden133. Der Widerstand gegen die Vorrechte der Geburt – an und für sich keine ungesunde Erscheinung – wandelt sich leicht in eine Ablehnung jeglicher Überlegenheit; die Gleichmacherei, wie Albert Jay Nock richtig bemerkte134, nimmt schließlich einen geistigen Charakter an, und somit ist ein neuer Schritt in die Richtung des Totalitarismus getan. Emersons Warnung »without great men, great crowds of people in a nation are disgusting; like moving cheese, like hills of ants, or of fleas, – the more, the worse« hat in unseren Tagen wenig Anklang gefunden.
Sobald die gesellschaftlichen Rangleitern zerstört oder unwiederbringlich beschädigt worden sind, ruht jegliche politische Verantwortung auf den Schultern der Massen; leider aber hat sich die Freiheitsliebe des Durchschnittsmenschen, seine Bereitschaft, für dieses Ideal Opfer zu bringen, im allgemeinen und besonders in der Geschichte der jüngsten Vergangenheit nicht sehr bewährt135. Der spezifisch kleinbürgerliche Charakter des Faschismus sowie des Nationalsozialismus wird heute von keinem ernsthaften Beobachter mehr bezweifelt136.
Alle diese Richtungen und Neigungen hängen organisch mit dem Vorrang der Quantität über der Qualität zusammen, der durch den demokratischen Grundsatz der Mehrheitsherrschaft mächtig gefördert wurde. So bemerkte Jacob Burckhardt schon im Jahre 1866:
»Ernster als dieses ist das völlige Verzweifeln an allem Kleinen, welches um sich greift; wer nicht zu einem Dreißigmillionenvolk gehört, der schreit: Hilf Herr, wir versinken!
…Der Philister will mit Teufelsgewalt an einem großen Kessel essen, sonst schmeckt es ihm nicht mehr.«137
Und an Friedrich von Preen schrieb er Jahre später:
»Aber es ist, wie Sie es sagen: man will die Leute beizeiten zu Massenversammlungen erziehen. Es wird dahin kommen mit den Menschen, daß sie anfangen zu heulen, wenn ihrer nicht wenigstens hundert beisammen sind.«138
Die Gefahr, daß diese Herrschaft der. Massen, die auf der Quantität und dem Mehrheitsbegriff fußt, in einen ungeheuren Horizontaldruck ausarten wird, haben politische Denker von Madison bis René Schwob erwartet139. Die Möglichkeit einer Mehrheitstyrannis war auch J.S. Mill, den man schwerlich einer grundsätzlich antidemokratischen Einstellung beschuldigen kann, recht wohl bekannt. Diese Art der Tyrannis, so betonte Mill, kann sowohl rein politischen als auch sozialen Charakters sein140. Und dann fügte er hinzu:
»Society can and does execute its mandates; and if it issues wrong mandates instead of right, or any mandates at all in things with which it ought not to meddle, it practises a social tyranny more formidable than many kinds of political oppression, since, though not usually upheld by such extreme penalties, it leaves fewer means of escape, penetrating much more deeply into the details of life, and enslaving the soul itself.«141
De Tocqueville, der noch weniger Illusionen hegte als Mill, machte die folgende Bemerkung über die von der »größten Anzahl« ausgeübten Macht:
»Ce pouvoir irrésistible est un fait continu et son bon emploi n’est qu’un accident.«142
George Canning, der ein sehr scharfes Auge für die Zeichen seiner Zeit hatte, stellte fest, daß »the philosophy of the French Revolution reduced the nation to individuals in order afterwards to congregate them into mobs«143. Und während Walt Whitman in seinen »Leaves of Grass« wimmerte:
»One’s self I sing, a simple, separate person,
Yet after the word democratic, the word en masse«,
donnerte Kierkegaard gegen die wachsende Unterdrückung alles Edlen durch die Massen. So können wir folgendes in seinem Tagebuch lesen:
»Bücher werden für ›die Massen‹, die nichts verstehen, von denen geschrieben, die wissen, wie man für ›die Massen‹ schreibt… Der Kampf gegen die Fürsten und Päpste – und dies ist um so zutreffender, je mehr wir uns unserer Zeit nähern – war leicht im Vergleich zum Kampf gegen die Massen, die Tyrannei der Gleichheit, der grinsenden Seichtheit, Unsinnigkeit, Niedrigkeit und Vertiertheit.«144
Orestes Brownson, der große amerikanische Konvertit, betrauerte mit nicht weniger Pessimismus den verbrecherischen Einfluß der Massen auf die amerikanische Regierung, die er in ihrer ursprünglichen Fassung nicht mit Unrecht eine »Wahlaristokratie« nannte. Er war jedoch überzeugt, daß diese langsam unter dem Druck der Massen durch die Demokratie und die Herrschaft der von den »Kaprizen des Pöbels« beeinflußten Demagogen ersetzt werden würde. Und dennoch riet er zur Resignation: »Evil, or no evil, such is the fact and we must conform to it«.145 In seinen melancholischen Zukunftserwartungen war er freilich nicht der einzige.
Die Zahl der Denker, die sich mit der Gefahr befaßt haben, die dem Staat, der menschlichen Persönlichkeit und der Freiheit durch die anorganischen Massen droht, hat sich seitdem ständig vermehrt146. Sie alle sehen deutlich die steigende Sturmflut des Kollektivismus, die nicht nur das Werk der totalitären Pöbelführer ist, sondern auch von anderen Quellen gespeist wird, da Massen offensichtlich leichter »behandelt« und gelenkt werden können als wirkliche Persönlichkeiten147.
Burke, der den Aufstieg des Bonapartismus sehr richtig voraussah, hatte auch keine Illusionen über den demokratischen Charakter des Vorspiels zu dieser cäsaristischen Tragödie. Er sagte:
»Of this I am certain, that in a democracy, the majority of the citizens is capable of exercising the most cruel oppressions upon the minority, whenever strong divisions prevail in that kind of polity, as they often must; and that oppression of the minority will extend to far greater numbers, and will be carried on with much greater fury, than can almost ever be apprehended from the dominion of a single sceptre. In such a popular persecution, individual sufferers are in a much more deplorable condition than in any other. Under a cruel prince they have the balmy compassion of mankind to assuage the smart of their wounds; they have the plaudits of the people to animate their generous constancy under their sufferings: but those who are subjected to wrong under multitudes, are deprived of all external consolation. They seem deserted by mankind; overpowered by a conspiracy of their whole species.«148
Es ist offensichtlich, daß dieser Massenhaß für widerspenstige und unvolkstümliche Minderheiten eines Organisators oder Leiters bedarf, und dies gerade ist die Rolle, die der antike sowohl als auch der moderne Diktator anzustreben pflegt149.