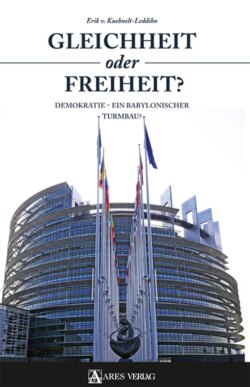Читать книгу Gleichheit oder Freiheit? - Von Kuehnelt-Leddihn Erik - Страница 7
Gleichheit oder Freiheit: Klärung der Begriffe
ОглавлениеDie Sklaverei läßt sich bedeutend steigern, indem man ihr den Anschein der Freiheit gewährt.
Ernst Jünger, Blätter und Steine.
Diese Studien sollen Essays im engsten Sinne des Wortes sein, Versuche also, gewisse Phasen und Aspekte des ewigen Gegensatzes zwischen der Freiheit und Gleichheit, den Grundforderungen des Liberalismus und der Demokratie im klassischen Sinn, von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Es versteht sich von selbst, daß diese Studien ein so weitgestecktes Thema nicht erschöpfen können, jedoch haben wir die einzelnen Objekte unserer Untersuchung nicht zufällig, sondern aus ganz bestimmten Gründen ausgewählt.
Bevor wir uns aber noch über die so wichtige Terminologie auseinandersetzen, wollen wir über unseren weltanschaulichen Standpunkt einige Vorbemerkungen machen. Es ist klar, daß ein Autor, der politische und soziologische Erscheinungen kritisch betrachtet, von einer zumindest lose zusammenhängenden philosophischen Schau geleitet wird. Da der Verfasser dieser Schrift ein katholischer Christ ist, steht seine Philosophie in einem engen Verhältnis zur Theologie seiner Kirche, ein Verhältnis, das am besten als Koordination bezeichnet werden kann. Obwohl er vorwiegend thomistisch eingestellt ist, steht er auch stark unter dem Einfluß eines theistischen Existentialismus.
Wir hoffen, daß der nicht-katholische Leser durch dieses Geständnis nicht entmutigt oder abgeschreckt wird. Wir möchten ihn daran erinnern, daß der Thomismus nicht ein fremdartiger, esoterischer oder gar hermetischer Glaube voll geheimnisvoller Andeutungen ist, sondern, im Gegenteil, eine Philosophie, die in ihrem Streben nach objektiver Realität durch die größte Achtung für die menschliche Vernunft charakterisiert ist. Der Thomismus ist eine Philosophie des common sense, die mit solipsistischen Spielereien, einem nihilistischen Relativismus, der Leugnung der Realität aller sensorischer Wahrnehmungen und mit der krankhaften Verwerfung der Gesetze der Logik keine Geduld hat. Der thomistische Realismus wird immer darauf bestehen, daß zweimal zwei vier sind und daß zwei entgegengesetzte Behauptungen nicht zugleich richtig sein können. Insofern der Thomismus der Philosophie dieser Seiten unterliegt, birgt er nichts Magisches und Mystisches in seinen Behauptungen, sondern lediglich gesunden Menschenverstand. Gleichzeitig aber beschäftigen wir uns eingehend mit den psychologischen Reaktionen des Menschen, mit Mythen und Aberglauben. Jedoch werden wir selbstverständlich das Psychologische dem Philosophischen und bloße Gefühle der objektiven Wirklichkeit unterordnen, ohne aber das Bestehen der erstgenannten zu vergessen.
Wenn wir nun über Gleichheit und Freiheit sprechen, muß es uns vorerst klar sein, daß es sich hier für unsere Zwecke um relative und nicht um absolute Begriffe handelt, um Richtungen und Neigungen eher denn um reine Abstraktionen. In unseren Studien verstehen wir unter »Freiheit« das größte Maß an Freiheit, das in einer gegebenen Situation erreichbar, billig und möglich ist, wobei freilich diese Begriffe noch einer weiteren Erklärung bedürfen. Als ein Mittel zur Wahrung menschlichen Glücks sowie menschlicher Persönlichkeit ist die Freiheit ein mittelbares Ziel und bildet so einen Teil des bonum commune, des Allgemeinwohls. Unter diesen Umständen ist es einleuchtend, daß die Freiheit nicht brutal den Forderungen einer absoluten Leistungsfähigkeit oder den schrankenlosen Bestrebungen für materielles Wohlbefinden geopfert werden kann. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. In dieser wie in manch anderer grundlegenden Hinsicht werden die meisten unserer Leser wohl mit uns übereinstimmen, denn wenn sie auch nicht der katholischen Kirche angehören, so sind sie entweder Christen oder doch zumindest in geistig-kultureller Hinsicht Produkte der jüdisch-griechisch-christlichen Tradition, deren Allgegenwart niemand im Abendland völlig entraten kann. Wiewohl dies manche mit wechselndem Erfolg versuchen.
Wenn wir von der Gleichheit (aequalitas) sprechen, meinen wir nicht Billigkeit oder Unparteilichkeit (aequitas), die der Gerechtigkeit zugeordnet sind. Auch die sogenannte »christliche Gleichheit« ist nicht »mechanisch«, sondern lediglich Unterwerfung unter dasselbe Gesetz – also Isonomie. Wir wollen hier auch nicht auf die psychologischen Ursachen für die egalitären und »identitären« Neigungen unserer Zeit eingehen, da wir dies an anderem Orte ausführlich getan haben1; was aber das Verhältnis zwischen der Freiheit und der Gleichheit betrifft, so genügt vielleicht hier die Feststellung, daß ein Erzwingen menschlicher Gleichheit mit der Forderung nach Freiheit unvereinbar ist. Vom ethischen Standpunkt aus gesehen sind ja Neid, Eifersucht und Angst die treibenden Kräfte hinter den gleichmacherischen und »identitären« Bestrebungen unserer Zeit2; die »Natur« aber ohne menschliche Eingriffe ist alles eher denn egalitär. Wenn wir eine echte Ebene schaffen wollen, müssen wir die Bergspitzen wegsprengen, um damit die Täler auszufüllen; die mechanische Gleichheit setzt daher ein System von äußeren Gewalteingriffen voraus, die natürlich grundsätzlich der Freiheit widersprechen. Freiheit und Gleichheit stehen also wesenhaft zueinander im Widerspruch, eine Tatsache, die sich aber erst teleologisch in ihrer ganzen Schwere auswirkt.
Von allen politischen Ausdrücken, die tagtäglich mißbraucht werden, haben die Worte »Liberalismus« und »Demokratie« am allermeisten zu leiden. Der echte Liberalismus strebt das größtmögliche Ausmaß an Freiheit für alle Menschen an3 – und dies ganz unabhängig von der Struktur der Regierungsform, unter der sie leben mögen. Es muß aber zugestanden werden, daß die Affinität zwischen der Freiheit einerseits und den verschiedenen Regierungsformen anderseits sehr ungleichmäßig ist; auch darf man nicht vergessen, daß gewisse politische Einrichtungen mit betont liberaler Zielsetzung durch dialektische Prozesse die Gefahr weitgehender Versklavung bergen. Der wahre Liberale ist aus diesen wie aus anderen Gründen nicht an eine bestimmte Regierungsform gebunden; seine Wahl bleibt lediglich dem Wunsch untergeordnet, sich und seine Mitbürger im Genuß größtmöglicher Freiheit zu wissen. Wenn er glaubt, daß ein Monarch größere Freiheit gewähren kann als eine Republik, wird er für den ersten einstehen; ja, unter gewissen Umständen könnte er sogar die tatsächlichen Einschränkungen einer Militärdiktatur den potentiellen Evolutionen einer wirklichen Demokratie vorziehen4.
Wie jeder Kenner der Alten Welt es erwarten kann, ist die Bezeichnung »liberal« im politischen Sinn spanischen Ursprungs. Auf der Iberischen Halbinsel wird sie zum ersten Male im Jahre 1814 gebraucht und wurde bald von den Franzosen übernommen. Southey schrieb im Jahre 1816 (in der »Quarterly Review«) über die British Liberales (also in der spanischen Form!), und zehn Jahre später benützte Scott den französischen Ausdruck Libéraux. Von ihm aber wurde diese Bezeichnung für den radikalen Flügel der Whigs gebraucht, was natürlich nicht unserem Sinn dieses Wortes entspricht. In den Vereinigten Staaten hat der Mißbrauch dieses Terminus technicus einen Höchstgrad erreicht; in der Neuen Welt nennen sich »Liberale« all jene, die Neuerungen nicht abhold sind und besonders oft linkstotalitäre Bestrebungen gutheißen. Ein echter amerikanischer Liberaler wie Oswald Garrison Villard nannte sich daher »an old-fashioned liberal«. Auf dem europäischen Kontinent waren die Dinge oft nicht viel anders; hier verfolgten die »Liberalen« nur zu oft ihre Gesinnungsgegner mit unerbittlicher Feindseligkeit. Diese Parteiliberalen nennt Professor Carlton J. H. Hayes sectarian liberals, die »Anhänger der liberalen Sekte«5.
Die psychologischen und philosophischen Triebfedern und Grundlagen der liberalen Einstellung sind bei weitem nicht einheitlich. In einem christlichen Liberalismus werden stets Wohlwollen und Großmut, Generosität und Ehrfurcht vor der Persönlichkeit des Nächsten die Antriebskräfte sein. Es gibt aber auch einen »Liberalismus«, wie wir es in den letzten hundert Jahren erfahren mußten, der auf einem erkenntnistheoretischen Nihilismus fußt, ein »Liberalismus«, der rundweg erklärt, daß die objektive Wahrheit entweder nur ein Vorurteil, ein Stück geistiger Überheblichkeit, eine Sinnestäuschung ist, oder aber, daß sie menschlich ganz einfach nicht erfaßt werden kann und außerhalb unseres Erkenntnisvermögens steht. So wird dann entweder die Wahrheit selbst oder der Weg zur Wahrheit geleugnet. Es ist klar, daß eine derartige Philosophie der Verzweiflung nicht notwendigerweise zu einer liberalen Einstellung führt; gerade das Gegenteil kann eintreten, und daher hängen die Schlußfolgerungen, die von diesen nihilistischen Prämissen gezogen werden, vom persönlichen Geschmack und vom Temperament ab. »Liberalität« bedeutet ursprünglich Freigebigkeit, und es versteht sich von selbst, daß von einem Geben nur dann die Rede sein kann, wenn die Schenkung von einem Besitz kommt. Generosität ohne Überzeugung gibt es nicht. Toleranz, die dem Liberalismus wesensverwandt ist, darf mit Gleichgültigkeit nicht verwechselt werden. Sie ist ein opferbereites Ertragen anderer Meinungen in Hinsicht auf eine eigene, echte Überzeugung.
Der christliche, der wahre Liberale darf aber auch in seiner Haltung von Erwägungen geleitet werden, die nicht einen ethischen oder religiösen, sondern auch einen praktischen Charakter tragen. Zwar unterscheidet er genau zwischen Wahrheit und Unwahrheit, zwischen Recht und Unrecht, doch verwirft er die Häufung von Zwangsmaßnahmen, weil er weiß, daß sie nicht den gewünschten Erfolg erzielen, ja sogar zu noch größerem Übel führen können. Wir haben schon früher dem Gedanken Ausdruck verliehen6, daß das Mittelalter mit seiner faktischen Unmöglichkeit, sich offen von der Kirche loszusagen, an einer Art urämischen Vergiftung litt. Und es ist offensichtlich, daß eine Verfolgung Märtyrer erzeugt. Hier ist aber dann die Gefahr vorhanden, daß die Qualen und Leiden der Verfolgten die sadistischen Neigungen ihrer Schergen befriedigen. Schließlich kann einem einsichtigen Christen nichts als teuflischer erscheinen als die Verquickung von Wahrheit und Laster, die dann einer Verschmelzung von Heiligkeit und Irrtum gegenübersteht! Und hierzu sind nicht einmal Scheiterhaufen notwendig, auf denen verschrobene Sektierer zum Ergötzen rundlicher Dogmatikprofessoren verkohlt werden…
Die verhängnisvolle Neigung zum Gewaltverfahren, die sich auf Grund des staatlichen Beispiels in die Kirche eingeschlichen hatte, behauptete sich mehrere Jahrhunderte, bis dann intra muros der Gegenstoß einsetzte7. Schon Pius VII. kämpfte mit scharfen Worten gegen das Zwangsprinzip, weil es lediglich die Heuchelei förderte. So berichtet uns ein junger Amerikaner, der den Vater der Christenheit im Jahre 1818 besuchte:
»The Pope talked a good deal about our universal toleration, and praised it as much as if it were a doctrine of his own religion, adding that he thanked God continually for having at last driven all thoughts of persecution from the world, since persuasion was the only possible means of promoting piety, though violence might promote hypocrisy.«8
Und heute betont der Codex Iuris Canonici ausdrücklich, daß niemand (d. h. kein Erwachsener) gezwungen werden kann, den katholischen Glauben anzunehmen9. Es darf dabei allerdings nicht verschwiegen werden, daß in der mittelalterlichen Kirche lokal manchmal in diesem Punkte eine gewisse Verwirrung herrschte; es kamen Fälle vor, daß zwangsweise getaufte, erwachsene Juden der Gerichtsbarkeit der Kirche unterstellt wurden. Dies waren freilich nur Übergriffe des Klerus10, nie aber die Stellung des Heiligen Stuhles. Es konnte nur eine Frage der Zeit sein, bis die ganze Wirkungskraft der im Grunde genommen »personalistischen« Theologie der Kirche sich im Fragenkomplex von Gewissen, Freiheit, Gewalt und Zwang fühlbar machte11. Die katholische Lehre vom Primat des Gewissens über alle sichtbare Autorität, die selbst den Vikar Christi auf Erden einschließt, steht in grellem Gegensatz zu den koerziven Einrichtungen und Gebräuchen des Spätmittelalters; diese waren schließlich auch mit den Forderungen der christlichen Nächstenliebe unvereinbar. Zwar darf es nicht außer acht gelassen werden, daß die von der Inquisition schuldig befundenen Angeklagten den weltlichen Autoritäten mit einer feststehenden Formel übergeben wurden, in der die Bitte enthalten war, diese nicht hinzurichten. Diese Formel lautete:
»De nostro foro ecclesiastico te proiicimus et tradimus seu relinquimus bracchio seculari ac potestati curie secularis, dictam curiam secularem efficaciter deprecentes, quod circa et citra sanguinis effusionem et mortis periculum sententiam suam moderetur.«12
Dieser Wortlaut entschuldigt nicht eine Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat in einer höchst zweifelhaften Sache, aber sie erklärt doch die Grundeinstellung der Kirche. Kein katholischer Theologe wird heute die Möglichkeit eines ehrlichen und tragischen Konfliktes zwischen Gewissen und Wahrheit ableugnen; jedem Häretiker, jedem Glaubensfeind einfach schlechten Willen oder Bosheit zuzuschreiben, war allerdings eher der Ausfluß psychologischen Nichtwissens als philosophischen Unverstands.
Auch darf nicht vergessen werden, daß der Liberalismus – last, but not least — seine wirtschaftlichen Aspekte hat. In diesem Zusammenhang muß man darauf hinweisen, daß ein wahrer Liberalismus schwerlich dem Manchestertum oder einem unbegrenzten Kapitalismus gleichzusetzen ist. Neo-Liberale (»Dezentralisten«), wie z. B. Wilhelm Röpke, haben dies öfters betont. Da der Privatkapitalismus dazu neigt, Besitztum (ein wichtiger Schlüssel zur Freiheit!) in wenigen Händen zu konzentrieren, ist er von einem echt liberalen Gesichtspunkt dem Staatskapitalismus (Sozialismus) immer noch vorzuziehen13. Doch fragt es sich überhaupt, ob der »Kapitalismus«, ein marxistischer Ausdruck, eine Ideologie, ein »Ismus« ist. Wir bezweifeln das. Viel klüger ist es, den Ausdruck »freie Marktwirtschaft« zu verwenden, wobei das Wörtchen »frei« völlig überflüssig ist.
Die Bezeichnungen »Demokratie« und »demokratisch« sind rein politischer Natur. Demokratie bedeutet »Macht (Regierung) des Volkes«14 auf egalitärer Grundlage15; auf die verschiedenen soziologischen und sozialen Mißbräuche, die mit diesem Ausdruck getrieben werden, wollen wir nicht gesondert eingehen. Die bloße Sympathie für die unteren Klassen, zum Beispiel, ist nicht Demokratie, sondern Demophilie16. Der Leser sei daher gewarnt, daß wir uns in diesen Studien fast ausschließlich mit dem politischen Begriff der Demokratie befassen.
Es muß hier betont werden, daß es eine klassische Auffassung der Demokratie gibt, die mit geringen Abweichungen von 500 vor Christi Geburt bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts überall gültig war. Manche Autoren halten sich immer noch an die klassische Auslegung, denn sie allein bietet eine gewisse Klarheit und Deutlichkeit. Deshalb haben auch wir diesen Weg beschritten. Plato, Aristoteles, St. Thomas von Aquin, St. Robert Bellarmin, Juan de Mariana S. J., Alexander Hamilton, John Marshall, James Madison, Gouverneur Morris, N.D. Fustel de Coulanges stimmten alle mehr oder weniger in ihrer Auslegung des Wortes »Demokratie« überein, obwohl man zugeben muß, daß bei einigen der »Gründerväter« Amerikas die Tendenz vorhanden schien, den Begriff der Demokratie zu verengen und ihn nur mit einer ihrer Erscheinungsformen gleichzusetzen, nämlich mit der direkten Demokratie, für welche Einschränkung zu einem Teil der Einfluß Rousseaus verantwortlich ist. Dies, zumindest, ist unser Eindruck, wenn wir Madisons Definition im »The Federalist« (Nr. 10 und 14)17 oder John Adams’ Angriff gegen die Demokratie in seiner A Defense of the Constitution of the United States of America lesen18. Jedoch ist der Fall John Adams’ nicht ganz klar; eine sorgfältige Studie der Werke dieses zweiten Präsidenten Amerikas, der noch konservativer als Madison war, liefert viele Beweise einer bewußten Ablehnung des Gleichheitsprinzips in allen seinen Formen19; auch ist es bekannt, daß er heftige Gewissensbisse wegen seiner Teilnahme am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg hatte, da dieser ideengeschichtlich, infolge der ersten großen europäischamerikanischen Mißverständnisse und Fehlinterpretationen zur Französischen Revolution und deren blutigem napoleonischen Nachspiel beigetragen hatte20. Alexander Hamilton, der konservativste in dieser Gruppe, kritisierte leidenschaftlich die Demokratie in seiner Ansprache vom 21. Juni 1788 (On the Compromise of the Constitution) und auch in der Bundeskonvention am 26. Juni 178721. Es sollte kein Zweifel mehr darüber herrschen, daß die überwiegende Mehrzahl der »Gründerväter«, der Founding Fathers, nicht nur die direkte Demokratie gehaßt und sich ihr entgegengestellt hat, sondern auch, daß sie als strenge Republicans selbst der indirekten Demokratie (dem egalitären Repräsentativsystem) zutiefst kritisch, ja ablehnend gegenüberstanden. Am schärfsten in seiner Kritik war vielleicht Gouverneur Morris, der Lafayette in Paris rundweg heraus erklärte: »I am opposed to the democracy from regard to liberty« – dieselben Worte, die später Bachofen gebrauchte22.
Während der Durchschnittsamerikaner gar nicht so sicher ist, ob die Gründerväter alle wirklich brave Demokraten waren, wird Thomas Jefferson, der dritte Präsident Amerikas, zumeist leichtfertig als Demokrat oder zumindest als Schöpfer der Jeffersonian Democracy (im Gegensatz zu der späteren und echteren Jacksonian Democracy) bezeichnet. Wenn wir jedoch die Demokratie in ihrer direkten sowie indirekten Form betrachten, müssen wir feststellen, daß sein politisches Glaubensbekenntnis alles andere denn demokratisch war. Welches sind aber nun in concreto die Forderungen der Demokratie? Es gibt deren nur zwei: 1. legale und politische Gleichheit für alle, die sich nicht nur vor den Gerichten (Isonomie), sondern besonders in den politischen Funktionen des Bürgers ausdrückt, und 2. »Selbstregierung« (self-government), die in der Herrschaft der Mehrheit (von Gleichberechtigten) besteht. Je nachdem diese »Selbstregierung« durch das Volk oder durch Abgeordnete ausgeübt wird, sprechen wir von direkter oder indirekter Demokratie. Selbstverständlich haben in einer indirekten Demokratie die Abgeordneten die Pflicht, die Ansichten ihrer Wählerschaft getreulich zu vertreten und zu wiederholen; ist dies nicht der Fall, handelt es sich schon eher um eine Republik als um eine Demokratie. Im übrigen haben die Achtung der Rechte der Minderheiten, Redefreiheit und die der Herrschaft der Mehrheit23 auferlegten Einschränkungen nichts mit der Demokratie als solcher zu tun. Dieses sind Forderungen des Liberalismus, und ihre Anwesenheit in einer Demokratie (oder auch in einer Republik) hängt lediglich von der Annahme des liberalen Prinzips ab.
Jefferson war nun aber in Wirklichkeit ein Agrarromantiker, der von einer Republik träumte, die, von einer Elite des Charakters und des Intellektes regiert, sich auf eine Freibauernschaft stützen sollte24. Dies bezeugt deutlich sein Brief an John Adams vom 28. Oktober 1814:
»The natural aristocracy I consider as the most precious gift of nature, for the instruction, the trusts and government of society. And indeed, it would have been inconsistent in creation to have formed men for the social state, and not to have provided virtue and wisdom enough to manage the concerns of society. May we not even say that that form of government is the best which provides most effectually for a pure selection of these natural aristoi into the offices of government?«
Und auf einer anderen Seite desselben Briefes fügt er hinzu:
»Every one by his property, or by his satisfactory situation, is interested in the support of law and order. And such men may safely and advantageously reserve to themselves wholesome control over their public affairs, and a degree of freedom, which in the hands of the canaille of the cities of Europe, would be instantly perverted to the demolition and destruction of everything public.«25
Seine einseitige und unchristliche Ablehnung des städtischen Proletariats und der gesamten Arbeiterklasse war so ausgesprochen, daß es schwer zu verstehen ist, wie er, wenn auch nur vorübergehend, zur erlauchten Würde eines Schutzpatrons des »Common Man« erhoben werden konnte. Diese wenig passende Rolle wurde ihm, einem Sklavenhalter, von der Propaganda während des letzten Krieges zugeschanzt. Schrieb er doch da zum Beispiel:
»The mobs of great cities add just so much to the support of pure government, as sores do to the strength of the human body… I consider the class of artificers as the panders of vice, and the instruments by which the liberties of a country are generally overturned.«26
In seinen späteren Jahren schienen sich seine Ansichten gemildert zu haben; das Wort democratic kommt in seiner Korrespondenz nur ein einziges Mal vor, einmal sprach er sogar von den »schweinischen Massen«, und das Frauenwahlrecht lehnte er immer rundweg ab27. Seine Liebe zur Scholle blieb unverändert, doch seine zutiefst agrarischen Anschauungen waren in seinen jüngeren Jahren mehr betont. In diesem Sinne schrieb er am 20. Dezember 1787 an Madison:
»I think that our governments will remain virtuous for many centuries; as long as they are chiefly agricultural: and this will be as long as there are vacant lands in any part of America. When they get piled upon one another as in the large cities of Europe, they will become corrupt as in Europe.«28
Wie man sieht, waren seine Ansichten selbst über die Möglichkeiten einer Republik sehr beschränkt und von äußeren Umständen abhängig gemacht. Für Frankreich zog er eine konstitutionelle Monarchie der Republik vor. In einem Brief, datiert vom 17. Mai 1792, den er an Washington gerichtet hatte, nannte er sich einen »republikanischen Föderalisten«, und in seiner ersten Antrittsrede als Präsident betonte er, daß er sowohl »Föderalist« als auch »Republikaner« sei.
Erst viel später, als Andrew Jackson im Jahre 1828 als Präsidentschaftskandidat gegen John Quincy Adams, den Sohn John Adams’, auftrat, wurde jener von einigen seiner Anhänger ein »demokratischer Republikaner genannt«. Dies war nötig, als beide sich als Republikaner bekannten. Sein Nachfolger, Martin Van Buren, brüstete sich, wieder Republikaner zu sein, aber in der Folgezeit wurde der Ausdruck »demokratisch« als Parteibezeichnung immer mehr und mehr gebraucht. Immerhin, der Begründer der demokratischen Ideologie des heutigen Amerika ist und bleibt Andrew Jackson (7. Präsident, 1829–1837), dessen Reiterstandbild in Washington vor dem Weißen Hause prangt. In den vier Ecken des Jackson Square aber kann man die Statuen von vier Adeligen sehen, die den Amerikanern in ihrem Unabhängigkeitskampf zu Hilfe eilten, um für die Freiheit, nicht aber für die Gleichheit oder die Mehrheitsherrschaft zu kämpfen: Tadeusz Kościuszko, Baron von Steuben, der Marquis de Lafayette und der Graf Rochambeau. Graf Kazimierz Pułaski, der einzige General, der im Unabhängigkeitskrieg gefallen war, und Baron de Kalb sind anderswo verewigt. Fast unbekannt ist jedoch der Kronzeuge des Gegensatzes zwischen liberaler Freiheit und demokratischer Gleichheit: Charles-Armand Tuffin, Marquis de la Rouërie, dem ich in meinem Leftism (1974) ein langes Kapitel widmete. Er kam als Freiheitskämpfer noch vor Lafayette in die Vereinigten Staaten, verließ Amerika nach Lafayette, war ein persönlicher Freund Washingtons und ein Mitglied des Ordens der Cincinnati. Nach der Rückkehr nach Frankreich sah er bald die Gefahr der demokratischen Tyrannis und organisierte den bewaffneten Aufstand in der Bretagne. Schwer krank starb er versteckt in einem Schloß, wurde heimlich im Park bestattet, doch von den Jakobinern ausgegraben. Der Leichnam wurde geköpft, und sowohl die Schloßherren als auch seine Freunde endeten am Schafott.
Diese besonderen Hinweise auf Amerika haben wir für nötig gehalten, denn die politische und kulturelle Propaganda der Vereinigten Staaten hat nur zu oft ein falsches Bild der amerikanischen Vergangenheit verbreitet, zumeist jakobinische Verfälschungen der amerikanischen Geschichte, die in der Regel von Linkselementen in Umlauf gesetzt wurden.
Diejenigen aber, denen es daran gelegen ist, Klarheit und Ordnung ins politische Denken zu tragen und die Begriffe »Liberalismus«, »Demokratie« und »Republik« methodisch auseinanderzuhalten, haben es in öffentlichen Diskussionen allerdings nicht leicht. In Dokumenten und offiziellen Verlautbarungen kommt ein scholastisches distinguo in diesen Dingen immer als eine Überraschung29. (Leider kann man sich auf solche in den Reden unserer »Staatsmänner« nicht mehr gefaßt machen.) Selten ist sich auch jemand bewußt, daß der wichtigste Unterschied zwischen der festländischen und der angelsächsischen parlamentarischen Tradition in der wichtigen Legierung besteht, die unzertrennlich von der letztgenannten ist: »whiggery« oder Liberalismus im wirklichen Sinn des Wortes. Wenn die große Mehrzahl der Amerikaner und Engländer über »Demokratie« reden – und zu einem gewissen Grade muß man da auch die Schweizer einbeziehen —, schließen sie in ihrem Begriff der Demokratie das liberale Element ein, und dies trotz der Tatsache, daß Demokratie und Liberalismus sich auf zwei völlig verschiedene Probleme beziehen. Die Demokratie beschäftigt sich mit der Frage, WER herrschen soll, während sich der Liberalismus, unabhängig vom Rechtstitel des oder der Herrschenden, um das WIE des Regierens kümmert, denn sein Interesse ist die Freiheit des Regierten und nicht die Rechtstitel der Regierenden30. Eine Demokratie kann völlig illiberal sein31; der Volstead-Act, die Rechtsgrundlage des amerikanischen Alkoholverbotes (1920–1933), kam auf streng demokratischer Basis zustande, stellte aber zugleich einen unerhörten Eingriff in das Privatleben der Bürger dar. Der Faschismus, der nationale und internationale Sozialismus machten zu verschiedenen Zeiten den Anspruch, wesenhaft demokratisch zu sein, ein Anspruch, der nach ernstlicher Untersuchung in richtiger philosophischer und historischer Beleuchtung viel besser begründet ist, als es manche zugeben wollen. So ist es zum Beispiel gar nicht unwahrscheinlich, daß die Mehrzahl der Italiener Mussolini in der ersten Hälfte der dreißiger Jahre ihre moralische Unterstützung gewährten. Auch der Anspruch der Sowjets auf die demokratische Etikette ist nicht ein schlaues politische Manöver der letzten Jahre, sondern Teil einer Terminologie, die schon von Lenin eingeführt und von Stalin während der zwanziger Jahre fortgesetzt wurde32. Eine »volksdemokratische« Republik gab es schon im Jahre 1939 unter russischer Ägide – die finnische volksdemokratische Republik unter Otto Kuusinnen mit dem Sitz in Terijoki. Wenn wir die Definition der Demokratie des heiligen Thomas annehmen (De Regimine Principum, I. 1.), werden wir sehen, daß die Diktatur eines Proletariats, das die Mehrheit in einem Land besitzt, viel demokratischer ist als die amerikanische Verfassung, in der, so abweichend von den heiligen Büchern des Kommunismus, weder das Wort »Demokratie«, noch auch der Begriff »Republik« erwähnt ist. Lediglich den Teilstaaten wird eine »republikanische Verfassung« vorgeschrieben. Auch die Declaration of Independence spricht weder von der Demokratie noch von der Republik. Eine American Revolution hatte nie stattgefunden.
Anderseits aber kann man sich einen absoluten Herrscher vorstellen, einen autokratischen Monarchen zum Beispiel, der durch und durch ein Liberaler ist, wiewohl er bei bestem Willen nie ein Demokrat sein kann. Es ist nicht nur theoretisch möglich, sondern auch tatsächlich geschehen, daß 51 Prozent einer Nation ein totalitäres Regime errichten, alle Andersdenkenden unterdrücken und immer noch den berechtigten Anspruch erheben, eine Demokratie zu bilden, während ein gutmütiger Diktator sich einige Vorrechte einräumt, im übrigen aber darauf verzichtet, in das Privatleben der Bürger einzugreifen. Es kann gar nicht bezweifelt werden, daß der amerikanische Kongreß oder die französischen Kammern Gesetze und Verfügungen erlassen und sich Rechte anmaßen, die den blassen Neid eines Ludwig XIV. oder eines Friedrich II. von Preußen erweckt hätten. Es komme uns da niemand mit der billigen Ausrede, daß »eben damals die Zeit nicht danach war«. Der Circulus vitiosus negativer geschichtlicher und soziologischer Entwicklungen besteht gerade darin, daß nicht nur die Zeit bzw. der Zeitgeist die Einrichtungen beeinflußt, sondern daß auch die Einrichtungen der Zeit ihren Stempel aufdrücken. Dabei ist es aber das letztere Moment, das wahrhaft das bestimmende ist. Zu wirklichen Einstürzen kommt es nur, wenn die Institutionen zerstört werden, wenn die Institutionen an sich selbst irre werden und dann freiwillig oder unfreiwillig abdanken.
Hier aber gilt es noch zwei weitere Begriffe zu umschreiben, Begriffe, die hier im Texte nicht immer verwendet werden, aber unsichtbar bestimmend mitwirken: die »Schlagwörter« links und rechts. Zweifellos handelt es sich hier nur dann um inhaltlose Schlagwörter, wenn wir bedenken, wie »links« und »rechts« in täglicher Diskussion, in der Presse, in Parlamenten, im Radio behandelt werden. Wie vertraut sind wir schon mit dem dummdreisten Ausdruck: »Wir sind gegen die Tyrannei, gleichgültig, ob sie von links oder rechts kommt!« – oder: »Die Extreme berühren sich; extrem links oder extrem rechts, das kommt natürlich auf dasselbe heraus!« Dabei scheint es niemandem noch aufgefallen zu sein, daß echte Gegensätze auch in der Übersteigerung sich nie berühren. Es ist richtig, daß der Nationalsozialismus und der Kommunismus einander ähnlich sind, aber sind sie Gegensätze? Ist der »Gegensatz« zu einem Schuhfabrikanten ein anderer Schuhfabrikant oder etwa vielleicht der Propagandist einer Barfüßlerbewegung? Man muß zwischen Gegnern (Feinden) und Konkurrenten scharf unterscheiden. Ein Hitler und ein Stalin waren nur Konkurrenten, ein Hitler und ein Pius XI. aber echte Gegner.
Wenn nun Worte in unserer abendländischen Symbolik etwas Konkretes zu bedeuten haben, dann hat der Links-Gedanke in seiner richtigen Normierung einen ausgesprochen satanischen Aspekt: den luziferischen Stolz in der Identifizierung mit dem Verdammten. Der Links-Gedanke setzt ein absolutes Nein der göttlichen Schöpfung im allgemeinen und der christlichen Ordnung im besonderen entgegen33. Du passé faisons table rase, heißt es doch so anmutig in der französischen Urfassung der Internationale, die sich gerade an die Verdammten, die »Verfluchten der Erde« richtet. Dieser Aufstand der Linken wird im Zeichen eines Turmbaus von Babel gegen Gott und damit auch das Ebenbild Gottes mit wahrem Fanatismus betrieben. Es soll ein Paradies hier auf Erden »angelegt« werden, ein utopischer Grundriß ist schon dafür gezeichnet, und nun beginnt auch gleich das mechanische Reglementieren; der Mensch ist ja für diese Jünger des Nichts lediglich Zahl (»Wähler«), Steuerobjekt, Produzent, Konsument, Chromosomenträger, linguistisch bedingter Volksgenosse, Klassenrepräsentant… wenn nicht Zwangsarbeiter, Genickschußempfänger und Krematoriumfutter.
Die natürliche Ergänzung zur Linken bildet dann die »Reaktion«, die sich gedankenlos mit negativem Vorzeichen an der Linken ausrichtet. Daher auch das unheilvolle Wirken jener »Konservativen«, die sich vor 1933 für Herrn Hitler begeisterten, weil er »im Gegensatz« zu den Marxisten »national« war. »Reaktion« ist eben nichts als invertiertes Linkstum, als die Kehrseite der Medaille, des sinistrismo. Den wirklichen Gegensatz zur »Linken«, die ein Weg zum Nichts über die Knechtschaft ist, müssen wir in der »Rechten« sehen. Und »rechts« im wohlverstandenen Sinne heißt für das Recht einstehen, für das Rechte, das Richtige, die Gerechtigkeit, das Rechtliche, das Redliche – für das wirklich Natürliche, für Liebe, Freiheit, Würde und Ehrfurcht vor dem Ewig-Guten im Vatererbe. Zweifellos steht der Christ im Sinne dieser von uns etwas willkürlich festgelegten Terminologie rechts. Er steht mit Gott und gegen das Nichts, mit der Freiheit und gegen die Knechtschaft, mit der Vielfalt der Schöpfung und gegen die öde Einförmigkeit des Nämlichen und Gleichen.