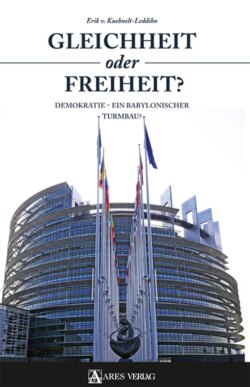Читать книгу Gleichheit oder Freiheit? - Von Kuehnelt-Leddihn Erik - Страница 12
4.Die Weissagungen der Jahrhundertmitte
ОглавлениеUnter denen, die von den Schaubildern der modernen Tyrannis verfolgt wurden, ragt ganz besonders Don Juan Donoso Cortés, Marqués de Valdegamas, hervor. In der Genauigkeit seiner Berechnungen und Erwartungen wurde er nur noch von Alexis de Tocqueville übertroffen. In seiner berühmten Rede vor dem Parlament in Madrid am 4. Januar 1849 entwarf dieser große Prophet ein düsteres Bild von der Zukunft des Abendlandes. Die Gedankengänge dieses konservativ-liberalen Katholiken150 haben vieles mit denen de Tocquevilles, Joseph de Maistres und selbst Koestlers gemein. Mit dem normannischen Adeligen teilte unser Marquis die Angst vor den Auswirkungen der modernen Verkehrsmittel, mit de Maistre und Koestler verbindet ihn seine Theorie über die Beziehungen zwischen den »inneren« und »äußeren« Kräften, dem »Yogi« und dem »Kommissar«. Er drückte sich etwas anders aus, denn er sprach von den Druckverhältnissen in den religiösen und politischen Barometern, doch die Schau war dieselbe. Für Donoso Cortés war das Christentum eine Religion der Freiheit, und jede Schwächung dieser religiösen Kraft mußte notwendigerweise ein Zunehmen des »Druckes von außen« herbeiführen. Deshalb darf uns auch sein Pessimismus nicht wundernehmen. Die politische Lage einer Betrachtung unterziehend, sagte er damals am Anfang seiner Rede:
»Señores, meine Worte klingen vielleicht erschreckend, aber man darf vor solchen Worten nicht zurückscheuen, wenn sie der Wahrheit Ausdruck verleihen, – und ich habe beschlossen, sie auszusprechen: Die Freiheit ist tot! Sie wird nicht auferstehen, weder nach drei Tagen noch nach drei Jahren, vielleicht nicht einmal nach drei Jahrhunderten…
Der Urgrund aller Ihrer Irrtümer, meine Herren (sich der linken Seite der Kammer zuwendend), besteht darin, daß Sie einfach nicht wissen, in welche Richtung sich die Welt bewegt. Sie glauben, daß die Welt und die Zivilisation fortschreiten, während beide lediglich Änderungen unterstehen. Die Welt, meine Herren, geht mit raschen Schritten dem größten und schwärzesten Despotismus seit Menschengedenken entgegen. Dies ist das Ziel unserer Zivilisation, dies ist das Ziel der Welt! Man braucht kein Prophet zu sein, um diese Dinge vorauszusagen. Für mich genügt es, diesen schauerlichen Irrgarten menschlichen Geschehens von dem einzig wahren Gesichtspunkt aus zu betrachten – von den Höhen der katholischen Religion.«151
Nun begann der Redner seine Theorie der beiden Barometer zu erklären; dann berührte er den Grundgedanken der christlichen Ethik und fügte eine kritische Zergliederung der Geschichte im Sinne seiner Theorie hinzu. Er bestand darauf, daß die Reformation den Aufstieg der absoluten Monarchen in ganz Europa begünstigt hatte; diese gekrönten Autokraten führten dann stehende, bis auf die Zähne bewaffnete Heere ein152. Was aber sind Soldaten, wenn nicht »Sklaven in Uniform«? Und das war noch nicht das Ende. Das religiöse Barometer sank immer weiter und das politische Barometer hörte nicht auf zu steigen. Und welche neue Einrichtungen wurden dann geschaffen?
»Die Regierung sagte: Wir haben eine Million Arme. Das ist nicht genug; wir brauchen mehr; wir brauchen eine Million Augen; und so schufen sie die Polizei… und mit der Polizei eine Million Augen. Und nun stieg das politische Barometer erst recht und die politische Unterdrückung nahm zu. Sie nahm zu, da trotz allem das religiöse Barometer immer weitersank.
Die Regierungen, meine Herren, waren mit ihrer Million Arme nicht zufrieden; sie waren auch nicht zufrieden mit ihrer Million Augen. Sie wollten eine Million Ohren. Und so erfanden sie die Zentralisierung der Verwaltung.«153
Aber auch dies brachte das stete Fallen des religiösen Barometers nicht zum Stehen. Es fiel und fiel. Die Regierungen waren sich bald darüber einig, daß eine Million Arme, eine Million Augen und eine Million Ohren nicht genug seien. Sie bestanden darauf, daß sie überall zu gleicher Zeit anwesend sein müßten. Und da wurde zum Glück der Telegraph erfunden. Schade, daß der Marqués de Valdegamas den Lautsprecher am Dorfplatz mit der Stimme des ›Führers‹ nicht mehr erleben konnte!
Im Verlaufe seiner weiteren Darstellung des gegenseitigen Verhältnisses von Regierung und Religion hob Donoso Cortés hervor, daß lediglich eine religiöse Wiederbelebung den wachsenden politischen Despotismus in seine Schranken weisen könnte, doch erschien ihm ein Neuaufleben des Glaubens unwahrscheinlich. Schließlich sagte er:
»Noch etwas müssen Sie in Betracht ziehen, meine Herren! Im Altertum war die Tyrannis barbarisch und erbarmungslos, aber dieser Despotismus war physisch begrenzt, da alle Staaten klein waren und internationale Beziehungen kaum existierten. Daher gab es in der Antike außerhalb Roms keine Tyrannis großen Stils. Wie anders jedoch, meine Herren, ist die Lage heute! Die Wege für eine gigantische, kolossale, universelle und allumfassende Tyrannei sind geebnet; es gibt keine physischen Hindernisse mehr, da das Dampfschiff und die Eisenbahn alle Grenzen verwischt haben, weil es dank dem Telegraphen keine Entfernungen mehr gibt; und es gibt auch keine moralischen Hindernisse mehr, weil die Seelen geteilt sind und jeglicher Patriotismus verschwunden ist. Sagen Sie mir, ob ich daher nicht recht habe, mich um die nächste Zukunft der Welt zu sorgen; sagen Sie mir, ob ich mich nicht mit der grundlegendsten Frage befasse, wenn ich dieses Problem behandle.«154
Auch hier, wie bei de Tocqueville, finden wir einen kleinen Irrtum in der Berechnung, der sich jedoch nur auf einen Zeitpunkt und nicht auf das Wesentliche der Frage bezieht: Donoso Cortés erwartete mit Recht das Ende des (geographischen) Patriotismus und den Aufstieg eines wurzellosen Internationalismus, doch finden wir in seinen Berechnungen keinen Hinweis auf die Zwischenstufen in der Form eines begrenzten Kollektivismus, wie es der ethnische oder biologische Nationalismus ist. Seine Augen sind einzig auf eine weltweite Tyrannis gerichtet. Seine Rede an das Parlament im folgenden Jahr zeigt deutlich, daß er ganz bestimmte Befürchtungen hegte. Wir werden später noch darauf zurückkommen155.
Während Donoso Cortés die Grundlage für die kommende Tyrannis mehr im »Fortschritt« als in der Demokratie als solcher erblickte, folgte Jacob Burckhardt getreuer den Anschauungen Platos. Er sagte:
»Ganz besonders leicht abdizieren Demokratien. In Hellas machen sie den, welcher ihre Aristokratie gebrochen oder verjagt hat, zum Tyrannen und setzen dann voraus, daß ein solcher dauernd ihren Willen vollziehe.«156
Der amerikansiche Staatsmann Fisher Ames (1758–1808), der die Demokratie in noch dunkleren Farben malte und zudem erwartete, daß die Demokratien in Militärdiktaturen ausarten würden, hatte schon zu einem früheren Zeitpunkt erklärt:
»It has never happened in the world, and it never will, that a democracy has been kept out of the control of the fiercest and most turbulent spirits in the society; they will breathe into it all their own fury, and make it subservient to the worst designs of the worst men.«157
Und an einer anderen Stelle heißt es in seinem Buch:
»However discordant all the parts of a democracy may be, they all seek a centre, and that centre is the single arbitrary power of a chief.«158
Walter Bagehot, dieser geniale Kenner des Bonapartismus, ließ Cäsar folgende Worte an die »zahlenmäßige Mehrheit der Bürger Roms« richten:
»›I am your advocate and your leader: make me supreme, and I will govern for your good and in your name.‹
This is exactly the principle of the French Empire. No one will ever make an approach to understanding it who does not separate it altogether and on principle from the despotism of feudal origin and legitimate pretensions. The old monarchies claim the obedience of the people upon grounds of duty; they say they have consecrated claims to the loyalty of mankind; they appeal to conscience, even to religion: but Louis Napoleon is a Benthamite despot; he is for the ›greatest happiness of the greatest number‹; he says, ›I am where I am because I know better than any one else what is good for the French people, and they know that I know better.‹ He is not the Lord’s anointed, but he is the people’s agent.
…A democratic despotism is like a theocracy: it assumes its own correctness. It says: ›I am the representative of the people; I am here because I know what they wish, because I know what they should hate.‹ As Cavaignac once said, ›A government which permits its principles to be questioned is a lost government.‹ All popular discussion whatever which aspires to teach the government is radically at issue with the hypothesis of the Empire; it says that the Caesar, the omniscient representative, is a mistaken representative, that he is not fit to be Caesar.«159
Die demokratische Essenz der modernen Diktaturen ist auch von zahlreichen anderen Autoren hervorgehoben worden160. Sowohl Hitler als auch Mussolini betonten den demokratischen Charakter ihrer Systeme mit bewundernswerter Beharrlichkeit161. Auch Proudhon gab sich über den tyrannischen Kern der Demokratie keinen Täuschungen hin; dieser Frühsozialist, dem die schrankenlose Begeisterung der heutigen Linken für den Common Man weitgehend fehlte, schrieb:
»Mais, en raison de son ignorance de la primitivité des ses instincts, de la violence de ses besoins, de l’impatience de ses désires, le peuple incline aux formes sommaires de l’autorité. Ce qu’il cherche, ce ne sont point des garanties légales, dont il n’a aucune idée et ne conçoit pas la puissance; ce n’est point une combinaison de rouages, une pondération de forces, dont pour lui-même il n’a que faire; c’est un chef à la parole, duquel il se fie, dont les intentions lui soient connues et qui se dévoue à ses intérêts. A ce chef, il donne une autorité sans limites, un pouvoir irrésistible. Le peuple, regardant comme juste tout ce qu’il juge lui être utile, attendu qu’il est le peuple, se moque des formalités, ne fait aucun cas des conditions imposées aux dépositaires du pouvoir. Prompt au soupçon et à la calomnie, mais incapable d’une discussion méthodique, il ne croit en définitive qu’à la volonté humaine, il n’éspère qu’en l’homme, il n’a confiance qu’en ses créatures, in principibus, in filiis hominum; il n’attend rien des principes, qui seuls peuvent le sauver; il n’a pas la religion des idées.«162
Sodann beschrieb er die in den demokratischen Kräften ruhenden Grundlagen der kaiserlichen Autokratie und erinnerte den Leser, daß
»ce qu’il y a curieux, c’est que cette démocratie était sincèrement convaincu de son libéralisme, et qu’elle se flattait de représenter l’égalité et le progrès.«163
Wie tief aber diese Sehnsucht nach einer persönlichen Führung nicht nur in der Demokratie, sondern auch im Sozialismus verwurzelt ist, wird uns klar, wenn wir H. van Kols (»Rienzi«) Aufschrei in »Socialisme en Vrijheit« lesen:
»A ceux qui sont appelés à nous conduire, nous promettons fidélité et soumission et nous leurs disons: ›Hommes ennoblis par la choix du peuple, montrez-nous le chemin, nous vous suivons.‹«164
Unter den modernen Autoren hat Max Weber das Thema des »charismatischen Führers« zum Unterschied von den streng nichtdemokratischen »Herrschern« hervorragend behandelt165. Jedoch war er bei weitem nicht der einzige, der sich mit dieser Materie auseinandersetzte166. Es haben auch andere diese volksverbundenen Diktatoren erfolgreich unter die Lupe genommen; man erinnere sich nur an Burckhardts terribles simplificateurs, an seinen »schönen, großen Mann mit den Talenten eines Unteroffiziers«167. Auch Alexandre Vinet fürchtete »cette odieuse combinaison de la souveraineté populaire et du pouvoir paternel, cette absorption de toutes les libertés et de la civilisation elle-même dans une seule liberté, celle d’une faction ou d’un système…«168.
Diese alpdruckhaften Erwartungen des neunzehnten und des frühen zwanzigsten Jahrhunderts waren nicht aus der Luft gegriffen. Schon Aristoteles wußte nur zu genau, daß Tyrannen als wackere Verteidiger der unteren Klassen gegen die wohlhabenden und unvolkstümlichen Minderheiten (Adel, Plutokratie etc.) auftreten können169. Diese Tyrannen müssen, um einen amerikanischen Ausdruck zu benützen, regular fellows (Göring: Rechte Kerle!) sein, und wie wir des öfteren wiederholt haben, müssen sie die Gabe zu führen, nicht zu herrschen haben. In dieser wie auch in manch anderer Beziehung passen sie restlos in das demokratische Schema hinein, ein Umstand, den selbst der frühere Rektor der Harvard-Universität, Charles Eliot, nicht hätte ableugnen können170. Präsident Wilsons Begriffsbestimmung eines demokratischen Führers war, in der Tat, wesensmäßig dieselbe wie die eines totalitären Diktators171. Wilsons Auffassung deutet auf eine vollkommene Verbundenheit des Führers mit dem Volke sowohl als auch mit dem Zeitgeist hin; sie bedingt eine gewisse, wenn auch unbewußte Schlauheit und Geriebenheit, jedoch auch einen Mangel an Originalität. Je enger aber die Zusammenarbeit zwischen Führer, Volk und Zeitgeist, desto geringer ist auch das Ausmaß an persönlicher Freiheit, die ohne Spannungen und Gegensätze kaum denkbar ist. Zum Schluß steht dann das Bild des erfolgreichen Parteiführers, wie es uns Lord Brougham, der selbst ein Mann der »Linken« war, gezeichnet hat:
»It is, if possible, worse in the case of there being no division of parties, and all, or nearly all, the people inclining one way. The popular chief in such a case is armed with the power of a tyrant, without feeling any of the tyrant’s dread either of the public indignation expressed by way of censure, or of the same indignation breaking out in acts of violence.«
Und dann setzt er über den »popular chief« noch hinzu:
»While his power continues, however, his tyranny is less tolerable than that of any despot; it leaves no escape to its victim, and no redress or consolation under oppression.«172
Dennoch hat Max Weber recht mit seiner Behauptung, daß diesen unoriginellen und doch »charismatischen« Führern etwas Magisches zu eigen ist. Nicht nur Hitler, sondern vielleicht auch Antonio Conselheiro, der halbverrückte »Ratgeber« der ekstatischen, hinterwäldlerischen Revolutionäre Brasiliens173, waren mehr als einfache Verkörperungen der Massen und daher »geborene Führer«. Durch sie wird man unwillkürlich an Goethes Beschreibung des dämonischen Menschen erinnert:
»Am furchtbarsten erscheint aber dieses Dämonische, wenn es in irgendeinem Menschen überwiegend hervortritt. Während meines Lebens habe ich mehrere teils in der Nähe, teils in der Ferne beobachten können. Es sind nicht immer die vorzüglichsten Menschen, weder an Geist noch an Talenten, selten durch Herzensgüte sich empfehlend; aber eine ungeheure Kraft geht von ihnen aus, und sie üben eine unglaubliche Gewalt über alle Geschöpfe, ja sogar über die Elemente, und wer kann sagen, wie weit sich solche Wirkung erstrecken wird? Alle vereinten sittlichen Kräfte vermögen nichts gegen sie; vergebens, daß der hellere Teil der Menschen sie als Betrogene oder Betrüger verdächtig machen will, die Masse wird von ihnen angezogen. Selten oder nie finden sich Gleichzeitige ihresgleichen, und sie sind durch nichts zu überwinden als durch das Universum selbst, mit dem sie den Kampf begonnen; und aus solchen Bemerkungen mag wohl jener sonderbare, aber ungeheure Spruch entstanden sein: Nemo contra deum nisi deus ipse.«174
Der Hinweis auf die Massen, die sich von diesen Führern angezogen fühlen, während intelligentere Menschen sie ablehnen, ist höchst bezeichnend. Besonders gefährlich ist aber der Einfluß dieser vom Dämonischen getriebenen Führer, wenn sie, um einen Ausdruck de Tocquevilles zu benützen, fausses idées claires verkünden. Das Resultat ist dann nur zu oft Irving Babbitts efficient megalomaniac, der darauf ausgeht, to improve the mystery of murder. All dies haben wir in der jüngsten Vergangenheit nur zu deutlich miterlebt.