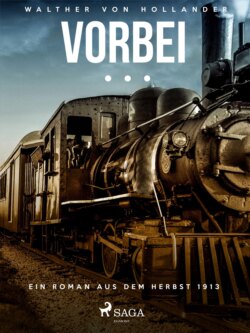Читать книгу Vorbei ... - Walther von Hollander - Страница 8
5
ОглавлениеDie Villa Grossmanns am anderen Ende der Stadt war die grösste und schönste Villa in B. Sie hatte jahrelang leer gestanden, einmal weil niemand fünfzehn Zimmer brauchte, niemand den riesigen Stall hinten im Garten, niemand den grossen, verwilderten Garten, der am Stadtwald lag und mit Buchen und Akazien in ihn einmündete. Dann aber vor allem, weil die Villa ein Unglückshaus war. Sie hatte früher dem Fürsten L. gehört, einem Schwager des alten Barons Hagendörp, der als schwer nervenkranker Mann nach B. zog und immer seltsamer und schrulliger wurde, so dass man es als Glück bezeichnen konnte, dass er heimlich nach Afrika ausrückte und im Burenkriege, als Freiwilliger auf der Seite der Buren kämpfend, fiel. Von seiner Frau, der Fürstin Clementine L., hatte es der Fabrikant Eggeling mit allen Möbeln und vielen Erinnerungsstücken gekauft. Ein Jahr danach brannte das Dachgeschoss aus, wobei die Frau des Fabrikanten in den Flammen umkam. Eggeling starb wenige Monate später an den Folgen des Nervenschocks. Sein Sohn, der Leutnant Eggeling, wurde noch im gleichen Jahre von einem Pferde abgeworfen und so verletzt, dass er jahrelang gelähmt blieb und schliesslich starb. Noch nicht genug: eine Tochter, die das Haus bewohnte, wurde tuberkulös und starb ganz schnell. Die zweite Tochter floh nach Italien. Sie wollte nichts mehr von diesem Haus wissen, nichts von B.
So stand es leer, bis in diesem Frühjahr Herr Grossmann erschien, als ein schwerreicher Mann, der B. zu seinem Sommersitz ernannte und, da er beschlossen hatte, seine Vaterstadt in den Kreis der aufblühenden Städte Deutschlands hineinzuziehen, einen Teil seiner Geschäfte hierher verlegte. Die Villa war die teuerste, die man in B. kaufen konnte, und wäre nicht unten am Böttchermarkt, an der Grenze zum Arbeiterviertel, das Ladengeschäft des verstorbenen Herrn Grossmann gewesen (A. Grossmann Nachf. genannt), so hätte Grossmann sicher in vielen alten Familien von B. Zutritt gehabt. Aber so nahmen die alten Familien keine Notiz von ihm.
In dieser Nacht war bei Grossmann noch lange Licht. Oben im Büro arbeitete der Privatsekretär Dr. Boose mit der Berliner Sekretärin Fräulein Fley. Man hörte ihn, durch das offene Fenster, diktieren. Es war von einer Belebung der Handwerksbetriebe in B. die Rede, von tausend Anschlüssen der Kanalisationsbranche, von einigen Kilometern Röhren. Unten sass der Bürgermeister Koste, ein langnasiger Mann mit Brille und Glatze, ein schüchterner Mensch, der alles, was ihm vorgetragen wurde, zunächst ablehnte. Ferner der Bankdirektor Wiedenbein, ein freundlicher Mann mit Specknacken, Eisenbahndirektor Schwarz, der eine optimistische weiche Bürste auf dem Kopf trug und auch sonst ein humorvoller und aufrechter Mann zu sein glaubte. Es war Rechtsanwalt Klusemann erschienen, einen schwarzen Schnurrbart zu beiden Seiten des Mundes, einen hohen Kragen um den Hals, eine Schmetterlingsschleife davor, ein Junggeselle, wie er im Buche stand, Tennisspieler, Kartenschläger, Vortänzer auf dem Bürgerball, Vorsitzender im Ruderklub Fortuna 06, und natürlich fehlte auch Leutnant a. D. von Wüstefeld nicht, zwei Zentner netto, Besitzer der Kalkwerke zu B., Kassenwart im Gustav-Adolf-Verein, Vorsitzender im Klub der Hagenbergfreunde (der die Wegweiser und Aussichtsbänke in den Hagenbergen zu pflanzen hatte), und nach Grossmann der bedeutendste Steuerzahler.
Diese Herren, die sich untereinander das „engere Komitee“ nannten, sassen in der Diele des Grossmannschen Hauses um den Marmorkamin, in dem ein herbstliches Feuer brannte. Sie sassen weit zurückgelehnt in den riesigen Sesseln, die aus der Einrichtung des Fürsten L. stammten. Sie tranken mit Kennermiene die Grossmannschen Weine und rauchten Henry Clay, die Modezigarre von damals, das Stück zu zwei Mark. Sie sprachen von den Schwierigkeiten, die einerseits der Kreis um Rittmeister von Schwiering machen würde, andererseits die Opposition im Stadtparlament unter dem Lagerverwalter Ohlroch vom Konsumverein. Auch von den Hagendörps war die Rede. Sie hatten zwar, wie Wüstefeld ausführte, keine Finanzkraft mehr, aber bei etwas moderneren Grundsätzen der Bewirtschaftung konnte man aus den Gütern wieder erhebliche Beträge herauswirtschaften.
Vor allem aber hatten sie eine gesellschaftliche Macht. Sie waren — hier brauchte es keiner zu sagen, denn jeder wusste es — durch die Fürstin L. mit dem regierenden Fürsten verschwägert.
Wüstefeld, der dicke Kalkwerksbesitzer, machte den Vorschlag, ob es nicht gut wäre, das Kanalisationsprojekt zunächst zurückzustellen, da noch die meisten Hausbesitzer an den Kosten der Elektrizität zu knabbern hätten. Wenn man lediglich die Elektro-Aktien in die Hotel-A.G. einbrachte ...
Grossmann klingelte seinem Sekretär, Herrn Dr. Boose. Herr Dr. Boose kannte ja die Herren der Hotel-A.G. Hatte der Wüstefeldsche Vorschlag irgendeine Aussicht? Objektiv, bitte! Wie notierte Hotel-A.G.? 137? Und Elektro konnte man zu 96, ja wenn man mit Herrn Wiedenbein gut stand, zu 94 haben. Dr. Boose, dessen Kragen den Klusemannschen noch um einen Zentimeter schlug und der den einzigen Hornkneifer von B. besass, setzte mit einem aufdringlichen Lächeln, das er für humorvoll hielt, die Angelegenheit auseinander. Man konnte natürlich den Herren in Berlin die Elektro-Aktien allein anbieten. Warum aber man in Berlin das Elektrizitätswerk von B. kaufen sollte — und was anderes bedeutete ja die Übernahme der Aktien nicht — das war nur schwer zu verstehen. Für eine richtige Erschliessung der Stadt sei die Holding-Gesellschaft interessiert. Elektrizität, Kanalisation, die Erbauung eines Kurhauses sodann, später die Erschliessung der Heilmoore im Krötengrund ... wenn man eine solche Reihe von Unternehmnungen anzubieten hatte, dann ... ja, dann ... läge die Sache schon etwas anders.
Gut geschossen. Mitten in Wüstefelds Portemonnaie getroffen. Es konnte doch sein, dass die Gesellschaft schliesslich auch das Kalkwerk zu einem guten Preis übernahm. „Gut also“, sagte er und erhob sich. „Man wird die Sache vorwärtstreiben. Man kann durch Fortschritt nur gewinnen, nicht wahr?“
„Wir werden die Sache überschlafen“, unterbrach Grossmann. „Wir werden uns vor Experimenten und Spekulationen hüten. Wenn ich an B. denke, so tue ich es nicht aus Geldgründen, sondern aus Anhänglichkeit an meine Vaterstadt. Geld verdienen kann ich auch anderswo.“
Niemand antwortete, denn niemand glaubte ihm. Aber seine Worte hatten Eindruck gemacht. Man kam an diesem Abend nicht mehr weiter. Man trank noch schnell im Stehen einen Whisky Soda. Man kam wieder auf kleine Stadtgeschichten. Die Hagendörps hatten sich geweigert, die Strassenbauanteile für die Chaussee zu zahlen. Die fürstliche Hofkammer drohte mit einem Prozess. Die Fürstin L., die Tante des jetzigen Majoratsherrn, wurde erwartet, um die Sache ins reine zu bringen. Zum Schluss tischte Klusemann noch ein Gerücht aus Braunschweig auf. Er hatte dort ja oft zu tun, und man hatte ihm erzählt, dass Hans Adalbert eine Liaison mit einer Theaterdame hatte. Einer Tänzerin, setzte Klusemann aus eigener Phantasie hinzu, und er behauptete, dass diese Tänzerin, eine Tscherkessin, durch ihren Aufwand die ganze Stadt in Staunen setze.
Damit war der Gesprächsstoff erschöpft. Die Herren gingen, man hörte noch lange den Bass Klusemanns und die Kastratenstimme Wüstefelds ...
Der Bürgermeister sprach auf Schwarz und Wiedenbein ein. Sie sollten mal ihre Meinung sagen, ob dieser Grossmann ein Schurke sei oder nicht. Er, Koste, habe den alten Klempner Grossmann nicht gekannt. Mochte ja eine ganz ehrenhafte Familie sein. Warum aber, wenn Grossmann einfach Geld anlegen wollte, kam er hierher, und wenn er hierher kam, warum gab er sein Geld nicht einfach zu Herrn Wiedenbein in die Bank, der es pflichtgemäss und zu soliden Sicherheiten weitergegeben hätte? Wenn er aber mit Kanalisationen Geld verdienen wollte, warum liess er nicht die Stadt aus dem Spiel, warum berannte er den Magistrat, der ja auch bisher seine Pflicht getan hatte, mit immer neuen Projekten zum Wohle der Bürger? ...
In Grossmanns Hause aber hatte Doktor Boose eine ernste Unterredung mit Grossmann. Das Telefon würde gleich läuten. Die Herren von der Hotel-A. G. wussten keinen Rat. Die Banken hatten die Rückzahlung der kurzfristigen Kredite, die bisher immer schweigend verlängert wurden, verlangt. Man musste irgendwoher schnell etwa eine Million bekommen. Die Lage war also ziemlich schwierig, aber Herr Grossmann würde sie schon meistern. Damit verabschiedete sich der Sekretär. Grossmann musste sich klar werden. Und da er niemanden hatte, dem er vertrauen konnte, so musste er mit sich selbst sprechen. Er sprach ernst und sachlich auf sich ein. Er nannte sich dabei beim Vornamen. Ferdi, sagte er, oder Ferdinand. Seine Mutter hatte ihn Ferdi genannt und seine Frau, die längst verstorben war. „Ferdi“, sagte also Grossmann und begann sich auszuziehen. „Du musst ein bisschen aufpassen. Es ist bisher alles ganz richtig gewesen. Wenn ich in Berlin geblieben wäre, wäre ich verloren. Müsste ja und amen zu der Halsabschneiderei der Finanziers sagen, aber hier habe ich Möglichkeiten. Trotzdem darf ich nicht stur sein. Immer nur auf das eine starren.“
Er blieb am Fenster stehen. Der Viertelmond war über den Hagenbergen erschienen. Im nahen Stadtwald begannen die Käuzchen zu rumoren. Das Laub raschelte im Wind. Und da ... wirklich, er hörte jetzt von fern die Hirsche schreien. Er erinnerte sich, wie er als Knabe mit anderen Jungens der Bürgerschule unten an der Villa des Fürsten L. vorbeigekommen war auf dem Wege zum Hirscheschreien und wie er den Fürsten L., den er immer so beneidete, in seinem Garten herumrennen sah wie in einem Gefängnis. Auf und ab oder um den Rasenplatz herum, ein Gewehr auf dem Rücken. Warum rannte er mit seinem Gewehr im Garten herum? Jetzt wusste es Grossmann: der Fürst war verrückt gewesen, und wenn er in die Luft schoss, so glaubte er auf seine Gegner zu schiessen, und als er in den Burenkrieg zog, so war das, weil die Hagendörps eine englische Urgrossmutter hatten und seine Frau, die ihn gefangen hielt, eine Hagendörp war und er deshalb die Engländer hasste. Nein, er war wohl nicht zu beneiden gewesen, der alte Fürst L. Aber der kleine Schulknabe Grossmann hatte damals gedacht, wenn man Geld hat, eine Villa, wenn man ein Fürst ist, dann ist alles gut, und die Welt ist weit und schön. Und jetzt begann er zu ahnen, dass die Welt nach oben zu in bestimmter Weise immer enger wird. Je mehr man erreicht, um so mehr gibt man von sich her, um so mehr muss erreicht werden. Zum erstenmal verstand er das. Zum erstenmal in seinem Leben hatte er einen kleinen Zweifel, ob es sich denn wirklich lohnt, all die die Anstrengungen zu machen, um nach oben zu kommen.
Gut, dass in diesem Augenblick das Telefon ging. Dass der Berliner Direktor am Apparat war. Dass es ganz klar wurde, man musste um das Erreichte kämpfen oder ganz von vorn anfangen. Los also.
Er sprach schnell, sachlich, hell. Was er sagte, war richtig und geschickt. Er beruhigte nicht nur den Partner in Berlin, er beruhigte sich selbst.
Und wer wollte ihn kaputt machen, wenn er sich selbst immer Kraft zu geben verstand? Nicht wahr, Ferdi?