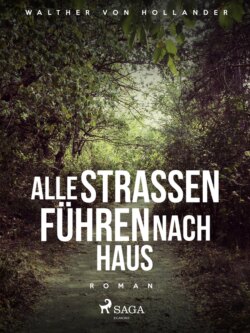Читать книгу Alle Straßen führen nach Haus - Walther von Hollander - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеBeim Abendessen fragte Tante Monica nach dem Kranken. „Mich hat er hinausgeschmissen“, antwortete Gesine. „Und Doktor Rückert sagt, daß er nur gesund werden kann, wenn ich ihn eheliche.“
„Und du?“ lächelte Monica Otten. „Du hast also das Aufgebot bestellt.“
„Ich habe“, sagte Gesine. „Übrigens, wie fändest du es, wenn ich mal schnell heiratete?“
Tante Monica merkte, daß ein bißchen Ernst dabei war. Noch nicht viel. Aber bei Gesines entsetzlicher Raschheit konnte es schnell sehr ernst werden.
„Ich werde mir also den jungen Mann mal ansehen“, sagte sie. „So von weitem kann ich das nicht sagen.“
„Ich bitte dich darum“, sagte Gesine.
Monica Otten sprach nicht mehr davon, sondern bot Schinken an.
Gesine ging nach dem Essen noch mal in den Kuhstall hinüber. Die beiden Balten löffelten noch. Brincken war etwas freundlicher.
„Tungern sagt“, versuchte er, „daß ich unhöflich war. Entschuldigen Sie.“
„Es liegt mir nichts daran, es Ihnen durch Fürsorge ungemütlich zu machen“, antwortete Gesine, „wenn Sie etwas brauchen, dann melden Sie sich bitte.“
Brincken lachte. „Sie drücken sich beinah so verzwickt aus wie Tungo“, sagte er, „alles zweimal um die Ecke herum.“
„Es ist immer noch besser, als geradeaus und direkt dem andern vor den Kopf“, neckte Tungern.
„Ich werde jetzt mal direkt sprechen“, sagte Brincken. „Und zwar von Woldemar von Tungern.“
Tungern wollte ihm den Mund zuhalten. Aber Gesine gestattete das nicht. So erfuhr sie, daß Tungern Budenangst hatte, sich vor dem Abend fürchtete, vor dem „Schnarchen des Kollegen“, und seinem Husten.
„Ich komme also wirklich noch zu meinem Fest“, sagte Gesine. Sie war ein klein wenig enttäuscht. Sie wäre lieber im Kuhstallzimmer geblieben, um weiter in dem Gesicht Brinckens zu studieren, in dem Kindlichkeit und Männlichkeit, Bitterkeit und Heiterkeit so gegensätzlich und anziehend gemischt waren.
„Wenn unser Patient also schläft“, sagte sie, „dann kommen Sie hinüber, Herr von Tungern. Und wenn er etwas braucht, dann muß er schreien. Wir lassen das Fenster bei uns offen. Adieu.“
Als Tungern nach einer halben Stunde ins Herrenhaus kam, fand er Monica Otten strickend am Kamin. Sie konnte, Gott sei Dank, auch ohne zu sehen ausgezeichnete Handarbeiten machen. Gesine las ein wirtschaftspolitisches Buch, das damals viel besprochen wurde. Tungern konnte gleich sein Steckenpferd vorreiten, daß er nichts von der Philosophie hielt, die in mehreren tausend Jahren und vielen hunderttausend Büchern die Menschen nicht zur Vernunft gekriegt hatte, ja sie nicht einmal glücklich oder schön gemacht hatte.
Unser Landstreicher, der dürre Ziegenbart, mit den wimpernlosen Luchsaugen und dem fast kahlen zitronenförmigen Schädel, bekannte sich zu einer seltsamen Art Kallisophie, Weisheit der Schönheit, die, so hoffte er, in ein- bis zweitausend Jahren auch von den nordischen Völkern ausgebildet werden würde.
Im Augenblick war freilich für solche Ideen kein Platz auf der Welt, und er gestattete sich auch nur in einem kindischen Rückfall davon zu sprechen, im Anblick einer schönen jungen und einer schönen alten Frau, hier am Kamin, während draußen der Wind zischte und die Taucherenten vom Schermsee gaakten, weil ihm der Glühwein die Zunge lockerte und weil man auf der Wanderung jede Zeit für Ewigkeit nehmen mußte, jede Freundschaft für sofort geschlossen.
Monica Otten richtete ihre leeren Augen gespannt auf Tungern. Eine angenehme Stimme, fand sie. Aber krank, müde, sterbensmüde. So hatte Gesines Mutter, Dagmar Otten, in der letzten Zeit ihres Lebens gesprochen, nachdem ihr Mann gefallen war.
„Wollen Sie uns nicht ein bißchen aus Ihrem Leben erzählen, Herr von Tungern“, sagte sie.
Gesine wich gerade dem werbenden Blick der Luchsaugen aus. Sie sah sich hilfesuchend im Zimmer um, sah zu den Bildern der Ottens auf, die, zehn an der Zahl, über dem Paneel hingen. Alle in Grünwalde geboren und gestorben, stärkere und schwächere Kerle, gute und weniger gute, strenge und nachgiebige. Alle mit einem Frieden unter aller Unruhe, mit einer Würde über aller Seltsamkeit. Sie dachte: Ihr könnt mir auch nichts raten. Euch bin ich nichts schuldig, außer Grünwalde. Das andere geht euch nichts an. Es ist auch besser, einen Wanderer zu beschenken, als einen Bettler jeden Tag vor der Haustür zu haben. Sie atmete tief auf. Die Spannung hielt nicht länger.
„Erzählen Sie wirklich, Herr von Tungerrr“, bat sie nun auch.
Der Ziegenbärtige machte einen neuen Glühwein. „Sehr apart, der Arrak“, sagte er, „ausgezeichnet der Rotwein. Wunderbar der Rum. Haben Sie Kaneel?“ Ja, man hatte Kaneel, das heißt Zimt. Das neue Gebräu war bedeutend stärker als Kornmanns Fabrikat. Endlich konnte Tungern beginnen.
Er sprang in seiner Erzählung hin und her. Er gab alles, wie es gerade an diesem Tag in seiner Erinnerung geschichtet lag. Also zuerst natürlich Brincken. Wie er ihn im Walde von Hinzenberg bei Riga in der wirren Silvesternacht 1919 aufgabelte, einen jungen Herrn im zu großen Pelz seines Vaters, ein Gewehr unter dem Arm, ein grünes Hütchen auf dem Kopf mit dem Mützenband „Baltische Landeswehr“. Und wie der junge Herr, der ebenso wie die anderen Freiwilligen gerade seine Feuertaufe hinter sich hatte, die führerlos zurücklaufenden Freiwilligen aufhielt, ermunterte, anschrie, um dann als Letzter vor den andrängenden Bolschewiken zurückzugehen, aufrecht, langsam, wie auf der Jagd, als ob sein Fuchspelz ein Kugelhemd war.
Bericht zwei. Ein Bildnis: Der Großvater Tungern, der von seinem achtzigsten bis zu seinem fünfundachtzigsten Jahre am Rand des Tungerschen Urwaldes, zwölf Werst von der nächsten menschlichen Behausung, in einem Jagdhaus lebte, mit einem siebzigjährigen Diener und einer jungen hübschen Lettin, die die Hausarbeiten zu machen hatte. Alles nur, um sich auf einem angenehmeren Wege dem Erben aus dem Wege zu räumen und dem Tod jeden Grund zu nehmen, ihn allzu schnell am Kragen zu packen.
Danach die Eroberung Goldingens, Februar 1919, und daß Brinckens Schwester mit zerschossener Hand kurz vor der Stadt zu ihnen stieß. Sie war eine Stunde zu früh geflohen. Man mußte die Hand amputieren, aber sie starb doch. Und daß Brincken nun „allein wie ein Finger“ auf der Welt lebte. Denn sein Vater war früh gestorben, der älteste Bruder im Kriege auf deutscher Seite gefallen, der zweite, die Mutter und die andere Schwester in den Revolutionswirren zugrunde gegangen.
„Und nun gehen Sie zurück?“ fragte Monica, „warum jetzt erst oder warum doch noch?“
Tungern nickte. Das war nicht einfach zu beantworten. Man hatte sich mit den Letten, den jezt Regierenden, nicht einigen können. Warum? Um die Gründe genau anzugeben, mußte man die Geschichte der letzten zweihundert Jahre erzählen. Aber es genügte auch zu wissen, daß man zuerst einig war, als es gegen die Bolschewiken ging, 1919/20, und nachher nicht mehr einig werden konnte, als Lettland ein selbständiger Staat wurde. Es kam die Enteignung. Darüber konnte kein Deutscher objektiv sprechen. Tatsache war, daß sie beide, Brincken und er, alles verloren hatten, bis auf lächerliche vierzig Morgen in Domingen. Ja, man hatte allerlei heruntergefressen, Ungerechtigkeit, Wut, ja Haß. Nun war man durch. Auf dem Heimweg. Und sie wußten: Man kam nicht weiter, man kam nicht nach Hause, wenn man nicht über die letzten zwanzig Jahre ein Tuch deckte und Erde schaufelte, Erde schaufelte.
Er war nun im Zuge. Er ging plötzlich in seine Kindheit zurück, in die hellen, weiten Birkenwälder Domingens, an deren Birkensaft er sich den ersten Rausch geholt hatte. In die Studentenjahre in Dorpat im Korps Kuronia, und in München, wo er zum erstenmal in seinem Leben nicht der große Herr war, sondern nur der lange Tungern, ein reicher junger Knabe mit dem Tick zu philosophieren.
Und dann kam der Krieg auf drei Fronten: Als russischer Soldat gegen Deutschland, dann 1917/18 als deutscher Offizier gegen Frankreich, dann als Abteilungsführer in der baltischen Landeswehr gegen die Russen. Darüber erzählte er aber zunächst nichts. Er schilderte lieber Brinckens Mutter, die zart, gescheit und hochmütig auf Schloß Brinckenhof residiert hatte, mit ihren Kindern und französischer Literatur beschäftigt, mit einer einzigen Leidenschaft: Viererzug fahren. Sie besaß immer zwei Viererzüge, und dieser Leidenschaft gab ihr Mann auch die Schuld, daß sie genau vier Kinder bekommen hatte.
Diese Frau hatte über drei Besetzungen, die russische, die deutsche und die lettische, über drei Kriegsjahre ihren Salon, ihre Bibliothek und ihr Empireschlafzimmer hinübergerettet, sie starb, fast ohne eine Lebensgewohnheit geopfert zu haben, ihren Lieblingsautor Proust in der Hand.
Und warum gelang das? Tungern hatte viel darüber nachgedacht. Es konnte nur gelingen, weil Frau von Brincken bis in die letzten Fasern ihres Herzens davon durchdrungen war, daß sie, Gerda von Brincken, geborene Fürstin Lieven, so und nicht anders leben mußte. Daß es ihr zukam und daß niemand das Recht hatte, es ihr wegzunehmen, außer natürlich Gott selbst, der sie doch aber bestimmt nicht erst zu einer Brincken gemacht hätte, falls es sein Plan war, sie als Gesindewirtin oder Landstreicherin enden zu lassen. Außerdem hatte sie ja auch ihr Opfer bringen müssen. Während der Kriegszeit war sie nicht mehr im Viererzug über die Sandwege gerast.
Tungern machte eine Pause. Tante Monica versuchte sich zu erheben. Sie wollte gehen. Aber Gesine legte ihr die Hand leicht auf den Arm. So blieb sie. Sie hörte auch gern zu. Was sie früher aus Büchern bekam, mußte sie nun, da sie nicht mehr sehen konnte, von Menschen haben.
„Man sagt, daß wir Balten an diesem Hochmut zugrunde gegangen sind“, begann Tungern wieder, „aber andere Stämme und Völker sind auch hochmütig gewesen und leben noch.“
„Mein Vater“, antwortete Gesine, „sagte, daß man bei den Völkern überhaupt diese Personenbegriffe, wie Schuld und Ursache des Untergangs und so, weglassen solle. Man komme doch nicht dahinter.“
„Man kommt bei den Völkern nicht dahinter, warum sie untergehn“, sagte Tungern, „aber bei den Menschen auch nicht.“
Sie wollten nun eigentlich etwas anderes bereden, stellten das Radio an, eine ausgezeichnete Tanzkapelle kam. Tanzen? Nein, Tungern konnte nicht tanzen. Er war zu lang dazu. Er war auch ins Erzählen hineingekommen. Man mußte es zu Ende bringen. Es war wirklich einigermaßen merkwürdig, wie er sich die zehn Jahre mit Brincken durchgeschlagen hatte. Zuerst sah es noch so aus, als sollte alles nur vorübergehend sein. Es war mehr seltsam und abenteuerlich als ernst. Wie sie beispielsweise sich als Holzfäller in Bayern ihr Brot verdienten. Eklich anstrengend übrigens. Hatten es auch nicht lange gemacht, sondern waren als Flößer die Isar hinuntergefahren und gleich in München geblieben. Brincken als Zeitungsverkäufer, Tungern als Buchhändler. Aber er war natürlich zu lang für die niedrigen Verkaufstische. Sie waren auf Wanderschaft gegangen, quer durch Deutschland, in einem halben Jahr von München nach Hamburg. Mit etwas Erntearbeit dazwischen. In Hamburg hatte Brincken sein Abitur gemacht, um dann Automobilschlosser zu werden. Tungern gelang es, als Hafenarbeiter unterzukommen, ein Kunststück ersten Ranges. Denn die hielten die Außenseiter so scharf weg wie früher die Kasten. Dann kam die Ruhrgeschichte. Natürlich waren Tungern und Brincken dabei, obwohl man sie nicht gerufen hatte. Sie stellten sich ein, sie dachten, man würde sie schon brauchen. Man brauchte sie auch. Nicht sehr lange. Aber ein paar verteufelt gefährliche Unternehmungen kamen auf sie. Dann war auch das aus, und sie fuhren nach Hamburg zurück. Sie bekamen etwas Geld, ein paar Pfund von einem englischen Brincken. Das war damals viel Geld. Brincken studierte deshalb ein Semester Medizin. Über dem letzten Pfund, von dem sie ein Jahr zu leben gedachten, brach die Inflation ab, und sie hatten zwanzig Mark statt eines riesigen Reichtums. Brincken bekam noch ein Stipendium, stümperte sich ein Jahr weiter. Dann wurde er Kranführer im Hafen, wo Tungern als Vorarbeiter arbeitete. Sie dachten, sie würden dabei bleiben, und sie blieben auch mehrere Jahre. Man hatte etwas Geld, ein paar Kameraden, den Blick über Wasser, man hatte manchmal ein Segelboot von Freunden zur Verfügung. Es war eine ganz schöne Zeit.
Schlimm war nur, man gehörte nirgends dazu. Nicht zu den Arbeitern und nicht zu den Freunden und nicht zu der schönen Stadt. Denn man wollte ja nicht bleiben. Man rechnete damit, daß man eines Tages auf und davongehen würde. Dann kam natürlich das Heimweh, bohrte und hämmerte. Im Frühling besonders, und eines Tages wanderte man eben los, obwohl es Wahnsinn war und obwohl ... Na ja.
Er hörte mit einemmal auf. Er warf ein paar Birkenkloben aufs Feuer, ging ans Fenster, beugte sich weit hinaus. Von hier oben konnte man den Schermsee in der Mondnacht liegen sehen, ohne Farbe, wie ungeputztes Nickel. Der Wind hatte sich etwas verstärkt. Die Tannen rauschten gleichmäßig und voll.
„Entschuldigen Sie“ sagte er vom Fenster her, „ich habe wirklich mein Leben ausgebreitet wie eine Speisekarte.“
„Sie sind noch jung“, sagte Monica Otten tröstend, „es ist erst die Hälfte Ihres Lebens. Ihr Großvater wurde fünfundachtzig.“
„Nein, wir alle sind nicht jung“, antwortete Tungern, zu Gesine gewandt.
„Eine Frage“, sagte Monica Otten, „Sie sind vierzig, nicht wahr, dreiundvierzig, gut. Waren Sie nie verheiratet?“
Tungern kam quer durchs Zimmer, setzte sich auf seinen Sessel und sagte trocken: „Doch, ich war verheiratet.“
„Entschuldigen Sie“, sagte Tante Monica erschrocken. Sie stand nun wirklich auf. Es war spät, halb zwölf. Das Radio war schlafen gegangen. Zeit für alte Leute.
In diesem Augenblick hörte man Brinckens unsichere Schritte draußen, hörte ihn pfeifen. Tungern holte ihn herauf. Er war in Hemd, Hose, Windjacke und Hausschuhen, etwas verschlafen, eine borstige Locke hatte er über die Kinderstirn hängen.
„Das ist also Herr von Brincken“, nickte Monica Otten, „kommen Sie, nehmen Sie meinen Stuhl. Ich gehe wirklich.“
Aber sie blieb. Brincken lachte über seinen gelungenen Streich. Innen war er ein bißchen eifersüchtig. „Ich rufe und rufe“, sagte er, „aber es hört natürlich niemand. Na, ich würde hier auch nicht hören.“
„Wir haben uns ein bißchen über dich unterhalten“, gestand Tungern. Brincken sah mißtrauisch zwischen dem Freund und Gesine hin und her.
„Hast du unsere Räuberlaufbahn geschildert?“ sagte er. „Klingt toll, was? Abends manchmal, wenn ich ausnahmsweise nicht einschlafen kann, repetiere ich mein Leben wie für die Schule. Man behält es sonst nicht. Hast du uns auch großartig genug geschildert, Tungo? Nein? Sehr unrecht von dir. Wissen Sie, was alles über uns in den Zeitungen gestanden hat? Wir waren der Schrecken der Feinde, Helden, Befreier, Veteranen, die gefürchteten Baltikumer, die Desperados an der Ruhr, die entthronten Schnapsbarone, wir waren ...“
Er schwatzte noch eine Weile lustig weiter. Sie tranken noch ein oder zwei Glas zusammen, wurden müde und verstimmt. Der Wind steigerte sich immer mehr. Man mußte die Fenster schließen. Die fernen Wälder fingen an zu seufzen und zu brummen. Die Windfahne knirschte auf dem, Dach. Um zwölf Uhr gingen die beiden Herren.
Draußen unter der Tanne stand Brincken still und sagte leise zu seinem Freund (der Wind sollte es gleich wegfegen): „Bist du böse, Tungo? Ich habe beinahe das Gefühl, daß es eine Gemeinheit war, daß ich kam.“
Tungern nickte. „Das ist gar nicht so unmöglich“, sagte er. „Aber ich bin dir durchaus nicht böse.“
Drinnen räumte Monica Otten mit vorsichtig tastenden Bewegungen die Gläser zusammen. „Nett“, sagte sie, „reizend, sehr sauber, sehr hübsch.“
Gesine, die am Fenster gestanden hatte, bis die beiden Schatten im Dunkel verschwunden waren, kam mit schaukelnden Männerschritten näher, legte der Alten die Hände auf die Schulter, sah eindringlich in die blinden Augen und sagte: „Welchen meinst du?“
„Den Jungen natürlich“, sagte Monica Otten.
„Gut“, schloß Gesine den Abend und ging hinauf.