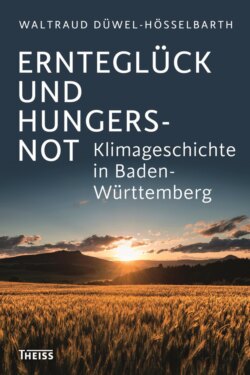Читать книгу Ernteglück und Hungersnot - Waltraud Düwel-Hösselbarth - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erd- und Klimageschichte Südwestdeutschlands
ОглавлениеVulkane – Eiszeiten – erste Kulturen
Tief unter den Böden der Zollernalb liegt das Grundgestein aus Granit und Gneis. Jüngere Gesteine darüber – das Deckgebirge – sind nacheinander als Ablagerungen von Wind, Flüssen und Meeren entstanden. Die Kalkfelsen im Neckarland, die Felsgärten von Besigheim sowie die Kornsteine des Kocher-, Jagst- und Taubertales, aber auch die Muschelkalkstufe am Egenhäuser Kapf, am Sulzer Eck, am Büchelberg und die steinigen Böden des Hecken- und Schlehengäus sind eindrucksvolle Zeugen dieser Zeit.
In der Erdneuzeit (vor etwa 70 Millionen Jahren) entstand allmählich die heutige Gestalt der Landschaft.
Im Tertiär, mit starkem Vulkanismus, vor ca. 45 Millionen Jahren falteten sich die Alpen auf. Beim Einsinken des Oberrheingrabens wurde der Schwarzwald emporgehoben. Der Verlauf der Schichtung der Schwäbischen Alb entspricht somit dem Anstieg des Schwarzwaldsockels. Die Schrägstellung der Gesteinsschichten beschleunigte ihre Abtragung. Wind und Wetter, Hitze, Eis und Regen lösten über Jahrmillionen Teile und Brocken vom Gestein und beförderten das losgelöste Material zu Tal.
Der Schwarzwald wurde nach und nach vom Deckgebirge befreit und das Grundgebirge liegt dort offen obenauf.
Bei der Alb – sie reichte bis in die Stuttgarter Gegend – wichen mit fortschreitender Abtragung die Kanten des Deckgebirges immer weiter zurück in Richtung Donau. Das sind die in der Landschaft erkennbaren Stufen der Schwäbischen Alb – der sogenannte Albtrauf –, die als wichtigste Abtragungskanten des Deckgebirges erkennbar sind.
Die unterschiedliche Widerstandskraft der Gesteinsschichten gegen Erosion bewirkte den ungleichmäßigen Verlauf ihrer jeweiligen Abtragungskanten, die sich auch heute noch verändern.
(Man kann es z.B. bei Wanderungen entlang des Albtraufs, wie vom Klippeneck zum Dreifaltigkeitsberg, selbst sehen und hören, wenn sich Steine lösen und zur Straße oder ins Tal fallen.)
Das Bergplateau des Dreifaltigkeitsberges, zu den archäologischen Denkmälern Baden-Württembergs gehörend, wird durch mehrere Abschnittswälle gegliedert.
Der gesamte Osthang weist Spuren einer Randbefestigung auf. Neben Abschnittsbefestigungen folgen stumpfwinklige Wallgrabenanlagen mit Tor.
Nach Süden wird das Plateau durch einen Graben mit äußerem Schildwall abgeschlossen.
Der Berg wurde seit der Jungsteinzeit aufgesucht, dichter besiedelt war er während der Urnenfelder-, La-Tène-Zeit (jüngere europäische Eisenzeit – Kelten). Noch nicht geklärt ist das zeitliche Verhältnis der verschiedenen Befestigungen zueinander.
Am Südende des Plateaus finden sich Überreste einer mittelalterlichen Burgstelle. Auf der Mitte der Hochfläche steht seit ca. 1400 Jahren eine Pfarrkirche. Das Zwiebeldach des Turmes (anfang 19. Jh.) wurde für die Einrichtung eines topografischen Festpunktes der Württembergischen Landesvermessung als Plattform umgebaut.
Die im Kloster wirkenden Klarentiner Mönche betrieben Landwirtschaft und beim Einsetzen des Flugverkehrs eine Flugmeldestelle, die nach dem Zweiten Weltkrieg vom Deutschen Wetterdienst übernommen wurde. Im Frühjahr 1946 wurde die erste Meldung abgesetzt.
Auf dem nahegelegenen Klippeneck entstand das Haus für die Wetterstation mit personeller Besetzung.
Inzwischen begann eine neue Ära nach der vollständigen Automatisierung der Wettermeldungen.
Ein Geologe prophezeit, dass die Station am Rande des Albtraufs in ca. 500.000 Jahren durch die stete Erosion den Weg ins Tal genommen hat.
Der größte Vulkanschlot im Schwäbischen Vulkangebiet ist der Jusi und prägt die Landschaft. Er entstand vor 18 Millionen Jahren durch Plattenverschiebungen mit Gesteinseruptionen aus 50 Kilometer Tiefe und ist einmalig in seiner Geologie (Durchmesser 1100 Meter). Das Zentrum des Vulkangebiets liegt zwischen Kirchheim unter Teck und Bad Urach.
Derzeit sind 356 Schlote bekannt. Der nördlichste ist der Scharnhauser Vulkan in Ostfildern und einer der größten ist der Jusi bei Kohlberg (gegenüber des Hohenneuffen). Viele Schlote wurden nur mit hochempfindlichen Magnetometern entdeckt.
Mit 40 Kilometern Durchmesser ist das fast kreisrunde Gebiet des schwäbischen Vulkans von der Fläche her mit dem Ätna auf Sizilien vergleichbar. Die Fördermenge an Magma lag allerdings bei höchstens einem Prozent gegenüber dem noch aktiven Schlot in Süditalien.
Noch heute sind zahlreiche Überreste dieses Vulkanismus zu sehen. Auf der Albhochfläche sind es die Maare und Torfmoore, die im Gegensatz zum Kalkgestein der Umgebung für Wasser undurchlässig sind und in denen sich Kraterseen bilden konnten. Als Beispiel gilt das Randecker Maar mit mehr als einem Kilometer Durchmesser, das Schopflocher Moor bei Ochsenwang und die Limburg bei Weilheim unter Teck.
Im Albvorland ragen die Basaltschlote aus der Umgebung. Weil der Jusi nicht wie die Alb aus Karstgestein, sondern aus Basalttuff besteht, konnte sich hier eine einmalige Flora und Fauna entwickeln und das Gebiet wurde von der Unesco in das anerkannte Biosphärengebiet der Schwäbischen Alb eingegliedert.
Die einstige thermische Aktivität in diesem Gebiet ist auch heute noch teilweise erhalten und zeigt sich in den Thermalbädern von Beuren und Bad Urach.
Der vor 1,6 Millionen Jahren einsetzende drastische Klimasturz durch das Vorrücken des Eises ließ die bis dahin bestehende subtropische Pflanzenwelt aussterben. Aus den Alpentälern drangen Eismassen in den heute württembergischen Raum ein. Der Rheingletscher überzog mit seinem höchsten Stand die Donau bei Sigmaringen-Riedlingen, umgab den Bussen und hüllte den Hohentwiel ganz in Eis.
Der im Verlauf dieser Eiszeit entstandene Endmoränenwall bildet nun in Oberschwaben die Wasserscheide. Infolge von Grabeneinbruch und Eisausschürfungen kam es zur Entstehung des Bodensees.
Vier Eiszeiten erreichten den süddeutschen Raum: die Günz-, Mindel-, Riß- und Würm-Eiszeit. Sie folgten jedoch nicht dicht nacheinander, sondern wurden durch Warmzeiten, sogenannte Interglaziale, unterbrochen. Die klimatischen Verhältnisse dieser Abschnitte sind mit den heutigen vergleichbar und hatten eine beschleunigende Wirkung auf die Evolution.
Vor rund 10.000 Jahren – am Ende der letzten Eiszeit – erhob sich ein zweitausend Meter hoher Eispanzer von Skandinavien bis in die Mitte Europas. Diese schweren schmelzenden Massen hobelten beim Vorrücken Senken aus und ein großer Süßwassersee – die Ostsee – entstand, die im Westen flache Ufer aufwies.
Die Gewässer stiegen beim Abschmelzen der Gletscher um 120 Meter, es entstanden und verschwanden Inseln, schließlich toste das Wasser des riesigen Süßwassersees über die siebzig Meter hohe westliche Schwelle und verband sich mit der Nordsee. Der nunmehr entstandene Wasseraustausch brachte der Ostsee den Salzwassergehalt.
Es kam zu über dreihundert Meter Landerhöhungen in Skandinavien (der Prozess hält in Norwegen noch messbar an). Landunter ereignete sich an der südlichen Ostseeküste. Wie der Pflanzenökologe und -historiker Professer Hansjörg Küster schildert, zeigen die Spuren deutlich an, dass vor rund 6000 Jahren an der südlichen Küste Menschen siedelten, es gab Wälder und viel Wild, wie die Funde vom ehemaligen Ufer, nunmehr wieder im Meer, beweisen.
Unterwasserarchäologen finden die Spuren der Siedlungen und Reste der Steinzeitkultur wie Feuersteine (gewonnen aus den Kreidesteinfelsen), Fischreusen und sogar Handelsware, die auf das Elbe- und Saalegebiet hinweisen.
Die Küstenregion war laufenden Veränderungen unterworfen, so wie sich die Boddenlandschaft auch jetzt noch stetig verändert.
Gegen Ende der letzten Eiszeit, als es zum Abschmelzen der Eismassen und zum Rückzug des Rheingletschers kam, wies die noch eingeschränkte Vegetation in der Tundra wegen der guten Schmelzwasserversorgung und kräftiger Sonneneinstrahlung üppiges Wachstum von Gräsern, Kräutern, Flechten, kleinwüchsigen Birken und Weiden auf und bot eine reiche Nahrungsquelle für Auerochsen, Mammuts, Elche und Hirsche.
Vor allem diente das Rentier an erster Stelle, gefolgt vom Wildpferd, dem Schneehasen und Schneehuhn dem Frühmenschen als Jagdbeute, wie es die große Anzahl von Tierknochen bei Ausgrabungen deutlich zeigt.
Mit dem Zurückweichen des Eises im süddeutschen Raum boten sich dem Homo sapiens günstige Lebensbedingungen und es kam zu einer kulturellen Explosion, das dokumentieren die Funde der perfekten Kunst vor 35.000 Jahren auf der Schwäbischen Alb, so der Löwenmensch, das Mammut und die Flöte aus der Vogelherdhöhle.
Die wichtigsten Erfindungen der Menschen dieser Zeit waren die Speerschleuder und die Nähnadel.
Auf der Schwäbischen Alb, im höhlenreichsten Gebiet Deutschlands, gibt es etwa 2600 bekannte Höhlen, die nicht nur die Geologie, sondern auch die Entwicklungsgeschichte des Menschen zeigen. Weltweit einzigartige archäologische Funde, wie die ältesten Kunstwerke und Musikinstumente, wurden hier entdeckt.
Mystisch und von unschätzbarem Wert ist die 30 cm hohe Figur des Löwenmenschen, die meisterhaft aus einem Mammutstoßzahn vor rund 35.000 Jahren geschnitzt wurde und die faszinierendste Entdeckung eiszeitlicher Kunst auf der Welt darstellt. Auch die 36.000 Jahre alte „Venus vom Hohlen Fels“, gefunden im Achtal bei Schelklingen, und die Flöte aus Mammutelfenbein aus der Höhle Geißenklösterle bei Blaubeuren, gehören zu den weltweit wichtigsten archäologischen Fundstücken.
Aus der Altsteinzeit stammen die zweihundertfünfzig Felszeichnungen im Freien im Côa Flusstal (Portugal).
In Frankreich befinden sich die ältesten Beweise der Höhlenmalerei, so in Ardèche und Chauvais mit Nashörnern, Löwen und Bisons, entstanden vor 32.000 Jahren.
Elfenbeinflöte aus der Höhle „Geißenklösterle“ bei Blaubeuren, Alter ca. 35.000–40.000 Jahre
„Löwenmensch “ vom Hohlenstein-Stadel im Lonetal, Alter ca. 35.000 Jahre
Aus der späten Eiszeit (vor 19.000 Jahren) fand man in den Labyrinthen der Höhle von Lascaux Felsbilder von eindrucksvoller und unglaublicher Schönheit, die auf die Vielzahl von Wisenten, Auerochsen, Pferden, Hirschen und Löwen hinweisen.
Ein Taucher fand überraschend vor Marseille eine Höhle mit ähnlicher Malerei. Ein Beweis, dass der Meeresspiegel vor 27.000 bis vor 18.000 Jahren um rund 120 Meter tiefer lag.
Der spannende Rückblick in die Vergangenheit des Klimageschehens sorgt für eine Gewissheit des häufigen und einschneidenden Wandels der Temperaturen mit seinen Folgen, die bei gegenwärtigen Modellen und Berechnungen außer Acht gelassen werden.
Zweifellos wirken die Menschen mit den Veränderungen der natürlichen Umwelt heftig an nicht gutzumachenden Schäden mit (siehe Stadtklima).
Die „Venus vom Hohlen Fels“ bei Schelklingen, Alter ca. 36.000 Jahre
Die Grafik zeigt den Klimaverlauf der letzten 1000 Jahre (relative Temperaturschwankungen) nach verschiedenen Beobachtungen in England, Frankreich und Deutschland. Man erkennt das mittelalterliche Klimaoptimum um 1150, die „Kleinen Eiszeiten“ vom 15. bis zum 18. Jahrhundert sowie die gegenwärtige Erwärmung.
Die Beschlüsse der vielen, äußerst kostspieligen Klimagipfel seit Kioto zeigen „unter dem Strich“die Gefahren wie Anstieg der Meere, das Ende vom Förderband des Golfstroms, Zunahme von Unwettern gepaart mit dem Ausbleiben der Niederschläge usw. usw., gleichzeitig wird die Wurzel des Übels genährt, indem man das allgemeine Wachstum der Industrie, der Menschheit und die Vergrößerung der Städte nachhaltig wünscht.
Wo bleiben durchsetzbare geopolitische Entscheidungen, die massiven Wanderungsbewegungen der eventuell gefährdeten Bevölkerung Wege weisen?
Mit Beginn des Holozäns stieg die Durchschnittsjahrestemperatur innerhalb einiger Jahrzehnte um 7 °C an. Die Niederschlagshäufigkeit nahm zu.
Unter dem Erwärmungsprozess kam es zur Ausweitung der Vegetation in den nördlichen und südlichen Breiten. Es entstand jene Umwelt, die wir heute kennen. Flora und Fauna passten sich den neuen klimatischen Bedingungen an.
Mit dem Abschmelzen der Gletscher begann die Veränderung der Küstenlinien, denn durch den Anstieg der Meeresspiegel bekamen die Kontinente weitgehend jene Form, die sie heute besitzen.
Während der Großen Eiszeit war der Meeresspiegel weit abgesunken, nun traten neue Meere an die Stelle früherer Gletscher, wie etwa die Ostsee oder die Hudson Bay.
Der Ärmelkanal bildete sich 7500 v. Chr., Britannien und Irland wurden vom Kontinent getrennt, ebenso Sizilien von Italien und die griechischen Inseln vom anatolischen Festland. Die vorhandenen Küstenkulturen verlagerten sich ins Landesinnere.
Im mittleren Holozän, allgemein als Atlantikum (ca. 6000 bis 4000 v. Chr.) bezeichnet, kam es zur längsten und wärmsten Phase des Holozäns, die Temperaturen überstiegen diejenigen des ausgegangenen 20. Jahrhunderts. Weitgehend schmolzen die Gletscher ab, die Wasserstände der Meere und Seen lagen weltweit höher als heute, häufige Regenfälle brachten Nordafrika zum Blühen.
Früher glaubte man, dass die großen Gletscher Norwegens noch aus der Eiszeit stammen, neue Forschungsergebnisse von Glaziologen ergeben, dass die Mächtigkeit dieser Gletscher erst nach der langen Warmzeit des Holozän, also 500 Jahre vor Christi entstand.
Gegenwärtig stellen Geologen fest, dass es beim Auftauen des Permafrostes vor ca. 3700 Jahren an der Zugspitze zu einem dramatischen Bergsturz kam, dessen Spuren bis Garmisch feststellbar sind.
Deshalb werden z.Zt. nach einer Durchbohrung der Bergspitze Messungen des Permafrostes durchgeführt, da ein erneuter Bergsturz befürchtet wird.
Die feuchte Warmzeit, unter dem Begriff Klimaoptimum bekannt, war für die Entwicklung der menschlichen Kultur äußerst günstig. Die wachsende Bevölkerung – im Übergang zur Sesshaftigkeit – begann mit der Kultivierung des Landes (in Europa ca. 6000 v. Chr.) nach der halbnomadischen Jäger- und Sammlerkultur in der Mittelsteinzeit.
Baumfunde am Großglockner, dem größten österreichischen Gletscher, beweisen, dass die Vegetation in Höhen vordrang, die heute noch unter Eis liegen.
Auffallend ist bei der Pasterze, ebenso wie an den westalpinen Gletschern, dass Gletscherbäche Torfteile, Holzreste, ja Stammteile bis zu drei Meter Länge herausspülen und auf der Schotterfläche der Gletscherzungen ablagern.
Bei den gefundenen und analysierten Hölzern handelt es sich um die beiden typischen subalpinen Baumarten Lärche und Zirbe, wie sie auch heute unterhalb der Pasterze vorkommen.
Bezeichnend für die auf der Sanderfläche entdeckten Holzteile sind die Stauchungen im Außenbereich der Baumstämme, die auf die ehemalige Überlagerung durch das Eis der Pasterze zurückzuführen sind.
Nach der Fundsituation vor der Gletscherzunge ist klar, dass die Stämme ehemals an Stellen wuchsen, die heute noch eisbedeckt sind.
Diese Funde belegen damit, dass die Pasterze in früheren Zeiten kleinere Ausdehnungen als gegenwärtig aufwies.
An einzelnen der gefundenen Stämme ist ein Wachszeitraum von über dreihundert Jahren durch die Anzahl der Jahresringe belegbar.
Demnach dauerten die Perioden geringerer Gletscherausdehnung als heute durchaus über längere Zeiträume an.
Das Alter der meisten Holz- und Torfstücke ist durch Radiokarbondatierung bestimmt: Die Funde fallen in den Zeitraum von ca. 10.300 bis 3600 Jahre vor heute und damit in die frühe bis mittlere Nacheiszeit.
Der Großteil des Holzes ist rund 10.300 bis 8900 Jahre alt und belegt durch sein Alter, dass es gerade im frühen und mittleren Holozän lange Perioden mit geringerer Gletscherausdehnung als heute gab, und dass diese kleineren Gletscherstände durchaus der Normalzustand für die ersten zwei Drittel der Nacheiszeit darstellten.
Auch neuere Untersuchungen in den Schweizer Alpen bestätigten diese Einschätzung.
Unterbrochen waren diese Perioden mit geringer Eisausdehnung, die mit ihrer langen Andauer höherer Temperaturen hervorstechen, durch wiederholte Klimarückschläge mit Gletschervorstößen, wie sie mit den Jahren des Absterbens der Pasterzenbäume durch das vorrückende Eis belegt sind.
Die geschilderten Veränderungen der Gletscher traten unter naturgegebenen Witterungsabläufen auf.
Im 14.–16. Jh. wurde sogar bis in 3000 m Höhe Bergbau am Großglockner betrieben, das beweisen Stollen, die beim Gletschervorstoß unzugänglich wurden.