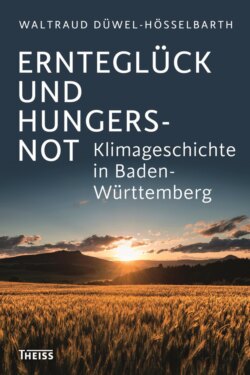Читать книгу Ernteglück und Hungersnot - Waltraud Düwel-Hösselbarth - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеZum Verständnis von Wetter und Klima
Definitionen und Zusammenhänge
Unsere persönliche Stimmung und das Wohlergehen hängen oft von der Witterung ab. Das Wetter selbst macht nicht krank, jedoch können Anfälligkeiten unter bestimmten Bedingungen verstärkt werden.
Besonders von der Wetterfühligkeit betroffen sind jene, die unter Atem- und Herzbeschwerden leiden, dazu kommt – jahreszeitlich bedingt – pauschal genannt: der Heuschnupfen.
Wenn wir das Wetter, wie wir es täglich erleben, verstehen wollen, müssen wir die Gesetze kennen, die die Atmosphäre bestimmen.
Wechselwirkungen verschiedener Faktoren verursachen die Jahreszeiten, die Klimaverteilung auf der Erde und die täglichen Wetterschwankungen.
Zahlreiche Komponenten wirken zusammen und rufen die vielfältigen Aspekte des Wetters auf der Erde hervor und schaffen damit die verschiedenen Klimazonen.
Unter Klima versteht man das Wetter, wenn man es über längere Zeit beobachtet, verzeichnet und analysiert hat.
Das Klima hängt von der geografischen Breite ab, die bestimmt, wie heiß oder kalt ein Gebiet ist und wie stark sich die Jahreszeiten auswirken, und von den Eigenschaften der vorherrschenden Luftmassen, die heiß oder kalt, feucht oder trocken sein können, sowie von der Figuration des Landes.
In unseren mittleren Breiten mit gemäßigtem Klima trifft warme, subtropische Luft auf kühle, subpolare Strömungen, was zu wechselhaftem Wetter führt. Im Sommer liegen unsere Breiten mehr unter subtropischer Luft, im Winter gelegentlich unter dem Einfluss des subpolaren Luftstroms.
Ausgedehnte Hitzewellen treten auch in mittleren Breiten auf, wenn heiße Luft von den Tropen hereingeströmt ist und sich unter Hochdruckeinfluss verstärkt. Ist der Erdboden trocken, erhöht sich die Erwärmung noch mehr, weil dann weniger Wärme zur Verdunstung verbraucht wird.
Als Beispiele gelten für solche Hitzewellen die Jahre 1976 und 2003, die noch gut in unserem Gedächtnis sind. Eine Steigerung der Hitze erfuhr das Jahr 1540, als Mitteleuropa für rund elf Monate in den Subtropengürtel einbezogen war.
Es bauten sich in diesen Jahren umfangreiche Hochdruckgebiete auf mit einem Sog von heißer, trockener Luft aus Südeuropa, während der normale Strahlstrom, der diesem Gebiet kühlere Luft zuführt, nach Norden abgeschwenkt war. Diese Situation führte zu anhaltender starker Erwärmung.
Ebenso wie bei der Hitze ist bei der Kälte nicht die absolute Temperatur entscheidend, sondern ihre Dauer und das Ausmaß, in dem sie von den für dieses Gebiet normalen Werten abweicht.
Ursachen klimatischer Veränderungen wurden und werden von zahllosen Forschern gesucht. Das Problem ist, dass viele Möglichkeiten denkbar wären wie Sonnenfleckenzyklen, Vulkanausbrüche, Änderungen im Magnetfeld der Erde oder der Winkel der Erdumlaufbahn.
Betrachtungen vor rund 30 Jahren
Wie sich die Meinungen innerhalb von ein paar Jahrzehnten ändern können, beweisen die Feststellungen namhafter Wissenschaftler und Klimaforscher im „Wetter-Buch“, herausgegeben von Ralph Hardy, Peter Wright, John Gribbin, John Kington und Prof. Dr. Hermann Flohn. Sie stellten fest, dass die Temperaturen seit den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts wieder den Stand des 19. Jahrhunderts erreicht hatten und, wenn dieser Trend anhält – nachdem sie um etwa 3 K gesunken sind –, in etwa zwei Jahrzehnten wieder so rau sein werden wie damals als Napoleon in Russland einmarschierte.
Es würde nicht der Ironie entbehren, wenn unsere Wetterbedingungen unter Erwärmung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, „die wir für normal halten“, in Wirklichkeit die Ungewöhnlichsten der letzten 1000 Jahre waren. In diesem halben Jahrhundert mit gleichmäßigem Wetter waren die Ernten gut, Missernten zeigten die Auswirkungen des Klimas in den 70er-Jahren.
Die einfachste Vermutung, die man anstellen kann, wenn man eine Vorhersage über das künftige Klima machen will, ist wohl die, dass das Wetter wieder zu seinem „Normalzustand“ zurückpendeln wird, dem der „Kleinen Eiszeit“.
Man stellte fest: „Die Ursache, dass sich das Klima von Jahrhundert zu Jahrhundert so stark ändert, liegt darin, weil das Wetter auf der Erde ein System von äußerst anfälligem Gleichgewicht ist und schon kleine Veränderungen große Umwälzungen einleiten können.“
Wie aus der grafischen Darstellung der Jahrestemperaturmittel in diesem Buch zu ersehen ist, entsprach der tatsächliche Temperaturgang nicht den Prognosen, denn ab 1981 wurde das langjährige Mittel nur viermal unterschritten (1984, 1985, 1987 und 1996), die Rückkehr in die „Kleine Eiszeit“ blieb aus.
Nach 1960 wurde allmählich klar, dass auch Atombombentests die Messungen beeinflussen. Stickstoffoxide, die in dem Feuerball einer Kernexplosion erzeugt werden, steigen hoch in die Stratosphäre, sodass sie deren Durchlässigkeit beträchtlich beeinflussen.
Die Supermächte ließen 1961/62, kurz vor Einstellung der Kernwaffenversuche, mehr als 300 Megatonnen nuklearer Explosionsstoffe detonieren.
Messungen russischer Forscher zeigten 1979, dass das Stickstoffoxid 2,5 % der Sonnenwärme in hohen Schichten der Atmosphäre absorbiert und zu einer Erwärmung der Stratosphäre führt, während sich der Erdboden abkühlt.
Diese aufregende Entdeckung stellte die vorherrschende Meinung der Wissenschafter – Atombomben hätten keinen Einfluss auf das Klima – völlig auf den Kopf. Sie könnte auch erklären, warum die Erdtemperatur bei inaktiver Sonne niedriger ist, d.h. beim Fehlen der Sonnenflecken.
Welchen Schaden nahm die Ozonschicht bei den Kernwaffenversuchen? Die Aussagen von Wissenschaftlern fehlen.
Eine eigene Erfahrung machte ich auf Neuseeland in den 1980er-Jahren: Nach kürzestem Sonnengenuss trat höchster und schmerzhafter Sonnenbrand auf. Gleichzeitig wurde beobachtet, dass die einheimische Bevölkerung und vor allem Kinder nur voll bekleidet und mit Sonnenhut im Freien waren.
Fest steht, dass das Klima und dessen Beeinflussung ein unendliches Thema ist und bleiben wird, dass die weltweite Entwaldung und der globale Raubbau die Ressourcen immer schneller verbraucht und dass die ökologische Krise die Menschen härter treffen kann als die aktuelle Finanzkrise, und damit das Wohlergehen aller Nationen gefährdet.