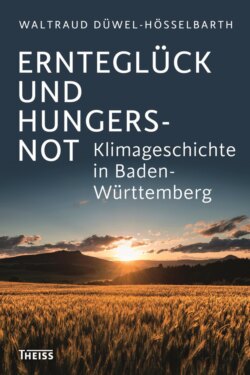Читать книгу Ernteglück und Hungersnot - Waltraud Düwel-Hösselbarth - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wie die Sonne das Klima beeinflusst
ОглавлениеVon der hochmittelalterlichen Warmzeit zur Kleinen Eiszeit
Im Laufe der Erdgeschichte traten immer wieder andauernde Phasen äußerst starker oder nahezu verschwindender Sonnenaktivität auf. Extreme, die sich offenbar dramatisch auf das Erdklima auswirkten.
Zurzeit beschert die ungleichmäßige Drehung der Erdachse der Nordhalbkugel einen erhöhten Sonnengenuss.
Mit dem am 2. Dezember 1995 gestarteten Raumfahrzeug SOHO hoffen die Wissenschaftler, der Ursache für den Elf-Jahres-Zyklus einer Magnetfeldumkehr der Sonne auf die Spur zu kommen.
Die Analyse radioaktiver Elemente in Baumringen lässt auf eine erhöhte Sonnenaktivität in den ersten 200 Jahren des vergangenen Jahrtausends schließen (Hochmittelalterliche Warmzeit).
Ab dem 14. Jahrhundert sanken die Temperaturen, was war geschehen? Die Sonne war von einem Extrem in das andere gefallen. Die Sonnenflecken hatten sich aufgelöst, wie es nicht nur vom 14. bis ins 16. Jahrhundert, sondern von 1645 bis 1715 nachweisbar ist.
Diese Jahrzehnte fehlender Sonnenaktivität fallen genau in die kältesten Phasen jener Epochen, die in Europa als „Kleine Eiszeiten“ bekannt sind und zu Missernten und Hungersnöten führten.
Der Superintendent Maunder vom Observatorium Greenwich stellte in den 1890er-Jahren als Erster die Klimabeeinflussung durch Sonnenfleckenschwankungen fest. So bezeichnet man den Zeitraum von 1675–1715 in der Historischen Klimatologie als Maunder-Minimum.
Mit ihren auffallend zahreichen Winter- und Eisszenen schufen die holländischen Meister des 16. und 17. Jahrhunderts sichtbare, für diese klimageschichtliche Besonderheit klare Beweise, wie z.B. Pieter Bruegel 1558 mit „Winterlandschaft mit Eisläufern und Vogelfalle“ und die „Volkszählung“ 1566: Diese zeigt das Alltagsleben in einem flämischen Dorf mit dem zugefrorenen Teich, auf dem Kinder schlittern und Kreisel spielen.
Bedrohlich sind die sogenannten „koronaren Massenauswürfe“, diese Gaswolken rasen durch den Weltraum, erreichen nach rund drei Tagen die Erde und lösen die gefürchteten magnetischen Stürme aus, die zum Erliegen ganzer Stromnetze führen können. Zu einem derartigen Zwischenfall kam es am 13. März 1989 in der kanadischen Provinz Quebec. Sechs Millionen Kanadier saßen eine Nacht im Dunkeln, weil die wichtigsten Kraftwerke zu einer Sicherheitsabschaltung gezwungen waren, da der magnetische Sturm Spannungsspitzen in die Oberlandleitungen induziert hatte.
Die Hochmittelalterliche Warmzeit folgte dem frühmittelalterlichen Pessimum, als es bei erheblicher Abkühlung, mit verschlechterten Anbaubedingungen, Missernten, Hungersnöten und Anfälligkeit gegenüber Krankheiten kam. Gletscher in der Schweiz (Grindelwaldgletscher) und in den Alpen allgemein erreichten ein Ausmaß, wie in der Spätphase der Kleinen Eiszeit: Sturmfluten brachten Veränderungen an den Küstenlinien der Nordsee und Südenglands. Die Entvölkerung Nordeuropas läutete das „Pessimum der Völkerwanderungszeit“ ein.
Zum Klimawandel kam es um 1000 n. Chr. und die Hochmittelalterliche Warmzeit begann, die von zwei amerikanischen Isotopenspezialisten neu interpretiert wurde. Sie untersuchten die Intensität der Sonnenstrahlung und haben die Hochmittelalterliche Warmzeit nachgewiesen.
„Winterlandschaft mit Eisläufern und Vogelfalle“. Pieter Brueghel d. J. 1565
„Die Volkszählung“ von Pieter Brueghel, signiert und datiert 1566. Königliche Museen der Schönen Künste, Brüssel. Das Alltagsleben und die Umgebung sind typisch: die Leute, die sich in das warme Innere drängen, das Fangen und Schlachten von Schweinen in Erwartung hungriger Reisender, die Ankunft von großen Fässern, die geschäftig pickenden Hühner. Leute, die sich an einem großen Feuer wärmen, die Ausgabe von Getränken bei einem hohlen Baum, Kinder, die sich balgen und schlittern. Verkehr über einen zugefrorenen Fluss.
Unter Erik dem Roten segelten 950 die Wikinger zu einer menschenleeren Insel, auf die sie nach Anwerbung von Siedlern mit fünfundzwanzig Schiffen zur Landnahme zurückkehrten.
Die grünen Oasen (Grönland) boten den Familien mit ihrem mitgebrachten Vieh und Saatgut ein gutes Auskommen.
Rund 3000 Menschen lebten schließlich in zwei Zentralsiedlungen mit zwei Klöstern und siebzehn Kirchen. Der Hauptsitz war Brattahild.
In dieser Enklave wuchs Leif Eriksson auf, wie die um 1200 verfasste Grönlandsaga berichtet.
Im Jahr 999 wagte der junge Recke mit 35 Mann die Fahrt zum anderen Ufer.
Grabungsfunde zeigen, dass die Nordmänner 500 Jahre früher als Christoph Kolumbus mit den Eingeborenen Handel trieben. Zu den spektatkulärsten Funden gehört eine Silbermünze, die im US-Bundesstaat Maine gefunden wurde. Sie stammt aus der Zeit des norwegischen Königs Olaf des Stillen (1066 bis 1093).
Ein kürzlich erschienenes Buch des dänischen Kapitäns Søren Thirsland schildert die Langstreckentörns, die die Wikinger unternahmen.
Das Leben der Menschen in Grönland verschlechterte sich. Schafe und Rinder weideten die langsamer nachwachsende Vegetation ab, die dazu noch einsetzende Kurzeiszeit führte zur Verkarstung der Landschaft. Das Vieh starb, hungernde Menschen in nicht angepasster Kleidung erkrankten.
Die Wikinger übernahmen nicht die Lebensweise der Inuit, die im 12. bis 13. Jahrhundert aus der Arktis eingewandert waren. Mitte des 14. Jahrhunderts verließen sie Grönland und den Wissenschaftlern ist es bis heute ein Rätsel, ob sie Island, Norwegen, oder – wegen der gefährlichen Strömungen – den Meeresgrund erreichten.
Während der Hochmittelalterlichen Warmzeit kam es zu außergewöhnlichen Klima-Extremen, so im Winter 1010/1011, als der Bosporus zufror und der Nil Eis führte.
Längere Hitzephasen traten zwischen 1021 und 1040 auf. Aufzeichnungen in Archiven berichten, dass 1022 Menschen auf den Straßen vor großer Hitze verschmachtet und erstickt seien. Bäche und Flüsse trockneten aus.
Unter Kaltlufteinbrüchen dauerte 1118 der Frost bis in den Juni an. Die Lagune von Venedig war zugefroren und man konnte über das Eis bis ins Zentrum der Republik reiten. Im Jahr 1234 waren die Lagune und auch der Po erneut zugefroren.
Ab 1180 überwogen in einer sehr langen Warmphase heiße Sommer und mildeste Winterdekaden. Im Januar 1186 blühten bei Straßburg und Stuttgart die Bäume, im Februar waren die Äpfel schon haselnussgroß.
Der Sommer 1130 war so trocken, dass man durch den Rhein waten konnte, 1135 führte die Donau so wenig Wasser, dass man sie zu Fuß durchqueren konnte. Das Niedrigwasser wurde zum Legen der Fundamente für die Steinerne Brücke von Regensburg klug genutzt.
Unter milder Witterung schlugen Weihnachten 1289 die Bäume aus und die Kinder badeten in den Flüssen. Im darauffolgenden Februar gab es reife Erdbeeren. Auch 1328 setzte die Baumblüte stark verfrüht im Januar ein.
Nicht alle warmen Jahre waren günstig, denn oft kam es bei großer Trockenheit in Mitteleuropa zu Dürre und Waldbränden. Zwischen 1261 und 1310, nochmals zwischen 1321 und 1400 traten in Mitteleuropa die längsten Phasen anhaltender Sommerwärme auf.
1338 breiteten sich Heuschreckenschwärme von Österreich über Bayern, Schwaben bis Thüringen und Hessen aus. Neben verheerenden Fluten 1342 trat die Pest auf, Progrome setzten ein.
Für die Entwicklung der Kulturpflanzen ist das Frühjahr entscheidend und diese verliefen sehr unterschiedlich.
Es kam zu Kaltlufteinbrüchen im April und Mai ebenso wie zu milden bis warmen Frühjahren.
Verzeichnet wurden in den Chroniken meist nur negative Ereignisse. Dies trifft auch für die Erntezeiten zu, dabei hat man den Eindruck, dass ungünstige Ernteperioden Anfang des 14. Jahrhunderts deutlich zunahmen.
Die Kleine Eiszeit setzte ein.