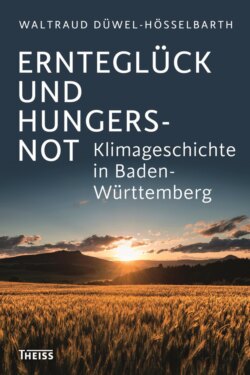Читать книгу Ernteglück und Hungersnot - Waltraud Düwel-Hösselbarth - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеHohenheimer Geschichte
Ein Streifzug durch die Entwicklung der meteorologischen Forschung
Die Eismassen, die bis zum Bussen und Hohentwiel reichten, erreichten nicht die Filderebene und den Raum des jetzigen Hohenheim.
Laut Bodenkundler Karl Stahr vom Institut für Bodenkunde der Universität Hohenheim konnten Funde von Menschen in der Jungsteinzeit von vor rund 7000 Jahren auf dem Universitätsgelände festgestellt werden. Vielleicht waren es die Mammutjäger, denn in Stuttgart wurden 1825 bei Baumaßnahmen viele Mammutstoßzähne gefunden. Diese sind leider – trotz guter Verwahrung – in den Wirren des Zweiten Weltkrieges verschwunden.
Oberhalb des Körschtales – im jetzigen Botanischen Garten – fand man Spuren aus der Zeit vor rund 5000 Jahren, als Jäger und Sammler zum Anbau von Feldfrüchten übergingen.
Zwischen den Dörfern Plieningen und Birkach stand der „Garbenhof“, ein kleines, zweistöckiges unansehnliches Schlösschen, das Herzog Carl Eugen von Württemberg seiner neuen Lebensgefährtin, der Freifrau Franziska von Leutrum, am 10. Januar 1772 zum Geburtstag schenkte und dem Heim den ursprünglichen Namen „Hohenheim“ zurückgab. Von hier nimmt die Baugeschichte Hohenheims seinen Anfang.
Der bestehende Lustgarten mit unterschiedlichsten Bäumen kam der naturverbundenen Franziska und ihren Interessen sehr entgegen. Das Paar führte nun überwiegend das Leben von Landedelleuten.
Ab 1773 wurde Schillers Vater, der Hofgärtner Caspar Schiller, beauftragt, in Hohenheim eine Obstbaumschule anzulegen. Die Felder des Hofgutes wurden von 20.000 Pappeln umgeben und an Feldwegen und Straßen wurden 18.000 Obstbäume gepflanzt, dies noch ehe mit dem Neubau des Schlosses 1785 begonnen wurde.
In Hohenheim entschied sich im Sommer 1782 für den Regimentsmedikus Friedrich Schiller das Schicksal, als er nach der Uraufführung seiner „Räuber“ in Mannheim zum Herzog Carl Eugen beordert wurde und in der heutigen Speisemeisterei vom Herzog Schriftverbot bekam, außer für medizinische Abhandlungen.
Die Nacht des großen Festes auf der Solitude war günstig, als der russische Thronfolger mit seiner württembergischen Gemahlin zu Besuch war, um Friedrich Schiller die Flucht ins Ausland antreten zu lassen, es glückte ihm am 22. September 1782.
Nach der spektakulären Flucht aus seiner schwäbischen Heimat wurde Thüringen sein neuer Lebensmittelpunkt.
In Erfurt wurde das geistig-kulturelle Leben durch die Universität und von der 1754 als eine der ersten Gelehrtenanstalt in Deutschland gegründeten „Churmaynzischen Akademie nützlicher Wissenschaften“ getragen. Ihr gehörten Persönlichkeiten wie der kurmainzische Statthalter in Erfurt, Freiherr von Dalberg, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller sowie Alexander und Wilhelm von Humboldt an. Der schwäbischen Aberkennung seiner Fähigkeiten entkommen, fand Schiller in Thüringen ein geistiges Zuhause. Schiller war nun immer öfter und längere Zeit in Erfurt, hier auch im „schöngeistigen Zentrum“ des Dacheröderschen Hauses und besonders, weil er sich hier durch die Vermittlung der schönen Tochter des Hauses – Caroline von Dacheröden – im Herbst 1789 mit ihrer Freundin Charlotte von Lengefeld verlobt hatte; am 22. Februar 1790 heirateten sie. Wilhelm von Humboldt feierte zwei Jahre später Hochzeit mit Caroline von Dacheröden.
Denkmal von Johann Caspar Schiller, dem Vater Friedrichs, in Gerlingen
In Jena war Schiller zehn Jahre Geschichtsprofessor und Schillers lebten hier in Nachbarschaft mit dem befreundeten Ehepaar Humboldt.
Seine letzten viereinhalb Lebensjahre verbrachte Schiller bis 1805 in Weimar.
Hohenheimer Gärten
Schon im Frühjahr 1776 hatten Carl Eugen und Franziska mehrmonatige Reisen nach Frankreich und England unternommen, um die Parkanlagen in Versailles und den botanischen Garten von Kew bei London sowie zahlreiche andere Parks zu bewundern und zu studieren.
Im selben Jahr besuchte der Herzog mit seinem Hofbaumeister Reinhard Fischer (wohl seinem außerehelichen Sohn) inkognito die neuen Parkanlagen des pfälzischen Kurfürsten in Schwetzingen bei Heidelberg.
Später besichtigte das herzogliche Paar auch die Parkanlagen bei Dessau, in Schwerin und die botanischen Gärten in Göttingen und Kopenhagen und die Parkanlagen um Wien.
Die Gartenkunst befand sich im Umbruch, nach den französischen Parks wurden nun die englischen Parks Vorbild, die mit gewundenen Wegen und Wiesen ein Spiel der Natur sein sollten. Hinzu kamen Gebäude unterschiedlicher Stile. Fast nirgends wurde dies mit solcher Konsequenz durchgeführt wie in Hohenheim.
Der Ausbau des Echterdinger Fasanengartens und die Entstehung des Landgutes Scharnhausen fallen in das Jahr 1783.
Im selben Jahr bekamen sämtliche Hohenheimer Gebäude eine Wetterleiter, die ersten in Württemberg überhaupt, für deren Errichtung der Herzog den Mannheimer Professor der Meteorologie Hemmer kommen ließ. Diese Maßnahme bedeutete für Württemberg einen erheblichen Fortschritt, denn der Herzog hatte auch eine Brandversicherungsanstalt ins Leben gerufen. Der Volksmund gab ihm den Namen „Feuerbanner“. Franziska kümmerte sich redlich um die Gärten und führte laufend Tagebuch. Von ihr stammen die von 1780 bis 1788 ältesten überlieferten Wetter- und Pflanzenbeobachtungen.
Gut zweihundert Jahre später (1998) freuen sich Hohenheimer Wissenschaftler und der Gartenbeauftragte Professor A. M. Steiner über die Erweiterung der Gärten rund ums Schloss und meinen: „ …wenn das noch Carl Eugen und Franziska erlebt hätten denn die Gärten haben eine Größe wie nie seit ihren Anfängen erreicht und damit ist die Grünspange von der Garbe bis hinunter zur Körsch geschlossen.
Herzog Carl bei den Bauarbeiten
Carl Eugen hinterließ mit dem Tod seine Schöpfung in völlig unfertigem Zustand und man verfügte, das Angefangene zu erhalten, aber nicht weiterzuführen.
Als Goethe am 1. September 1797 in Begleitung von Dannecker Hohenheim besuchte, wurden Fischers begonnene Arbeiten aus den Räumen herausgeschlagen. Kein Wunder, dass Goethe zu einem vernichtenden Urteil über Hohenheim kam.
Die Schlossgebäude standen leer, 1799 hatte man eine regelmäßige Überprüfung beantragt. In den Freiheitskriegen wurden sie vorübergehend als Militärhospital genutzt und übel zugerichtet.
Erst 1818 erhielt Hohenheim seine neue Bestimmung als landwirtschaftliche Akademie mit Ackerbauschule unter der Leitung des bekannten Agronomen Nepomuk von Schwerz.
Meteorologische Aufzeichnungen aus den Jahren 1838 bis 1860 und 1870 bis 1872 wurden zwar veröffentlicht, doch wegen Lückenhaftigkeit nicht zu wissenschaftlichen Auswertungen herangezogen. Erst ab 1878 liegen zuverlässige Ergebnisse der Messungen und Witterungserscheinungen vor, die bis 1975 vom Deutschen Wetterdienst und seither im Institut für Physik und Meteorologie der Universität Hohenheim ausgewertet werden.
Von hohem Wert ist die Meteorologische Station Hohenheim, denn sie besitzt eine der seltenen Säkular-Reihen, d.h. es besteht eine lückenlose Messreihe seit 1878, wobei die wichtige Forderung nach Homogenität erfüllt ist. Die Messorte blieben bezüglich der Meereshöhe unverändert. Sie wurden nur verlegt, wenn bauliche Maßnahmen in näherer Umgebung von der Station vorgenommen wurden.
Die Klimareihe ab 1878 hat eine besondere Bedeutung in ihrer eindrucksvollen Beziehung zu den Forschungen der Institute für Obst-, Wein- und Pflanzenbau der Universität Hohenheim.
Nach der 800-jährigen Klima- und Wetterbeschreibung wurden grafische Darstellungen erstellt.
Beim Recherchieren und Aufspüren der Aufzeichnungen vieler Chronisten, deren Beobachtungen die Grundlage für die Beschreibung der letzten 800 Jahre bilden, halfen kenntnisreiche Archivare und Bibliothekare des Stuttgarter Staatsarchivs sowie der Landes- und Hohenheimer Universitätsbibliothek.
Die 25-jährige Tätigkeit in der Agrarmeteorologie des Deutschen Wetterdienstes und im Institut für Physik und Meteorologie der Universität Hohenheim mit phänologischen Beobachtungen und Beratungen der Institute ließ erkennen, dass langjährige Rückblicke auf die Veränderlichkeit des Klimas, verbunden mit den daraus resultierenden Ergebnissen in der Vegetation, notwendig sind, um für die Gegenwart und Zukunft schlüssige Erkenntnisse zu ziehen.
Aus diesem Grund verfasste ich bereits zum hundertjährigen Bestehen der Wetterstation Hohenheim die „Chronik der Hohenheimer Meteorologischen Beobachtungen 1878–1977“, die inzwischen von meiner Nachfolgerin Dipl. Met. Inge Henning-Müller bis zum Jahr 2008 erweitert wurde.
Welche Auswirkungen die Witterungsverhältnisse auf den Anbau und den Ertrag der Feldfrüchte sowie auf Obst und Wein und damit auf das alltägliche Leben der Menschen hatten und oft jahrelange Hungersnöte verursachten, wird ebenso geschildert wie die witterungsbegünstigte Hochmittelalterliche Warmzeit mit meist guten Ernten, Bevölkerungswachstum, Bautätigkeit und dem Aufblühen von Kunst und Kultur.
Die Dynamik und Natürlichkeit der Klimaänderungen steht außer Frage, ebenso aber auch die massiven Eingriffe in die Natur durch den Menschen sowie die Verursachung enormer Luftverschmutzung, die die Belastung der Atmosphäre und für die Verursacher auslöst.