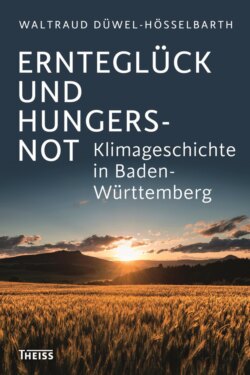Читать книгу Ernteglück und Hungersnot - Waltraud Düwel-Hösselbarth - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zum Geleit
Оглавлениеvon Prof. Dr. Dr. Adolf Martin Steiner
Der Begriff Klima steht für die Gesamtheit aller meteorologischen Bedingungen einer größeren Region über einen längeren Zeitraum hinweg, der Begriff Wetter steht für das Klima zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort, und unter Witterung versteht man das Wetter in einem bestimmten, kürzeren Zeitabschnitt in einem begrenzten Gebiet. So hängen die Lebensbedingungen des Menschen grundlegend vom Klima ab, doch jeden Augenblick vom Wetter. Ständig wechselt das Wetter, aber jedermann weiß, dass sich auch das Klima schon immer änderte. In historisch dokumentierter Zeit kennen wir das Optimum der Römerzeit mit Wein- und Obstbau, das frühmittelalterliche Pessimum mit der Völkerwanderung, die mittelalterliche Warmzeit mit Landwirtschaft in Grönland und der Blüte des Staufer-Reichs, die nachfolgende kleine Eiszeit mit großen Hungersnöten und schließlich die seit etwa 1900 einsetzende Wiedererwärmung. Diese Klimaphasen unterschieden sich durch mittlere Temperaturunterschiede von 1,5–2,5 °C.
Die Erwärmung in den vergangenen 100 Jahren um knappe 0,8 °C ging mit einer durch die Industrialisierung bedingten Zunahme des CO2-Gehalts und klimarelevanter Gase in der Luft einher. Diesen Gasen misst man einen Treibhauseffekt zu. Deshalb ging man davon aus, dass hier ein Zusammenhang bestünde. So schloss man auf eine durch den Menschen verursachte Klimaerwärmung. Der im Rahmen der Vereinten Nationen 1988 gegründete Weltklimarat (IPCC) verstand es, diese Erwärmung als globales Phänomen bekannt zu machen und als große Gefahr für unsere Lebensbedingungen herauszustellen. Damit wurde der Klimawandel in erstaunlich kurzer Zeit ein weltweit zentraler Gegenstand der Politik, der Wirtschaft und des Lebens jedes Bürgers. Kein anderes der wahrlich großen und drängenden Probleme der Menschheit wie beispielsweise Bevölkerungsexplosion, Hunger und Wassermangel oder Krieg und Vertreibung erreichte einen derart spektakulären Bekanntheitsgrad wie der Klimawandel.
Die Aufgabe des Weltklimarats ist es, auf streng wissenschaftlicher Grundlage Risiken der globalen Erwärmung zu beurteilen sowie Vermeidungs- und Anpassungsstrategien zusammenzutragen, die Aufgabe der Politik ist es, notwendig erscheinende Maßnahmen sinnvoll umzusetzen, und die Aufgabe der Wirtschaft und des Bürgers ist es, die teuren Konsequenzen zu tragen. Hier ging nun aber in jüngster Vergangenheit Entscheidendes schief. Zum einen gibt es immer noch keine wissenschaftlich gesicherten Voraussagen über die künftige Klimaentwicklung. Die errechneten Modelle liefern unterschiedliche Szenarien, täglich kommen neue Forschungsergebnisse hinzu, und alte Daten werden obsolet. Zum anderen haben sich der Weltklimarat und bedeutende nationale Klimaforschungsinstitute selbst ins Abseits gestellt. Nachweislich falsche Prognosen, Unregelmäßigkeiten, Übertreibungen, Eitelkeiten und kollegiales Fehlverhalten führten zu einem tiefgreifenden Vertrauensverlust. Wissenschaftlichkeit wurde Einflussnahme und Eigennutz geopfert, politisches Handeln durch Opportunismus und Schaueffekte bestimmt. Die so eingetretene Glaubwürdigkeitskrise erfordert einen völligen Neuanfang, was einige Jahre in Anspruch nehmen wird. Fazit: Wir wissen nichts Gewisses über den Verlauf des Klimawandels, und die Klimaforscher und Politiker haben ihre Vertrauenswürdigkeit verspielt.
Was nimmt der interessierte und betroffene Bürger in Deutschland wahr? Hier wird nicht von Klimawandel, sondern gleich von Klimakatastrophe gesprochen, Klimaangst wird geschürt. Doch der Begriff Klimakatastrophe tauchte schon einmal auf, Anfang der 1970er-Jahre, als man eine Abkühlung der Erde befürchtete. Jetzt, 45 Jahre später, ist die Klimakatastrophe die befürchtete Erwärmung. Neuerdings wird nun aber berichtet, dass wegen mangelnder Sonnenaktivität für die kommenden Jahre wieder mit einer Abkühlung zu rechnen sei; erneut eine Katastrophe? Und übrigens, seit zehn Jahren blieb die globale Mitteltemperatur praktisch konstant, keine Abkühlung, keine Erwärmung, was regionale Änderungen jedoch nicht ausschließt. So wird es beispielsweise derzeit in Europa und in der Arktis wärmer, in den westpazifischen Anrainerstaaten Nord- und Südamerikas und in Arabien kälter. Solche regionalen Unterschiede gab es schon immer.
Die Forderung, dass bis Ende dieses Jahrhunderts eine Temperaturerhöhung von maximal 2 °C nicht überschritten werden dürfe, weil dann „ein Leben auf unserem Planeten, wie wir es bisher kennen, nicht mehr möglich wäre“ (der frühere Bundesumweltminister Dr. Norbert Röttgen, CDU), ist unseriös, weil diesem Wert die wissenschaftliche Grundlage fehlt. Dieser schlicht geschätzte Wert wurde aber vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung (WBGU) übernommen. Denn das „Zwei-Grad-Ziel“, auch „2-Grad-Max“ betitelt, erschien den Politikern so griffig, dass sie es zur Richtschnur erhoben. Doch was passiert, wenn die Temperatur nur um 1 °C weiter steigen sollte, oder aber wenn sie gleich um 3 °C oder 4 °C stiege? Weder die Welt noch die menschliche Gesellschaft würde dem Untergang entgegen gehen. Sicherlich würde sich gegenüber dem Zustand von heute vieles ändern, was aber über die Generationen hinweg und mit moderner Technik wohl zu meistern sein würde. Übrigens, für das Zukunftsszenario wird immer der bisherige Verlauf extrapoliert, derzeit also die Erwärmung. Wie aber hätte es ausgesehen, hätte man die mittelalterliche Klimaerwärmung damals einfach so extrapoliert? Tatsache ist, dass Klimaänderungen bisher immer in Sprüngen auftraten, ein Auf und Ab. So kam, wohlgemerkt, nach der mittelalterlichen Klimaerwärmung die kleine Eiszeit. Und abgesehen davon wird der Einfluss wichtiger Größen wie beispielsweise der Wolkenbildung und in diesem Zusammenhang auch des Flugverkehrs sowie von Staubpartikeln in der Atmosphäre noch nicht hinreichend verstanden, die Bedingungen, die die Höhe des Meeresspiegels und die Meeresströmungen verursachen, sind nur ansatzweise bekannt, und die Bedeutung der Vegetation für das Klima wird eben erst erforscht. Die Klimamodelle sind unvollständig. Auch der häufig zitierte Zusammenhang zwischen dem Temperaturanstieg und der Zunahme von Naturkatastrophen ist wissenschaftlich nicht nachweisbar, er stammt, wohl verständlich, aus Klimaszenarien der Versicherungswirtschaft. Ja, man weiß noch nicht einmal, welcher Anteil der bisher festgestellten Erwärmung natürlich ist, und welcher durch den Menschen bedingt ist. Das einzig sicher Nachgewiesene sind die Zunahme des CO2-Gehalts und von klimarelevanten Gasen in der Atmosphäre und die Erwärmung im 20. Jahrhundert, die nun seit 2000 zum Stillstand kam. Ein Zusammenhang ist aber gleichwohl nicht zwingend. Denn mit Sicherheit war die mittelalterliche Warmzeit nicht durch Industrialisierung, Autoverkehr und Hausbrand verursacht, wie nachweislich die Warmzeiten zwischen den Eiszeiten nicht durch einen Anstieg des CO2-Gehalts und klimarelevanter Gase eingeleitet wurden. Große Wissenslücken sind noch zu füllen, viele Widersprüche zu lösen, überholte Daten und Fehlschlüsse auszusondern. Kurzum, es wurde in den letzten Jahren vieles als Gewissheit verkauft, was nicht gewiss war. Die Alarmisten und die Skeptiker stehen sich gegenüber, und keine der beiden Seiten kann verlässlich sagen, was in 10, 20 oder gar 50 und 100 Jahren sein wird. Klimakatastrophe sagen die einen, Klimalüge die anderen, es herrscht Ratlosigkeit. Immerhin haben wir die Temperatur, die vor 1000 Jahren in Grönland Landwirtschaft erlaubte, noch nicht wieder erreicht.
Die Vertrauenskrise an der Klimafront zeitigte schon Wirkung. Hatten 2006 in Deutschland mit 62 % nahezu zwei Drittel der Bevölkerung Angst vor einer Veränderung des Klimas, waren es 2010 nur noch 42 %. Die vom Klimarat und der Politik aufgebaute Drohkulisse verliert an Kraft. Denn der politisch forcierte Totalumbau der Wirtschaft unter dem Vorwand der Klimaerwärmung, raus aus dem Öl und der Kohle und rein in alternative Energien und Klimaschutzprojekte, kostet die Bürger Unsummen Geld. Ein Beispiel: 2009 kostete es über 700 Euro, um mit Solarenergie 1 Tonne CO2 einzusparen, die der Erde einen geschätzten Schaden von 4 Euro verursacht. Dabei wird die von der Bundesregierung bis zu diesem Zeitpunkt mit 53 Milliarden Euro subventionierte Solarenergie die angenommene Erwärmung bis zum Ende unseres Jahrhunderts global gesehen gerade einmal um 1 Stunde (!) aufschieben. Inzwischen wurde wegen der absurden Förderungspolitik der Subventionsbetrag bis 2013 schon auf 70 Milliarden Euro geschätzt, und das Programm läuft, immerhin leicht gekürzt, immer weiter. Dazu muss noch angemerkt werden, dass der Anteil der Solarenergie am Stromaufkommen Deutschlands gerade einmal 1,1 % beträgt! Und nicht zuletzt, dieses Geld fehlt dringlich zur Förderung der Weiterentwicklung wesentlich effektiverer Verfahren zur Gewinnung erneuerbarer Energie. Was soll das also? Das ist eine wohlmeinende, aber verfehlte Politik auf Kosten der Bürger und der Wirtschaft. Schlüsselnationen wie die Energieriesen USA, China und Indien mit Brasilien und Südafrika im Schlepptau (USA und BASIC-Staaten) kümmert das sowieso wenig. Ihr in Kopenhagen selbst verpflichteter Einsparwille ist ein politisches Lippenbekenntnis, denn ein verpflichtendes, globales Abkommen kam nicht zustande, und ein solches wird es in überschaubarer Zukunft auch nicht geben. Als Bürger sollte man aber doch annehmen dürfen, dass die Politiker bei Klimaschutzmaßnahmen auf Kosten des Steuerzahlers Augenmaß und Zurückhaltung üben, die Effizienz voranstellen und auch die mangelnde Kooperationsbereitschaft der Staatengemeinschaft berücksichtigen. Denn ein nationaler Alleingang ist sinnlos und wirtschaftsschädlich, und die nach dem Fehlschlag in Kopenhagen neuerdings angedachten Teillösungen sind es ebenso. Aber nein, politisch wird von Deutschland weiter eine Vorreiter- und Führungsrolle propagiert und von Entscheidungsträgern zur Profilierung genutzt. Man erinnert sich an Bundeskanzlerin Angela Merkel als Mahnerin im roten Anorak vor gleißendem Grönlandeis und als überspielte Wortführerin im Kreis der Mächtigen in Kopenhagen. Der brave Bürger aber zahlt.
In diese wissenschaftlich und politisch verfahrene Situation hinein veröffentlicht Frau Düwel-Hösselbarth ihr Buch „Ernteglück und Hungersnot – Klimageschichte in Baden-Württemberg“. Doch sie bringt als langjährig erfahrene Meteorologin keine großen Theorien und Klimamodelle ein oder gibt gar spekulative Ausblicke auf die Zukunft. Nein, sie betrachtet ganz einfach die Klimaentwicklung seit der Eiszeit und berichtet ab dem 13. Jahrhundert aus historischen Quellen lückenlos über den Witterungsverlauf jedes einzelnen Jahres. Zunächst führt sie in Übersichten in die Erd- und Klimageschichte ein, wobei sie dem Einfluss der Sonne eine eigene Betrachtung widmet. Sie schildert den Zusammenhang zwischen dem Klima und dem Leben und der Kultur am Beispiel der hochmittelalterlichen Warmzeit. Dem Wein als wichtigem pflanzenbaulichen Erzeugnis und phänologischem Klimazeiger mit Blüh- und Erntetermin sowie dem Niederschlag oder Wasser als lebenswichtigem, aber zugleich auch zerstörerischem Naturelement widmet sie besondere Ausführungen. Und dann folgt die erwähnte genaue Schilderung der jährlichen Witterung und der Wein- und Getreideerträge ab dem 13. Jahrhundert. Greifen wir aus der von Frau Düwel-Hösselbarth dargestellten Datenfülle einige extreme Witterungsereignisse heraus, zum einen als Anreiz zur Lektüre, zum anderen, weil wir heute oft denken, das Normale sei schon das Außergewöhnliche. Betrachten wir einmal einige kalte Winter: 1011 fror der Bosporus zu und der Nil führte Eis, 1118 und 1234 war die Lagune von Venedig zugefroren, 1561 war es so bitterkalt, dass im Wald mit Donnerknall die Bäume platzten, eine Kälte, die bis 1900 noch fünfmal auftrat, 1573 fror der Bodensee am 2. Februar zu und blieb 60 Tage lang begehbar, 1658 waren alle Flüsse und die Ostsee zugefroren, in den Ställen erfror das Vieh, in den Kellern das Obst, Karl X. von Schweden überquerte mit 20.000 Soldaten auf dem Eis den kleinen Belt, in Stuttgart gab es im Juni noch Reif und die Weinlese fiel aus, 1709 froren der Bodensee und fast die ganze Adria zu und 1740 war das kälteste Frühjahr seit 500 Jahren. Übrigens, die letzten „großen Winter“ waren 1829/30 und 1962/63 mit Schneemassen, totaler Bodenseegfrörne und wochenlang zugefrorenen Flüssen, selbst Vater Rhein trug eine Eisdecke. Betrachten wir demgegenüber einige trockene und warme Jahre: 1130 war so trocken, dass man zu Fuß durch den Rhein waten konnte, 1135 führte die Donau so wenig Wasser, dass die Bauleute bequem die Fundamente für die Brücke von Regensburg legen konnten, 1289 schlugen nach einem warmen Sommer bei milder Weihnachtswitterung die Bäume aus und die Kinder badeten in den Flüssen, 1304 war ein extrem heiß-trockenes Jahr mit der Weinlese im Juli und einer verheerenden Wassernot, 1540 kam dann der „Jahrtausendsommer“, denn Mitteleuropa war zehn bis zwölf Monate in den Tropengürtel einbezogen: Ab Februar herrschte sommerliche Hitze, bei extremem Wassermangel standen Mühlen und die Schifffahrt still, fußbreite Spalten durchzogen den Boden, Waldbrände wüteten, die Trauben vertrockneten und ergaben einen Jahrhundertwein, und erst im November kam ein Kälteeinbruch mit Regen, 1686 versiegten schon im Winter Quellen und die Trockenheit hielt bis zum Herbst hinein an, 1834 fiel der Winter aus und am 16. Januar blühten in Stuttgart die Obstbäume, 1865 führten extreme Trockenheit und Dürre bei geringem Ertrag zu einem Jahrhundertwein bei einem Wassermangel, der so groß war, dass man noch im Dezember auf der Schwäbischen Alb den Reif von den Bäumen sammelte. Der viel zitierte, trockene, und seit 1901 heißeste Sommer 2003 war somit wohl extrem, doch er hatte viele Vorläufer.
Spannend und beängstigend zugleich sind solche Extreme. Und dann füge man noch die Überschwemmungen, die Hagelschläge, die Heuschrecken-, Raupen- und Mäuseplagen und das bisweilen ausgleichende, oft aber auch verstärkende Wechselspiel aller Bedingungen in der Abfolge der Monate und Jahre hinzu. Man denke auch an Vulkanausbrüche, wie die des Lakis 1783, des Tambora 1815, des Krakatau 1883 oder jüngst des Pinatubo 1991. Bei Vulkanausbrüchen werden Energiebeträge frei, die das menschliche Vorstellungsvermögen sprengen, und Massen an klimaschädlichen Gasen und Partikeln in die Atmosphäre geschleudert, die unfassbar sind. Da werden Abgasnormen und Dämmfaktoren Makulatur. Beispielsweise folgte dem Ausbruch des Tambora weltweit das „Jahr ohne Sommer“, das kälteste Jahr, seit es Wetteraufzeichnungen gibt. Solche Ausbrüche senkten die Jahresmitteltemperaturen auf der Nordhalbkugel oftmals für mehrere Jahre um 0,5–0,8 °C und verursachten Missernten. Man denke vor allem aber an die verheerenden Hungersnöte und unheilvollen Wassernöte, die einst mit den Klimaextremen einhergingen, und die wir heute in internationaler Wirtschaftsverflechtung und mittels moderner Technik unschwer abzuwenden in der Lage sind; wir verbrennen wegen verheerender Unwetter keine Hexen mehr. Alles solches und eine Fülle von Primärdaten finden sich im Buch von Frau Düwel-Hösselbarth. Mit einer kleinen Nachlese rundet sie es ab. In dieser spricht sie angesichts der globalen Verstädterung noch das Stadtklima sowie den vielfältigen Einfluss des Menschen durch Flugverkehr, Touristik, Rohstoffgewinnung und Landwirtschaft auf das Wetter und Klima an.
Zu welchem Schluss kommt nun Frau Düwel-Hösselbarth mit Blick auf die Klimadiskussion? An einer Stelle schreibt sie, dass sich die jüngst beobachtete Erwärmung wohl einst wieder zu kühleren Temperaturen hin einpendeln würde, so wie das bisher immer war. Zum Schluss aber zitiert sie einen Wissenschaftler, der angesichts der dramatischen Zunahme der Weltbevölkerung mit allen damit verbundenen Konsequenzen die Erde einem Kollaps entgegengehen sieht.
Und welche Meinung hat der Geleitwortschreiber selbst? Die wissenschaftliche und politische Situation ist derzeit alles andere als hilfreich, und die Beschreibung des Klima- und Witterungsverlaufs seit Jahrtausenden zeigt ein ständiges Auf und Ab. Bleiben wir also, bis wir mehr wissen, einfach bescheiden beim alten Bund seit der Sintflut, jener großen Flutkatastrophe, der die Menschheit fast zum Opfer fiel: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht“ (1. Mose 8, 22). Und es gibt immer noch den Regenbogen als das Zeichen dafür.