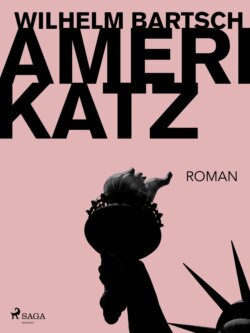Читать книгу Amerikatz - Wilhelm Bartsch - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Von Jerewan nach Pankow
ОглавлениеMein Name Micah Macrobius ist durch und durch armenisch, außer in seinen beiden lateinisch abgetarnten »c« und seinem Suffix. Aber das wollten Mutter und Großmutter so. Ein Ambrosius Macrobius war nämlich im 5. Jahrhundert Oberstadtkämmerer von Konstantinopel gewesen. Man darf ihn nicht verwechseln mit dem dann im Mittelalter berühmt gewesenen Schriftsteller Ambrosius Macrobius, der die »Saturnalia« geschrieben hat und nach dem heute ein großer Krater nahe dem Mare Crisium auf dem Mond benannt ist. Mit sechzehn Jahren hatte jedenfalls der Konstantinopler Ambrosius Macrobius ein Kind gezeugt, bevor er zwecks byzantinischer Beamtenlaufbahn kastriert wurde. Ohne dieses Kind würde ich selber, 1500 Jahre später, nicht existieren. Ambrosius Macrobius stammte aus Armenien, das ungefähr das Alter vom Berg Ararat hat und an einer sehr seltenen Erschöpfungskrankheit leidet, nämlich rein gar nichts vergessen zu können.
Armenien hat, sagen manche Armenier, vor allem zwei Fehler: ein viel zu tiefes und langes Gedächtnis und die schönsten Frauen von der Welt mit leider oft zu kurzen Beinen.
Ohne das Armenische könnten weder Jans Geschichte noch meine verständlich werden. Meinen armenischen Stammbaum zu rekonstruieren schien bei der katastrophalen Geschichte der Armenier völlig unmöglich zu sein – ich hatte das schon mal in den neunziger Jahren versucht und bin dann doch lieber bloß Detektiv geworden, eine an sich sehr harmlose Variante des Spitzels. Das muss mir ein bisschen im armenischen Blut gelegen haben. Der unenträtselbar böse Georgier Stalin hat 1949 alle Exil-Armenier aufgerufen, heimzukommen, um diese jahrtausendelang eigenwillige Brut in seinem Reich zu haben zur Entschärfung ihres Geistes und zu ihrer Dezimierung zu einer nationalen Minderheit unter der Sollgrenze zu einer Sowjetrepublik. Hunderttausende waren daraufhin aus aller Welt aufgebrochen, auch aus Griechenland, darunter eine gewisse Familie Makrobyan mit einem vierzehnjährigen Sohn namens Archag. Man trennte im grauen Hafen von Batumi Frauen und Kinder von den Männern, wovon die meisten für immer nach Sibirien verschwanden, aber die so eingefangenen Kinder versuchte man in der Folge, und oft mit guter Aussicht, zu Spitzeln und Spionen zu erziehen.
Archag landete in der Aserbaidshanischen Sowjetrepublik, in der grauenerregenden und nichtsdestotrotz wunderschönen Stadt Shusha, heute das armenische Shushi in Nagorny Karabach. Ab 1950 studierte er dann in Armenien selbst, nämlich Hydrotechnik in Jerewan, wo es schon zu jener Zeit weltberühmte Fakultäten und Institute für das Buchwesen und für Mathematik und Astronomie gab. Dort lernte er meine Großmutter Gerti Netzeband kennen, die schon mit sechzehn im Jahr 1950 als vielversprechendes Mathematiktalent aus Oderberg im Kreis Eberswalde nach Jerewan zum Studium verschickt worden war. Dort geriet sie schließlich an Archag, der sie im Sturm eroberte und nach vielem Hin und Her mit den Behörden auch heiraten durfte. Die Ehe scheint unter keinem guten Stern gestanden zu haben, schon weil sich Archag bald nicht nur als außergewöhnlich eifersüchtig, sondern überhaupt als sehr rach- und herrschsüchtig herausgestellt haben soll, besonders gegen die deutschen Kriegsverbrecher. Das und vielleicht auch das doch nicht so große Mathematiktalent meiner Großmutter waren wohl der Anlass, dass sie das Studium abbrechen musste. Außerdem kam 1951 meine Mutter Micaela zur Welt, und zwar kurzentschlossen, nämlich in einem ehemaligen türkischen Bad in Shushi unter glücklicher Mithilfe eines anderen Mannes.
Archag soll außer sich gewesen sein und Gertie sogar im Kindbett geschlagen haben. Das sei Omas Glück gewesen, denn einer Scheidung habe nichts entgegengestanden, weil diese Schläge angesichts eines dann gerichtlich protokollierten Zeugen, eines aserbaidshanischen Sowjetbürgers, geschehen waren.
Gertie wurde dann Rechenlehrerin an einer Grundschule in Bernau und konnte dort mit ihren armenischen Mathematikkünsten punkten. Oma Gertie ließ unseren Hinternamen für nicht wenig Geld amtlich von Makrobyan in Macrobius zurückverwandeln und hatte es somit geschafft, ihrem aufdringlichen Ex weit bis in das 5. Jahrhundert hinab zu entfliehen. Micaela, nun ganz in den Händen einer alleinerziehenden Lehrerin, wollte als Kind immer zum Vater. Später begnügte sie sich mit anderen Männern. Sie wurde schließlich Kellnerin in Berlin-Pankow.
Ich wurde 1969 als Blumenkind geboren. Micaela hat sich von mir den Wurm, der mich gezeugt hat, nie aus der Nase ziehen lassen – vermutlich kamen gleich ein paar solcher Würmer in Frage.
Ich habe also gar keinen Vater, nur einen Großvater in Nagorny Karabach – und den konnte mir Micaela nicht auch noch so madig machen, wie es meine Großmutter Gertie heute noch zu tun beliebt.
Immerhin hatte ich wenigstens eine Reihe von Ersatzvätern gehabt. Ich habe sie alle ausgenutzt, schließlich brauchten die mich, um sich bei Micaela einzukratzen – ich hatte schon eine ziemlich scharfe und mich oft nervende Mutti.
Seit sie tot ist, fehlt sie mir hin und wieder sogar sehr. Sie wurde 1990 in unserer Wohnung anscheinend von einem ihrer Lover erschlagen oder war bei einer handfesten Auseinandersetzung unglücklich gestürzt und sterbend alleingelassen worden.
Da war ich gerade bei Tante Lilo bei der Kirschernte in Odra Gora, also in Oderberg, gewesen und habe anschließend auf eigene Faust versucht, den Täter zu finden und zu überführen. Das war mir anscheinend auch gleich in einer Kneipe auf dem Prenzlauer Berg gelungen. Der Kerl ging sogar mit mir Würstchen zum ABV, aber ausgerechnet die Polizei war aus Versehen auf Beweise dafür gestoßen, dass er diese sogenannte fahrlässige Tötung gar nicht begangen haben konnte. Wie auch immer: Meinen »ersten Fall« hatte ich mit Bravour gelöst. Mir ist bei dieser Gelegenheit schon klargeworden, was mir von Anfang an im Blut lag: Ich liebte es, Welt und Leute auszukundschaften und dabei, wenn es sein musste, so weit wie möglich zu gehen. Ich liebe noch die schlechteste Wirklichkeit, selbst die virtuelle. Meine Lieblingsbeschäftigung an PC und iPad ist das Mappen, etwa die Spree von ihren Quellen bis an ihre Mündung entlangzufahren oder mir mit Streetview schon mal anzuschauen, wo ich hin muss in einer Stadt. Ich bin wahrlich eine Art Bartenwal, der weit umherschwimmen muss, um seinen Krill zu kriegen.
Aber genau deswegen war ich auf Hilfe und guten Willen angewiesen, nicht täglich, aber in wichtigen Augenblicken schon. Den Kerl mit Schnauzbart auf dem Pferd im Kaukasus, meinen Großvater, habe ich mir niemals ausgeredet, weil ich ihn als Kind als meinen stärksten, wenn auch abwesenden Beschützer verstand. Hat er mir damals geholfen? Ganz bestimmt, denn ich wollte es einfach so, und auch deshalb wohl konnte ich mir meistens selber helfen.
Auf die vielen Briefe, die ich Opa Archag jahrelang aus meinem Heim bei Berlin geschrieben hatte, hat er nie geantwortet. Mann, Opa! Vor einigen Jahren habe ich das Briefeschreiben an meinen Großvater schließlich ganz bleiben lassen.
Einmal aber hatte ich doch noch eine unstillbare armenische Sehnsucht bekommen.
Ich hatte 1994 eine Freundin namens Katharina Wink, eine Berliner Jungautorin, die ein Stipendium in Wiepersdorf genussvoll verzehrte. Als ich sie das erste Mal besuchte, kam ich zunächst an den Ateliers links des Parks vorbei und sah in einer besonders ausgestatteten Wohnung dort einen kühnen Maestro mit weißer Nackenmähne. Er war gerade dabei, auf einem Piedestal mit sorgsam gerichtetem Spitzendeckchen neben dem Flügel etwas Schweres vorsichtig aufzustellen. Ich sah noch, wie der Maestro zurücktrat mit kritisch zurückgeneigtem Kopf. Er hatte eine Büste platziert. Es war seine eigene.
»Ach, Avet!«, lachte meine völlig unehrfurchtsvolle Freundin Katja, als ich auf den Maestro zu sprechen kam. »Der ist okay. Richard Wagner könnte sich von dem noch ne Scheibe abschneiden. Der hat mich ohne Zögern zu seiner deutschen Sekretärin verpflichtet. Charmöser geht’s gar nicht!« Sie spielte mir eine Sinfonie von Avet Terterjan vor, die eigensinnig, aber klug auf nur einem Ton der Tonleiter bestand, aber mit dem vulkanischen Orchester dabei unglaubliche musikalische Katarakte erzeugte und mit einem archaischen Schlagwerk hinterrücks zugange war. Bei jedem dieser Schläge – oder Stöße? – zuckte Katja zusammen und stieß wohlige kurze O’s aus.
Nicht dass ich allzu eifersüchtig gewesen wäre, aber wir trennten uns wohl auch deshalb, weil sie ein Jahr später den genialen armenischen Komponisten Avet Terterjan zur Uraufführung seiner 12. Sinfonie nach London begleitet hat. Avet Terterjan starb gleich danach in London, und Katja, knochenfahl und ohne jeden Berliner Humor, erzählte mir gar nichts. Sie hat sich dann erholt, war wieder fast dieselbe, aber ohne Flamme für mich. Bei mir war die Flamme übrigens auch aus, aber wenn wir uns irgendwo wiedersehen in Berlin, sind wir gute alte Freunde.
Dreizehn Jahre später, also quasi erst neulich, fuhr mir ein Stich durchs Herz, als ich Katja von fern in der Bänschstraße in Friedrichshain aus dem uruguayischen Restaurant kommen sah. Ich hätte nach ihr rufen können, aber sie selber, spürte ich, war gar nicht der Anlass für meinen Stich durchs Herz.
Am selben Abend schrieb ich noch einen letzten Brief an meinen Großvater, vielleicht, um mich von dem Kind in mir zu verabschieden. Es war ein sehr kurzer, vielleicht auch etwas frecher Brief, denn ich unterzeichnete ihn mit Ambrosius Macrobius, der zur Feier seines 1500. Geburtstags einlädt. Im Absender hatte ich mich Micah Makrobian in eigens besorgter armenischer Schrift genannt.
Zwei Wochen später erhielt ich von meinem tatsächlichen Großvater eine unverhoffte Antwort. Es war ein A4-Brief, sodass ich mich auf etwas Spannendes und Schönes gefasst machte und den Brief mit den seltsamen Stempeln und den zackenlosen Briefmarken erst einmal zwei Hochglanztage lang gar nicht anrührte.
Dann hielt ich es nicht mehr aus und öffnete den Brief mit dem Brieföffner aus Messing, den ich mir extra dafür in »Mecki’s Basar« gekauft hatte. In Archag Makrobyans Brief stand auf russisch nur eine karge Einladung und wo genau er, allerdings weder telefonisch noch elektronisch, zu finden sei, nämlich in Stepanakert, Republik Nagorny Karabach.
Die anderen Papiere in der groben Tüte waren neun dicke A4-Blätter mit aufgemalten Schuhsohlen und die dazu gewünschten Modelle und Farben von »New Balance«, und zwar möglichst handgemachte wie aus dem »magasin i malenkaja fabrika tufli« auf der Fifth Avenue Nummer 150 in New York. Wow! Ich war völlig geplättet.
Tage später dachte ich aber nur noch: So sind wir Makrobiane! Ich guckte mir die Schuhsohlen auf den neun Blättern täglich an und war wohl von Tag zu Tag immer stolzer darauf, dass »wir Makrobiane« vermutlich mehr Vorfahren pro Jahrhundert haben als jeder andere Armenienstämmige. Vielleicht haben die Macrobius/Makrobians ja nur deshalb überlebt, weil sie meist im Alter von sechzehn bis zwanzig schon gezeugt hatten, noch ehe sie kastriert oder in den Katastrophenecken Südosteuropas und Eurasiens umgebracht werden konnten. Ich hingegen war schon mehr als vierzig Jahre alt und sollte so langsam aufpassen, dass wir Macrobiusse hier in Deutschland nicht aussterben.
Fast hätte ich ein paar Tage später Großvaters Brief zu einem meiner zweiwöchentlichen Besuche bei meiner Großmutter Gertie nach Bernau mitgenommen, um sie noch einmal auszuhorchen, aber schließlich fuhr ich nur dorthin, um sie zu erfreuen, nicht um sie aufzuregen.
Als ich mir Archags aufgemalte Schuhgrößen beim zweiten Mal, und da als Detektiv, vor die Augen gehalten hatte, sah ich einen ziemlich großen und noch sehr fitten Endsiebziger mit Frau und zwei angeheirateten Tanten, eine davon mit Kerl, zwei Teenagern und einem noch ziemlich kleinen Kind vor mir. Dabei fühlte ich mich ein wenig traurig, denn ich gehöre ja ein bisschen zu diesen ewigen Wanderern, die anscheinend nur solche Spuren auf schlechtem Papier hinterlassen. Der ewig wandernde Ahasver ist nämlich armenischen Ursprungs, wie ich inzwischen nachlesen konnte. So soll es unter anderem in der englischen Chronik des Matthäus von Paris aus dem 13. Jahrhundert stehen.
Woher ich so etwas weiß und woher ich meinen armenischen Stammbaum ohne Antwort aus Armenien so genau kenne? Vor drei Jahren war ich in Los Angeles zu Gast gewesen bei der A. A. A. A., der Armenian Ancestors’ Association of America. Es hatte sich dort als so ziemlich verbrieft herausgestellt, dass ich nicht nur ein DDR-Bürger a. D. bin, sondern auch vermutlich einer der blaublütigsten AOPs auf Erden. AOP bedeutet Armenian of Old Past. Das Unwahrscheinliche eines so dünnen Fadens meiner Herkunft durch Gegenden und Jahrhunderte, in denen selbst noch die dicksten Seile meist pulverisiert werden, begleitet mich seither und lässt mich Verbindungen manchmal noch da erblicken, wo gar nichts mehr ist, um verbunden zu werden.
Aber ich war auch ein Armenian of the Present, seitdem mir neun Schuhgrößen auf DIN-A4 geschickt worden waren und ich urplötzlich nicht mehr solo, sondern sogar zu zwölft war. Gerti hat zwar nicht einen Tropfen armenischen Blutes, aber vor Zeiten armenischen Samen in sich aufgenommen und meine Mutter Micaela ausgetragen.
Sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen können und diese Aufzeichnungen machen. Meine Großmutter weiß das alles nicht. Sie würde vor Wut platzen, wenn sie wüsste, dass ich seit mehr als zwanzig Jahren monatlich drei filigrane gelbe armenische Kerzen für sie im Berliner Dom entzünde. Und für Großvater, etwas abseits, natürlich auch drei.