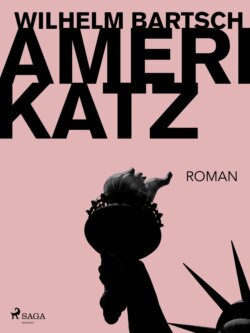Читать книгу Amerikatz - Wilhelm Bartsch - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5 Von Chicago nach Deadwood, Süd-Dakota
ОглавлениеIch kam noch jung genug nach Amerika, um nicht zu scheitern. Es war noch ein Amerika, das man nicht mehr wiederfinden wird. Ich hatte, außer der Tatsache, dass ich auch so hingefahren wäre, als Nichtspieler in der DDR a. D. im Frühjahr 1990 was Vierstelliges im Westberliner Lotto gewonnen und für Amerika zurückgelegt. Dauernd kam dann aber was dazwischen. Doch im späten Sommer von 1991 habe ich mir an einem Sonnabend in Clärchens Ballhaus beim Twisten eine Gespielin tief in meinen Ballen eingetreten. Micha hieß die auch noch. Sie hatte mir dort Twist, Sirtaki und den finnischen Letkiss beigebracht, und zwar innerhalb nur jeweils eines Titels. Da dachte ich, mit der fährst du jetzt einfach nach Amerika.
Ich hatte damals viele Gründe, nach Amerika zu fahren, nicht zuletzt wollte ich endlich mal meinen Cousin Foggy treffen. Vor allem hatte ich aber einen Auftrag, meinen ersten dieser Art überhaupt. Ich sollte nämlich für fünftausend D-Mark Belohnung jemanden im alten Indianerwesten suchen.
»Is wenichstens Las Vegas bei?«, fragte Micha.
»Chicago, Iowa, Wyoming«, sagte ich. »Mecker noch ein bisschen und ich kauf dir stattdessen ne S-Bahnfahrkarte nach Marzahn.«
»Kennst du denn da welche?«, fragte Micha und gab mir zu grübeln, ob in Chicago, Iowa, Wyoming oder in Marzahn.
Edsel Gellhorn ist vermutlich ein Cousin zweiten Grades aus jener verwandtschaftlichen Fantasie- und Müllhalde, die mir meine Oma und meine Mutti hinterlassen haben. Trotzdem ist Edsel Gellhorn, genannt Foggy, jedenfalls seiner Meinung nach, mit mir so leibhaftig verwandt, dass er mich fast wie seinen Bruder in sein Herz, aber auch in seine Galle geschlossen hat. Zu Foggy Gellhorn wollte ich also als Erstes im Spätsommer 1991.
Schon zur Herrgottsfrühe unterwegs nach Tegel, sah ich nur noch eine Zicke in erlogenem Blond: Micha. Sie hatte sich auch ein paar Tussisträhnen à la Ost-Punk gelegt, dass mir gleich meine kurzen Haare zu Berge standen, als ich das sah: eine Friseuse mit geschickten Beinen, das war wohl auch schon alles. Sie quasselte oder meckerte zwar nicht herum, dafür knurrte und muffelte sie öfters urplötzlich, ja sie knuffte und schubste mich sogar an den Türen zu U-Bahn und Bus nach Tegel, weil ich sonst ja auch nicht unbedingt mit der Spitzengruppe irgendwo einsteigen muss. Micha nahm das Knuffen und Schubsen zwar sofort zurück mit Streichelgesten, die mir aber eher wie rigide Reinigungsmaßnahmen einer Mutti mit befeuchtetem Taschentuchzipfel vorkommen wollten – und zugleich war sie anscheinend zu einem, quasi zähneknirschenden, Fick aufgelegt. Ich habe bei ihr in der Flugzeugtoilette gar nicht erst einen hochgekriegt. Ich bin nämlich ein Sensibelchen und unterscheide noch deutlich zwischen Pissen und Samenerguss.
Gleich vorm Eingang des O’Hare-Terminals in Chicago war’s aus. Sie war allmählich auch ohne mich auf ihre hundertachtzig gekommen und zischte vor sich hin. Sie verschwand dann ganz abrupt samt ihrem Gepäck und nahm wohl gar nicht erst an, dass ich sie daran hindern würde.
Ich hatte dann im Mietwagen, noch wartend, eine geraucht und Micha ein Pluspünktchen für Menschenkunde gegeben. Wir konnten uns, merkte auch ich endlich, gegenseitig nicht riechen. Wir hatten uns anscheinend im ausgelassenen und durchschwitzten Gewühl von Clärchens Ballhaus verrochen und verwechselt. War ich sauer? Im Gegenteil. Viel Glück, und von mir aus in Las Vegas, Micha!
Ich fühlte mich damals wie viele von uns noch so frei in der Seele wie der von den Cherokesen abstammende Kevin Costner, der in der Prärie mit dem Wolf tanzte auf den Bildschirmen des Jumbos von British Airlines, der uns 1991 bis in das Herz Amerikas geflogen hatte.
Da fuhr ich los, unter sieben Flugzeugbrücken hindurch, einfach so, aber auch, um zum Beispiel eine Freundin zu suchen. Nicht eine für mich, sondern eine, die einem ehemaligen Panzerhauptmann der DDR namens Gerd Grau davongelaufen war zu den Dakotas ihrer Träume.
Potty in Schierke am Harz hatte mich darum gebeten, und für fünftausend D-Mark. Die konnte ich behalten, wenn ich seinen Kumpel Gerd Grau mit oder ohne Squaw vermutlich in Gilette, X-Cross oder Rapid City, alles Wyoming, finden und Pottys versiegelte Botschaft von Männerhand zu Männerhand überbringen würde. Einmal Dakota, immer Dakota, habe ich da gedacht und gespürt, dass mein Herz immer noch voll Karl May und voller toller Indianerbücher war. Ich habe damals nur nicht ahnen können, dass viel später noch ganz andere Indianer folgenschwer in mein Leben treten würden.
Ich erfuhr also, dass der Hauptmann a. D. schon vor geraumer Zeit aufgebrochen war, um seine Squaw aus Gera wiederzufinden. Als ich dann in Chicago losfuhr, war Gerd Grau allerdings schon eine, wenn auch noch brandneue Legende unter dem Namen One-Stroke-no-Stroke-Man im alten Indianerwesten geworden. Aber das konnte ich da noch gar nicht wissen.
Ich fuhr viereinhalb Stunden aus der Hauptstadt des eigentlichen Westens mit einem echt amerikanischen Auto immer nach Westen durch Amerika. Es gab erst nichts richtig Schönes zu sehen, außer vielleicht Galena, Illinois, wo der grausam gute Nordstaatengeneral und spätere US-Präsident Ulysses Grant einige Jahre lebte. Ich war nun im richtigen Film und fortan unter meist sehr freundlichen Leuten, mehr ist dem nicht an Glücksnachrichten hinzuzufügen. Ich holte mir auch den Jack Daniels im Laden an der Brücke über den Mississippi am Dreiländereck Wisconsin, Illinois, Iowa und trank gleich draußen aus der braunen Tüte. Dann fuhr ich endgültig aus der DDR hinaus und über den mighty mighty Mississippi nach Dubuque in Iowa und hatte noch auf der Brücke einen Tinnitus-Anfall mit dem Ohrwurm »Dancing in the Dark« von Bruce Springsteen. Es waren noch umgerechnet fast dreißig Grad draußen, aber die Bluffs am Mississippi, die Uferwälder und wunderbaren Rolling Hills nach Iowa hinein feierten auch ohne Kälte bereits ihren Indianersommer. Ich begann wohl in diesem Augen-Blick meine recht erfolgreiche Karriere als der uncoolste Detektiv auf Erden.
Ich hielt auf dem Parkplatz der alten, unendlich langsamen Drahtseilbahn und fuhr hinauf zu der Neighbourhood, wo Häuser in zum Teil schönstem American Gothic stehen. In einem davon wohnte ganz allein und ohne Gestattung auch nur der kleinsten Frage nach dem Warum Foggy Gellhorn.
Er war ein Frosch ohne Alter, der laut krähte. Seinen Doktor Watson stellt man sich anders vor. Er umklammerte mich gleich gefühlte dreißig Sekunden lang mit seinen zwanzig Fingern. Sein künftiger Gehilfe, dachte er anscheinend, sollte von Anfang an merken, dass er mit ihm sein großes Los gezogen hatte.
Mir fiel damals auf, dass meine ostdeutschen Klienten sehr oft jemanden in den klassischen Indianergegenden vermuteten, also im Südwesten der Staaten, aber vor allem in den alten Dakota Territories, im Indianerwesten der Prärien.
Es waren keine armen Ostdeutschen, die mich beauftragten. Viele suchten im Grunde nach ein bisschen Kind gebliebenen Leuten, die in ihre frühen indianerroten Bücher ausgewandert und oft genug gescheitert waren.
Obwohl doch schon beträchtlich weit von den Ufern des Mississippi entfernt, hatte Foggys Haus auf dem Dach einen ringsum verglasten Widows Watch wie auch anderswo an den amerikanischen Küsten und vor allem am Mississippi üblich. Von dem aus konnte man tatsächlich auch Haupt- und Nebenarme des Mississippi ganz gut überblicken wie damals die Damen, die nach ihren ankommenden, aber manchmal auch verschollenen oder gar untergegangenen Flusskapitänen Ausschau hielten.
Doch nicht nur der Widows Watch war Foggy Gellhorns Ort, die Welt zu überblicken. Auch sein durch eine Fußbodenluke ersteigbarer Keller war ein solcher. Im Jahr 1991 hatte Foggy dort schon etliche Computer mit Hinterteilen wie von Panzernashörnern auf seinen Tischen stehen, und einige geheime oder gar illegale Microfilme hatte er in wohlgeordneten Schraubgläsern voller Nägel und Unterlegscheiben, Distanzhaken und Universaldübeln versteckt, die oben an die selbst für Foggy bequem erreichbare niedrige Kellerdecke mit ihren Schraubdeckeln angenagelt waren. Allerdings hätte man noch 1991 Hunderte dieser Gläser aufschrauben müssen, wenn man darin nach versteckten Mikrofilmen hätte suchen wollen, die sich außerdem noch als versehentlicher Pfirsichkern, als Rotztuchfragment oder als anscheinend sogar benutzter Tampon einer ausschauenden Witwe abgetarnt hatten und versehentlich in ein Tütchen mit ein paar niedlichen Wäscheklammern geraten waren.
Vermutlich keiner, nicht einmal einer vom FBI, der Räume unter Zeitdruck nach Informationen zu durchsuchen hatte, wäre damals auf die Idee gekommen, Foggy Gellhorns langweilige Sammlung von Kreuzgehängen, Federringen und Schlauchschellen lange zu verdächtigen, Wichtiges zu verbergen. Ich traf 1991 also erstmals meinen kleinen und angeblichen Großcousin und hatte gleich Lust auf seinen perversen Beruf. Foggy mit seinen Flitzeäuglein sah mich übrigens nie auch nur für eine Sekunde richtig an. Ich ihn dafür umso mehr. Der Kerl rief von morgens bis abends nach Gespenstern, also kamen allmählich auch welche, besonders nach 9/11, vom vorigen Jahr ganz zu schweigen.
Meine Verschwundenen aber gehörten eher zu den neueren deutschen Märchen, die keinen Amerikaner groß interessierten.
Ich muss an dieser Stelle von meinem damaligen Klienten Klaus Potocki sprechen. Potty, wie sie ihn nannten, hatte polnische Wurzeln und war Major der Grenztruppen der DDR, musikalischer Bereich, gewesen. Er war Gitarrist und Sänger der ziemlich harten Rockgruppe »MTS« gewesen, die mit einem Auftrittsverbot belegt worden war, noch ehe sie sich »Herzverbrecher« nannte, nicht nur im Harz. Die »Herzverbrecher« wurden schließlich ganz verboten, obwohl oder eben weil Klaus Potocki in jener Zeit sogar zum Major befördert worden war. Es ist unvorstellbar, wie es Potty jedesmal hinkriegte, dass die Verbote wieder aufgehoben wurden, vielleicht, weil er es organisiert hatte, dass sie in Berlin einmal vor beiden Erichs gleichzeitig spielen konnten. Anscheinend waren Honecker und Mielke vergnügt gewesen, und die inoffiziellen »Herzverbrecher« spielten einfach weiter bis Sommer 1989, gut bezahlt von der Nationalen Volksarmee der DDR.
Ich habe Potty mal kennengelernt in meinem halben Jahr bei der Volksarmee in Bad Langensalza. Ich hatte Ausgang und war auf einer Disco gelandet. Die »Herzverbrecher« hatten diesmal schräge Songs von 1813 dabei. Der Major der Grenztruppen der DDR Klaus Potocki trug an der Theke dann sogar eine preußische Uniform, eine der Schlesischen Landwehr, nur ohne das Eiserne Kreuz am Tschako, dafür aber mit übergroßer preußischer Kokarde. So sind wir uns bei einer Reihe von »Absackern« begegnet. Er stammte aus Schierke und war schon als Kind im Oberharz als Freiberufler anerkannt, indem er die Höhlen der Feldhamster ausgeraubt und das Getreide und die Erbsen als Vogelfutter an privat, aber auch an die Zoohandlungen in Wernigerode und Nordhausen verhökert hatte.
Ende 1989 stand Potty höchstselbst in der Uniform eines Majors der DDR an einer Gulaschkanone in der Gegend von Alexisbad und verkaufte Erbsensuppe. Dann erwarb er im Depot seiner gerade friedlich untergegangenen Armee noch weitere Gulaschkanonen und vor allem einige Lkw. Suppen in Riesenkesseln schmecken einfach besser, wusste der Militär Potty und seine Erbsensuppe begann sich nicht nur im Harz herumzusprechen. Im ZDF sagte Potty 1991, dass er in nächster Zeit sechzigtausend Büchsen »Potty’s Original Erbsensuppe« an seinen Geschäftsfreund, den Spezialitätenhändler Stuhlmüller, nach Palm Springs in Kalifornien liefern werde. Doch Stuhlmüller, davon informiert, hatte noch nie was von Potty gehört. Stuhlmüller, heißt es, wurde ganz warm ums Herz bei solch einer Frechheit, zumal er die Ostdeutschen vom Fernsehen her für echte Freiheitskämpfer hielt. So nahm er Potty beim Wort, und der musste zusehen, wie er in kürzester Zeit eine Büchsenproduktion aufmachte. Währenddessen konnte das ZDF schon eine bestens platzierte Werbetafel auf dem Broadway in New York zeigen: »Give Pies a Chance: Potty’s. Germany.« Zack! Besser hätte es noch nicht mal Don Draper hingekriegt. Potty hat es bis heute nie selber in die USA geschafft wie seit Langem Hunderttausende seiner Erbsensuppen. Aber er war immerhin 1992 mit Stuhlmüller auf einer wochenlangen Jagd in Honduras gewesen.
Mit diesem DDR-Major, Gitarrenverbrecher, Privatunternehmer und Eulenspiegel habe ich damals gern die Adressen getauscht. Als ich Potty 1991 wiedertraf, bat er mich, bei meiner bevorstehenden Amerikareise nach seinem Freund und Panzerkollegen Gerd Grau zu suchen, vermutlich in den Black Hills. Also verdanke ich es Potty, mich als Erster auf meine schräge berufliche Laufbahn gebracht zu haben.
Die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Black Hills. Einer in Oslo kennt vermutlich kaum jemanden in Palermo, und du kannst nicht mal eben so von Kiew aus gleich in Lissabon sein. Menschensuche war damals für mich mehr als heute eine Frage der Zeit und des Geldes. Aber ich durfte ja nicht klammheimlich vor mir selber, nur um zu sparen, einen Gesuchten zuerst an den möglichst nahen oder mir angenehmen Orten vermuten.
Gerd Grau wurde 1987 von seiner Liebsten, einer Squaw der Dakota aus Gera, wegen seiner Staatstreue verlassen. Sie dachte, sie wäre die Freiheit selbst, und hasste ihren Liebsten auf dem Sowjetführungspanzer. Sie ging im Frühjahr 1989 nach dem Westen. Das habe ich Jahre später von Potty erfahren, als ich mal im Harz zum Wandern war und dort eine wirklich leckere Erbsensuppe zu essen bekam und dazu noch meinen ersten richtigen Suchauftrag.
Gerd Graus ehemalige Liebste ging im Frühjahr 1989 gleich bis nach Eden, 19 Einwohner, 32 Quadratmeilen, mitten in Wyoming, wo sie niemand abholte. Wie es mit ihr weitergegangen war, habe ich erst danach erfahren: In Eden gab es ein Geschäft, wo auch Waffen und ausreichend Munition verkauft wurden. Als die Squaw aus Gera da hineinging, um vielleicht jemanden zu treffen, der sie mit nach Rapid City nahm, war keiner da. Es kam auch niemand, um sie zu bedienen. Sie dachte schon daran, sich einfach zu versorgen, ohne zu bezahlen, da kam die Inhaberin, eine alte Dame. Sie bot ganz privat ein Mittagessen an, aber die Liebste a. D. eines DDR-Panzerhauptmanns fragte die Lady nur, ob sie keine Angst habe vor Überfällen.
Warum denn, sagte die alte Dame, hier gäbe es keine Bösewichter. Diese weit und breit einzige Straße ginge von Pinedale nach Rock Springs. Wie wolle denn ein Bösewicht an einem der beiden Sheriffs vorbeikommen?
So geriet sie unter ein paar lasche Geistertänzer mit Whiskyflaschen am Rand der Tanzflächen im Weichbild von Rock Springs, die sich für eigenes Geld tatsächlich etwas Land oder schäbige Wohnungen gekauft hatten. Die Squaw aus Gera war innen tiefrot, nur außen weiß. Sie übersah, dass ihre neuen Leute zwar außen rot, innen aber wohl viel weißer waren als sie.
Sie zwang sich dazu, sich in einen Schoschonen statt in einen Dakota zu verlieben. Der gab sich alle Mühe, sie als die Seine zu betrachten. Er besorgte schließlich sogar eine Wohnung in Rapid City, hatte recht zärtliche Hände, die aus dem Nichts auch mal zuschlagen konnten, und dazu noch zwei minderjährige Kinder. Wider Erwarten war die Sehnsuchtsindianerin auf einmal Doppelmutti. Die beiden Rangen blieben skeptisch. Sie war viel zu viel Indianer. Die Squaw aus Gera schaffte es in ihrer teilweisen Selbstständigkeit, so hübsche echt indianische Tabaksbeutel und Mokkassins herzustellen, wie es nur wenige in Ostthüringen hingekriegt hätten. So kam sie in ihrer neuen Heimat mit ihrem Verkaufsstand auch hinaus in die weite Welt, also bis nach Cheyenne, Thermopolis oder sogar bis nach Deadwood in Süd-Dakota. Sie hieß inzwischen anders und war eigentlich so gut wie unauffindbar, selbst für die meisten der Schoschonen – im Volk ihrer geliebten Dakotas ging der Name dieser Squaw gar nicht erst um.
Ein zufälliges deutsches Indianertürkisschmuckhändlerehepaar aus Bienenbüttel in der Lüneburger Heide, das alljährlich für drei Monate durch den Westen der USA tourte, gab mir dann den entscheidenden Tipp mit Cheyenne, Thermopolis oder Deadwood.
Ich wollte schon immer nach Deadwood in Süd-Dakota, wo in den nächsten Tagen einer dieser Handwerkermärkte stattfinden sollte. Mich hat schon immer das Ding zwischen Wild Bill Hickock und Calamity Jane in Deadwood fasziniert. Calamity Jane hat nicht nur ohne Federlesens Wild Bills Mörder mit einem Hackebeil gestellt, sie hat auch ihrer Tochter, die sie seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hatte, als einziges ein Rezept vererbt für einen Kuchen, der in der Not für zwanzig Jahre mit viel Hirschhornsalz haltbar gemacht werden kann. Ihre Briefe an sie ergreifen mich noch heute.
Was aber war inzwischen mit Gerd Grau passiert? Er hatte es in der Maschine von London nicht nur unterlassen, einige Fragen in den Papieren der Einwanderungsbehörde wahrheitsgemäß zu beantworten, zum Beispiel die, ob er Kommunist oder in irgendeiner kommunistischen Partei Mitglied oder Mitglied gewesen sei. Oder die, ob, wie lange und mit welchem Dienstgrad er zu einer militärischen Formation gehört habe. Er hatte alles durchgestrichen und geschrieben, er stehe ab jetzt unter keinem Befehl mehr. In Chicago wies er bei der Einwanderungsbehörde darauf hin, dass ein amerikanisches Abkommen mit den wiedervereinigten Deutschen in Kraft getreten sei, laut dem auf solche Auskünfte verzichtet werden solle.
Man ließ Gerd Grau rein in die Staaten.
Nun aber meldete der Zentralcomputer, dass ein Mann gleichen Namens, Alters und Geburtsortes ein kommunistischer Panzerhauptmann gewesen war. Dem inzwischen eingeschalteten FBI fiel auf, dass sich der Mann, zwar mit gültigem Pass für die erlaubten drei Monate Aufenthalt im Land, aber nicht ganz rechtmäßig in Chicago einen gebrauchten silbergrauen Chevrolet Corsica mit dem Kennzeichen DEN 2280, Illinois – Land of Lincoln gekauft hatte. Außerdem, schon auf dem O’Hare, sei er für drei Monate der American Automobile Association beigetreten, hätte eine Chipcard der IT & T erworben und telefonierte über einen Operator und die R-Gesprächszentrale in Frankfurt gleich zwei Stunden mit einem Teilnehmer in Leipzig. Da der Mann so gut wie kein Englisch sprechen konnte, aber anscheinend eine Menge Gespräche in den Staaten zu führen beabsichtigte, ließ er dies jemanden, der ihm vor allem nachts zur Verfügung stand, von Leipzig aus bewerkstelligen. Soweit überprüft werden konnte, gingen die meisten Anrufe anfangs in die Bundesstaaten Oklahoma, Arizona, New Mexico, South Dakota, Wyoming und Idaho ein und dort zumeist in den Selbstverwaltungsbehörden von Indianerreservationen. Vielleicht gehörte ja der Mann zu jenen verrückten Deutschen, die sich vor sich selber am liebsten in einer Rothaut verstecken würden.
Gerd Grau hatte Chicago dann auf der Interstate 20 in Richtung Westen verlassen. Auf Anfrage in Deutschland stellte sich heraus, dass der Mann tatsächlich der Vermutete war, gegen ihn aber nichts Nachteiliges vorlag und er im Juli 1990 seinen Abschied aus der deutschen Armee genommen hatte, weil er seinen »Warschauer Treueschwur nicht in eine NATO-Uniform umknöpfen« wollte. So hätte seine Beobachtung erst einmal eingestellt werden können, wenn sich nicht spätestens vom westlichen Ufer des Mississippi, von Dubuque im Bundesstaat Iowa aus, wo der Mann über Nacht blieb, mehr als merkwürdige Dinge ereignet hätten.
In der J.F.K. Street in Dubuque am Mississippi kaufte der Mann, der schon bald im alten Indianerwesten »The Mammouth of Humboldt«, mehr aber noch der »One-Stroke-no-Stroke-Man« genannt werden würde, 400 weiße, rosa und rote Seidennelken bei Hohneckers Fall Silk Flowers and Arrangements. Der Mann änderte nun seine Reiseroute und bog mit seinen 400 Kunstblumen auf dem Rücksitz seines silbergrauen Chevys nach Süden ab. »All for the death«, soll er, von einem Tankwart nach den Blumen befragt, angeblich gesagt haben.
Schon am Tag danach schien er in ein Massaker verwickelt zu sein, das der rotchinesische Student der Ökonomie Zhao Ping Guang auf dem Campus der staatlichen Universität von Iowa in Iowa City anrichtete. Dessen persönlicher Mentor, der dann ermordete Professor DeLendricies, hatte Zhao ein wichtiges Testat verweigert, was dessen ganzes Lebenssystem aus Fleiß und Erfolg zusammenbrechen und ihn Amok laufen ließ. Bei dieser unschönen Gelegenheit war der Seidennelkenmann für einige Sekunden und ganz im Hintergrund sogar bundesweit im Fernsehen als der One-Stroke-no-Stroke-Man zu sehen gewesen.
Mit Glück, wie er sagte, habe Foggy noch herausbekommen, dass kurz vor dem Attentat Gerd Grau ein großes Military-Surplus-Geschäft in Iowa City betreten hatte mit einem gelben Paket unter dem Arm, das möglicherweise ein Kleidungsstück enthielt. Dem Zeugen waren vor allem die vielen Kunstblumen im Chevrolet aufgefallen. Nach einer halben Stunde habe er gesehen, wie Gerd Grau in jener Jacke wieder auftauchte, die ihn zum One-Stroke-no-Stroke-Man machte. Dann sei er in sein Auto gestiegen und losgefahren Richtung Westen. Die Polizeikontrolle anlässlich des Attentats hundert Meter weiter habe er problemlos passieren können.
Einen Tag vor Deadwood bog also auch ich von der Interstate 90, die von Boston nach Seattle führt, ab nach Humboldt. Den One-Stroke-no-Stroke-Man, falls der tatsächlich Gerd Grau hieß, hatte man manchmal das »Mammouth von Humboldt« genannt. One-Stroke-no-Stroke kam mir verdammt bekannt vor, denn Ein-Strich-kein-Strich hieß die schlichte Felduniform der NVA, deren Jacke ich noch nicht mal beim letzten Umknöpfen in Zivil abgelegt hatte. Ich hatte nach der Armee nämlich eine heftige Phase des Angelngehenmüssens, wo ich die Ein-Strich-kein-Strich immer angehabt und mich kein Schwein von Fisch erkannt hatte. Das Kleidungsstück konnte ja schließlich nichts für Honecker und Mielke.
Humboldt war zur Hälfte dichtgemacht. Aber es gab noch eine riesige Kneipe. Ich war am frühen Nachmittag der einzige Gast. Die Kneipe war ungewöhnlich kahl, fast wie früher im Brandenburgischen. Ich trat an eine Wand, wo ein bunt bemalter Kasten ein pflaumengroßes Stück der Berliner Mauer enthielt. Der Wirt umarmte mich fast, brachte mir statt nur einem Stückchen eine ganze mittelgroße Blaubeertorte und setzte sich zu mir. Nach dem hierzulande wie ein Baseballendspiel im Fernsehen genossenen Fall der Berliner Mauer waren in den klassischen Indianerländern da und dort etliche Sehnsuchtsindianer aufgefallen, erzählte der Wirt von Humboldt.
Einmal war eine deutsche Busreisegesellschaft in vollem Federornat in Wounded Knee gesehen und von den Einheimischen wie Wesen von einem anderen Stern bestaunt worden. Man dachte erst, es wäre ein kleines Revival der Buffalo Bill Wild West Show gewesen, aber es seien alle nur Weiße im vollsten Federschmuck gewesen. Sie hätten behauptet, die Bowery Dakotas zu sein. Dass es die Bautzener Dakotas gewesen sein könnten, die es wirklich damals noch gab, hatte ich für mich behalten. Fürs Showgeschäft seien die aber nicht gerade tauglich gewesen und ob ich schon wüsste, dass das Showgeschäft, die Konservendose und der Stacheldraht in den alten Dakota Territories erfunden worden seien?
Freute mich zu hören, und so fragte ich gleich nach dem One-Stroke-no-Stroke-Man, dem »Mammouth of Humboldt«. Der Wirt nickte stark, als hätte er das erwartet, holte uns einen Whisky und erzählte von jener alljährlichen und überall im alten Indianerwesten beliebten Mammutschlacht der Erntemaschinen in Humboldt.
Die Maschine vom One-Stroke-no-Stroke-Man gehörte dem ziemlich armen Farmer Zatopek und war ein halbes Jahrhundert nicht mehr gefahren. Das spätere »Mammouth von Humboldt« reparierte und schmierte das Ding in einer Nacht beim Schein einer Petroleumlampe, die ihm Zatopek hinhielt oder auch mal heller schraubte. Anfangs wollte Zatopek noch dies und das erläutern oder gar was erzählen, aber das Mammut sagte »No!«. Beim dritten »No!« begriff Zatopek und hielt seine Klappe.
In aller Herrgottsfrühe warf das Mammut den Motor an. Er lief wie geschmiert. Zatopek wollte eine erste Runde drehen. Es war eine John Deere-Kombine von 1940. Sie hatte neben dem großen Fahrersitz noch einen kleineren für den Farmerssohn. Das Mammut holte Zatopek, der schon raufgeklettert war, wieder herunter. Er wollte ihn auch nicht auf dem Kindersitz bei sich haben.
Dann stieg er selber hinauf und fuhr ganz langsam eine grollende Acht. »General Yorck!«, rief er vergnügt und lachte. »The Winner is: General Yorck!!« Dieser General Yorck stieg wieder ab und tätschelte sein eisernes Pferd. Dann nahm er Zatopek die Petroleumlampe aus der Hand, sagte in einen Anschein der ersten Morgenröte hinein »Good night, Zatopek!« und ging davon.
Johnny Persbrand, der wie immer um diese Zeit einen ersten Schluck brauchte, hat es von seinem Küchenfenster aus ein bisschen flackern sehen und hatte gleich gedacht, da schnüffelt doch einer zwischen den bereits aufgefahrenen Giganten herum? Es waren alles wahre Monster, die meisten von McCormick produziert. Persbrand goss sich vorsichtshalber noch einen in sein Zahnputzglas, trank und ging nach draußen. Er verbarg sich an einer Stelle, von der aus er so gut wie alles sehen konnte. Der gute Persbrand hat diese Geschichte aber erst erzählt, als die Schlacht schon lange geschlagen war. Das Mammut hatte keines der feindlichen Fahrzeuge auch nur angerührt, aber sie an den unmöglichsten Stellen inspiziert.
Am Nachmittag saß das Mammut mit auf der Tribüne vor dem Schlachtfeld, als hätte es erquickend gut geschlafen. Dieses Mal sahen es alle: Das war der One-Stroke-no-Stroke-Man! Er trat in dieser schlichten und präriefarbenen Militärjacke mit grauem Kunstpelzkragen an, wie sie hier noch keiner je zuvor gesehen hatte. Sie hatte nur zwei kleine Brusttaschen mit jeweils einem Knopf aus grauem Nickel und zwei Seitentaschen, in die gerade mal die Hände passen mochten. Die Grundfarbe Graugrün war längs gesprenkelt mit kackebraunen Streifen in noch nicht mal halber Streichholzlänge.
Diese Jacke war so schlicht wie ergreifend und sah irgendwie nach ganz selbstverständlichen Siegen ohne Hurrageschrei aus. »Ein Strich«, sagte der One-Stroke-no-Stroke-Man und zeigte auf einen der Striche. »Kein Strich«, sagte er, indem er in die Prärie zwischen den Strichen tippte. »Mäd in Dschi Di Ahrr!« Die Feinde tafelten oben auf der Tribüne noch miteinander, und die Highschool Marching Band trat auf. Die wunderschöne Majorette hatte lange vorm One-Stroke-no-Stroke-Man mit ihren herrlich federnden langen Beinen angehalten und ihren Tambourstab wirbeln lassen, doch der One-Stroke-no-Stroke-Man hielt seine Blicke gesenkt. Er knabberte in vollstem Ernst an einem Knochen.
Der One-Stroke-no-Stroke-Man fuhr tatsächlich die kleine, vor der Schlacht kaum ernstzunehmende John-Deere-Kombine von 1940.
Wie das so ist auf Erden, hatten die Riesen von McCormick, wenn sie nicht über sich selber herfielen, gleich Gefallen daran gefunden, den Kleinsten zuerst vom Platz zu fegen. Aber dazu war dieser John Deere viel zu schnell und wendig. Keiner konnte ihn kriegen. Er griff blitzschnell und heftig an, meist in Hinterteile und Flanken, lief Slalom unter den langsam zornig werdenden Riesen, hatte Witz, schäkerte und blinkerte mit seinen Äugelein oder fuhr etwas abseits, um seine Yorck’sche Acht erhobenen Hauptes zu drehen, ja der John Deere entwischte einmal bis zur Tribüne und verneigte sich quasi. Für die hellauf begeisterten Frauen, Mädchen und Kinder von Humboldt und Umgebung stand damit der Sieger schon endgültig fest.
Aber der One-Stroke-no-Stroke-Man wütete noch eine ganze Weile weiter unter all diesen gigantischen Erntemaschinen, bis er sie alle nach und nach in die Knie gezwungen hatte. Wie das aussah! Diese Erntemonster machten alle auf schräge hochdramatische Leichen, aber der Kleine von John Deere von 1940 mit dem One-Stroke-no-Stroke-Man an Bord kam zum Siegerpodest wie ein urgesunder Junge voller Beulen zum Abendbrot. Er strahlte.
Zur Siegerfanfare griff er sich die Bürgermeisterin und tanzte mit ihr. Es wurde die längste Siegerfanfare, die ich je gehört hab. Jeden seiner Feinde umarmte der One-Stroke-no-Stroke-Man und klatschte mächtig ihre Rücken, den Zatopek knutschte er sogar.
Der One-Stroke-no-Stroke-Man aß noch drei Steaks, dort drüben an dem Tisch, sagte der Wirt von Humboldt, dann sei er auf einmal und für immer verschwunden. Zatopeks Teller habe gewackelt. Als er ihn hochgehoben hätte, habe der Anteil vom One-Stroke-no-Stroke-Man darunter gelegen. Der One-Stroke-no-Stroke-Man hatte nicht einen Dollar von seinem viel größeren Anteil am Siegerpreis genommen. So was würde keiner in ganz Süd-Dakota vergessen. Dann hatte ich auch noch so ein Steak in Humboldt nehmen, die Gesamtrechnung dem Wirt überlassen und der allmählich hinzugekommenen Familie ausreden müssen, dass auch ich die Berliner Mauer geentert und dann klein gehackt habe.
Eine Serviererin in Wall Drug, wo ich am Abend nach meinem Besuch in Humboldt immerhin noch Appetit auf eine Idaho-Potatoe mit Quark gehabt hatte, erzählte mir auf meine Frage auch von diesen merkwürdigen Busladungen voller weißer Indianer und hat mir dann noch beim Vorübergehen was ins Ohr geflüstert: »Es waren alles nur verkleidete Kommunisten!« Beim Zahlen hatte ich ihr, mehr im Scherz, gesagt, dass auch das Mammut von Humboldt ein gut bewaffneter Kommunist sein könnte, zumindest ein ehemaliger.
»No!«, konterte die Serviererin. »Please don’t affront the One-Stroke-no-Stroke-Man!«
Ich rief Foggy noch aus meinem Motel in Wall Drug an. Ich wollte ihm endlich mal sagen, wie sehr ich inzwischen seine überreichen Recherchen zu Gerd Grau bewunderte. Vor allem aber wollte ich noch was zu all den Geschichten über den One-Stroke-no-Stroke-Man wissen.
»Da hat gerade gestern was in einer Zeitung aus Omaha in Nebraska gestanden«, sagte Foggy. »Er ist nicht mehr alleine. Man hat nämlich im ›Shanghai‹ in Ogalalla an einem Tisch gleich drei One-Stroke-no-Stroke-Men gesehen. Es gibt ein Foto davon, wie sie ihre Entengerichte als ungenießbar in die Küche zurückgehen ließen und dann, wie die Zeitung berichtete, den Fotografen, nämlich den Koch des Restaurants, bedroht hatten. Die One-Stroke-no-Stroke-Legenden fangen an, sich heftig abzunutzen, Alter! Ich hab da, glaub ich, was übersehen. Ich muss noch mal den Military Surplus in Iowa City unter die Lupe nehmen. Ruf mich morgen aus Deadwood an!«
Was war denn da los? War die totgeglaubte DDR mit ihrer Nationalen Volksarmee etwa gerade dabei, Amerika von seinem Innersten her aufzurollen?
Ich wollte eigentlich noch in die sternenübersäte Dunkelheit hinausfahren zu den Badlands, zu den schlafenden Präriehundstädten und zu den buntgestreiften Tafelbergen, die ich am Tag wenigstens eine Stunde lang hatte bewundern können, besonders den Bisonleitbullen, der auf einer der näheren Tafeln bis an den Rand getreten war, um das Terrain für seine Herde abzuchecken oder einfach nur über sein armenisches Schicksal nachzugrübeln. Aber ich war stattdessen eingeschlafen und habe dann im Traum eine Bisonherde gesehen und wie sich einer der Bisons auf den Rücken geworfen hatte und sich selig schubberte auf den Häuserruinen der in gehörigem Abstand protestierenden Präriehunde. Die Präriehunde hatten sich dann aber entpuppt als die Bautzener Dakotas.
Am Morgen fuhr ich, von seltsamen Lachanfällen geschüttelt, nach Deadwood. Ich wagte gar nicht erst zu hoffen, dass auch Gerd Grau längst herausbekommen hatte, wo man hier auf eine ostdeutsche Indianerin aus Wyoming, die für ein, zwei Tage nach Süd-Dakota entflohen war, warten musste. Der Panzerhauptmann a.D. hatte doch sicherlich dieselbe Adresse herausbekommen wie ich von Foggy.
Ich sah sofort diesen wirklichen One-Stroke-no-Stroke-Man an der Bar sitzen. Dabei hatte ich noch gar nicht nach diesem Floh- und Indianermarkt Ausschau gehalten, sondern wollte erst mal was trinken.
Schön, wenn man gleich beim ersten Fall so ein Glück hat! Drei Sitze weiter an der Bar saß ein wohlgenährter lieber Familienvater, der nicht im Geringsten nach FBI aussah.
Hundertfünfzehn Jahre und sechzig Tage, nachdem der bezahlte Desperado Jack McCall am 2. August 1876 Calamity Janes Freund und Lover Wild Bill Hickock am Spieltisch in den Rücken geschossen hatte, bahnte sich jetzt eine Art Shootdown im Gulch Resort Motor Inn von Deadwood in den Black Hills an, wo der One-Stroke-no-Stroke-Man und ich scheinbar ganz unabhängig voneinander saßen. Es ist trotzdem ein süßes Gefühl, wenn einer mehr weiß als der andere. Ich war, glaubte ich da erstmals, ein bisschen boshaft und zugleich erfreut genug, um Detektiv zu sein. In so was zu schwelgen lässt die Zeit vergehen, bis man doch noch hinterrücks ein bisschen überrascht wird.
Sie war tatsächlich da! Sie stand mit Schock im Türstock zu jenem Casino, das früher einmal zu Wild Bills Stamm- und Todeskneipe, dem Bell Union Saloon, gehört hatte. Sie war eine sehr hellhäutige und nicht gerade attraktive Squaw, der traditionellen Kleidung nach wohl Schoschone, und schoss dem rotblonden Kerl da an der Theke in den Rücken. Sie tat dies mit einer tödlichen Waffe – mit dem Wort.
»Gerd Grau?«, rief sie. Für die einheimischen Anwesenden klang das aus ihrem Mund wie »gerret crow«, also so was wie »Mansardenkrähe«. Der Getroffene bäumte sich noch einmal auf und erstarrte. Er drehte sich nicht um.
»Garret crow!«, sagte die unscheinbare Schoschone erneut und wiegte wie verständnislos verneinend ihren Kopf. Jeder der nun Anwesenden saß atemlos und starr zu ihr oder in sein Glas blickend da, als habe er das größte Reiterstandbild der Welt zum ersten Mal vor Augen, nämlich das von Red Cloud im nahen Tal der steinernen amerikanischen Präsidenten. Sie war eine von den Schoschonen wie der berühmte Häuptling Red Cloud, nur nicht so attraktiv.
Der erstarrte rotblonde Kerl drückte jetzt sein Whiskey-Glas an sein getroffenes Herz, in jene Gegend jedenfalls, wo bei ihm eine rosa Seidennelke steckte an seiner seltsam büffelgrasfarbenen und gestrichelten Uniformjacke. Jedermann im Lokal wusste, dass er der One-Stroke-no-Stroke-Man war, bloß seine Squaw nicht.
Aber sie schaffte es, urplötzlich bei ihm zu sein und gleich völlig verborgen auf seinem Schoß zu sitzen. Die beiden gaben keinen Piep mehr von sich und drückten einander nur. Wie sollte ich diesen Klumpen aus Wiedersehensfreude nun mit einer Sendung stören, die ich von Potty zu übergeben hatte? Ich schob das kleine Päckchen so dicht an diesen Glücksklumpen heran, dass er wohl nicht stibitzt werden konnte. Ich sah dem Familienvater drei Sitze weiter noch tief und lange in die Augen. Der Mann erwiderte meinen Blick und ist dabei wohl Sieger geblieben.
Das war mein traumhaftester Fall. Er löste sich eigentlich von ganz allein. Aber ich war wenigstens dabei gewesen.
Foggy rief in meinem Motel in Deadwood an und spielte den Ahnungslosen: »Kennst du einen Erbsensuppenhändler namens Potty?«
»War das nicht der Kumpel vom One-Stroke-no-Stroke-Man?«
»Kennst du auch den Unternehmer Stuhlmeier aus Palm Springs in Kalifornien?«
»Nicht persönlich.«
»Pass auf. In diesem Military Surplus-Laden in Iowa City gibt es auf Lager jetzt schon Tausende NVA-Felddienstjacken mit dem Spitznamen ›One-Stroke-no-Stroke‹. Willst du noch mehr wissen?«
»Danke, Foggy Gellhorn, ich weiß schon alles. Du bist einfach große Klasse.«
Ich war damals natürlich noch auf dem Bergfriedhof in Deadwood gewesen und stand an den nicht allzu sehr benachbarten Gräbern von Calamity Jane und Wild Bill Hickock. Ich hab den beiden zwei weiße Kunstblumen aufs Grab gelegt. Ich habe die Wegwerfer von noch viel mehr Kunstblumen vorher gesehen. Es waren zwei. Nämlich ein Herz und eine Seele. Sie hatten insgesamt 400 Kunstblumen von Hohnecker’s Fall Silk Flowers and Arrangements in Dubuque am Mississippi in einen Supermarktcontainer am Rand der Black Hills geworfen. Jetzt lagen dort allerdings nur noch 398 Stück.
Es war Mitte Oktober 1991. Der Winter fuhr herein auf seiner freien Bahn aus dem hohen Norden. Schon Alberta Clipper kam zu früh nach Iowa herunter, und er wurde fast noch überholt vom Canadian Express. Foggy und ich saßen im Widows Watch auf seinem Haus über Dubuque und konnten sehen, wie alle Schiffe vom Hafen im Kreis herumfuhren, um ihn eisfrei zu halten, selbst die »Casino Belle« und der kleine Raddampfer »Bettendorf«, wo sie deinen Whisky Soda mit zwei kleinen Tankpistolen in deine Gläser aus Plaste zischen. Dann sahen wir selbst noch im Dunkeln, wie der Mississippi allmählich eine hellere, ja grelle Farbe annahm, sich aufhäufte und da und dort mit spitzen Fingern wie die Kirchen Oklahomas auf den Himmel einstach. Der Mississippi begann nun erst recht zu donnern und zu krachen wie eine Schlacht, die sich über Hunderte Meilen nach Süden zu erstrecken begann. Es war die Winterschlacht des mächtigen Flusses, und ich hatte bereits gewonnen und konnte die fünftausend D-Mark von Kukkie behalten. Foggy wollte davon partout nichts.
Die dreitausend Dollar, die mir aber Gerd Grau noch als Scheck schicken wollte, ließ ich ihn gleich an Foggy Gellhorn überweisen. Dann hab ich mich vier Jahre lang mehr schlecht als recht in Amerika oder in Berlin und sonstwo durchgeschlagen, aber ich hatte in dieser Zeit bereits eine mit Ach und Krach erworbene Detektivlizenz.