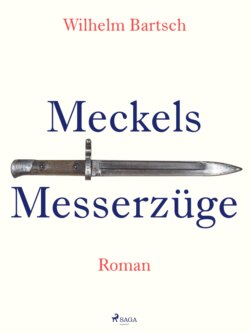Читать книгу Meckels Messerzüge - Wilhelm Bartsch - Страница 10
Speerwerfen in Schlesien
ОглавлениеIch musste mich selber noch mit dieser Uniform und einigem Zubehör versorgen. Vor allem musste ich endlich mein Pferd umtauschen. Im mir empfohlenen Pferdedepot nahm ich einen recht leichten Abschied von Paul dem Gaul und lief dem Staatsrat und Grafen Heinrich von Dohna-Wundlaken über den Weg. Der blieb stehen, sah erst das von mir hinweggeführte Tier, dann mich an und riet mir sogleich, lieber doch bei den Fußjägern einzutreten. Ich reichte indessen dem Depotwachtmeister mein Lützower Equipierungsformular mit den noch zu liefernden Utensilien und sagte dem Grafen, dass, wenn er denn meine Reitkünste anzweifeln sollte, er doch gern zusehen möge, was und wie ich mir hier eins von den polnischen und Kosakenpferden auswählen würde. Das war mein erster und ziemlich kühner Streich bei den Lützowern. Die Abenteuerlust hatte mich auf einmal schlichtweg gepackt, und nur so, also glücklicherweise, bin ich dann zu meinem besten Pferd gekommen, das ich je geritten habe.
Dieses Pferd sah ich sofort und als erstes und wusste – das ist meines! Es war ein zottiger, brauner Kosak mit birnenförmiger Schnippe gleich über seinen Nüstern und an seiner rechten Hinterhand mit einem einzigen Stiefel. Das Tier sah mich mit herausforderndem Kopfschütteln und zornig seitwärts gestellten Ohren an.
»Die Kanaille beißt«, rief der Depotwachtmeister, »sie schlägt, bockt und lässt sich nicht satteln.«
»Mal sehen«, sagte ich ruhig und kühn. »Wie alt?«
»Fünf Jahre. Kerngesund ist sie ja, die Kanaille«, seufzte der Wachtmeister, »aber es ist das erste Pferd in meinem Leben, das mich bespuckt hat!« Der Graf von Dohna begann laut zu lachen.
»Bringen Sie mir mal einen Dienstsattel und Zaumzeug«, sagte ich. Danach ging der Teufelstanz los, zumal der Wachtmeister mit einem riesigen Kantschu daneben stand und in die Luft damit knallte. Ich hieß ihn deshalb ganz abtreten und näherte mich dem Pferd mit einem Stück Brot in der vagen Hoffnung, es sei einfach nur falsch und ausschließlich mit dem Kantschu behandelt worden. Der Graf von Dohna lehnte derweil hinten an der Wand, ein Bein über das andere geschlagen. Offensichtlich hatte er viel Zeit und Interesse für das, was ein künftiger Kamerad und Oberjäger da machte. Ich wusste das allerdings selber nicht so genau. Das Pferd schielte mich böse an und schnappte blitzschnell nach meiner Hand, die ich ebenso schnell zurückzog. Das wiederholte sich mehrfach. Nun hatte das Pferd allerdings das Problem, dass sich in der anvisierten Hand auch das Brot befand, das es dann auch in den Blick nahm und schließlich fasste. Im Hause Meckel wird bekanntlich auch Russisch gesprochen und ich fand in dieser Sprache klingende sanfte Worte. »Stoj, krassiwoi tschjort, stoj, miloi konko.« Dabei strich ich dem Tier, während es schon wohlig ein zweites Stück Brot kaute, mit dem Handrücken den Hals. Es ließ sich tatsächlich die Trense anlegen und ich schwang mich tollkühn, weil unter Beobachtung, auf seinen Rücken.
Inzwischen war der Graf von Dohna von hinten herangekommen und reichte mir den Sattel. Schmeicheleien auf Russisch und Französisch gleichzeitig in die Pferdeohren flüsternd, hob ich schließlich den Sattel vor mich und rückte nach hinten. Ich sprang schnell ab und befestigte den Sattelgurt. Erneut schnappte der Kosak nach mir, erwischte mich dabei sogar am Hals, aber das wohl eher neckend. Ich tränkte ein großes Stück Brot mit Branntwein, und das Pferd schlang es vergnügt.
Ich schnalzte und tränkte ein weiteres Brotstück mit dem letzten Hochprozentigen. Das Pferd war zum Glück ein Säufer, zuerst wohl eher von Wodka, jetzt also von Branntwein. Ich stieg einfach auf, es warf den Kopf, in den Nüstern noch den Hauch des guten Tropfens, und schon eine Minute später konnte ich mit diesem Kosaken etwas machen, wofür der General Yorck zu Pferde während seiner Schlachtenlenkungen so berühmt geworden ist – lauter ehrfurchtgebietende Achten gehen.
»Ich bin der Graf von Dohna, und ich freue mich, mit Ihnen ins Feld ziehen zu können«, sagte der Staatsrat und Graf Heinrich von Dohna-Wundlaken. »Mit welchem Reiter habe ich die Ehre?«
Ich nannte meinen Namen, wies auf mein neues Pferd und sagte: »Das ist Jean!«
»Jahn??«, wunderte sich der Graf.
»Bloß nicht!«, rief ich. »Nein, mein Pferd heißt Jean! Und zwar nach Jean Paul.«
»Man sollte es lieber Iwan nennen«, warf der Depotwachtmeister ein, »denn es muss einem Russen gehört haben. Vermutlich kann man es überall im Gelände stehen lassen, ohne es anbinden zu müssen. Wenn es sich entfernt, genügt wahrscheinlich ein kurzer besonderer Pfiff, damit es wieder herbeikommt. Dies einzuüben würde ich dem Herrn noch raten – aber er steht wohl selber einem Kosaken nicht viel nach.«
Während ich unverhofft stolzer Reitersmann nun Jean oder Iwan noch für eine letzte Nacht in seine alte Box brachte und ihm, schon richtig in ihn verliebt, seinen Rücken rieb und massierte, brannte auf einmal mein Brustbein in angenehmstem Feuer – aber hatte Jean, mein Pferd, nicht meinen Hals erwischt ...?
Da war es ein weiteres Mal das Inbild des blutjungen Lützower Jägers, und ich schüttelte meinen Kopf darüber, dass er anscheinend – »Pardong wird nich jegeben!« – noch immer nicht seine fünf Fingerkuppen von mir genommen hatte.
Erst gegen Abend wohl vergaß ich die schönen Druckstellen, indem ich Ludwig, also die Dreizehn die Achtzehn, in eine Kleiderfärberei begleitete, in der alles an derbem Material, das dort ankam, schwarz gefärbt werden sollte für die Lützower und für die Schlesische Landwehr. Ludwig und Marwitz der Färber nebst seinem Farbknecht hatten damit schon in Halle Erfahrungen gesammelt, wie das am besten, am schnellsten und am billigsten zu bewerkstelligen wäre. Dies hielt uns so lange auf, bis es sich nicht mehr auf einen Schoppen mit den Kameraden zu gehen verlohnte – und schon der folgende Tag rief uns zum Dienst, die Dreizehn zu den Zielscheiben, die Achtzehn zum Stab des Generalzeugmeisters und zum Minister, außerordentlichen Gesandten und Königlich Preußischen Grand maître de la Garderobe, dem Grafen de Groote, dem ich am traurigsten Ort der Welt selber noch begegnen sollte.
Hinter dem Pferdedepot am Stadtrand von Breslau erstreckte sich neben den Reitbahnen und -plätzen eine weite Festwiese, auf der sich überall die nackten Rösser der Lützower Freischar tummelten. Es war nämlich den neuen und oft ungeübten Reitern zur Vorschrift gemacht, in den ersten acht Breslauer und den dann folgenden ländlichen Tagen des Felddienstes zu Pferde den festen Sitz dadurch zu üben, dass den vierhufigen Kameraden weder Sattel noch Decke aufgelegt werden durfte. Da sah man nun, so weit das Auge reichte, wie noch recht unschlüssige Kentauren in ihrem jeweils zugewiesenen Kreise schritten, manche davon sogar noch an der Longe. Aber da und dort, was bereits gestattet war, trugen sie ihr Schwarz-Rot-Gold oder gar den schwarzen, mit Wachstuch überzogenen Tschako, in welchem, durch Schlaufen und Tasche gesichert, die wichtigsten geistigen Utensilien des Lützowers beherbergt werden sollten – Tabaksbeutel und Pfeifenkopf. Fortgeschrittenere schwärmten auch bereits ins Gelände und versuchten sich in schnelleren Gangarten. Ich sah auch den Grafen von Dohna in einiger Ferne, wie er sich aus dem Sattel beugte, um einem der kentaurischen Eleven den richtigen Zügelgriff und die dementsprechende Zügelverteilung zu zeigen. Ich sah abgeworfene Humpler oder andere, die im Grase saßen und sich ihre verkrampften Beine mit Fusel einrieben – der point d’honneur machte, dass sie dennoch durch ihre Schmerzgrimassen hindurch alle lächelten oder miteinander scherzten. Einige Reiter im Gefolge des legendären Rittmeisters von Colomb, der zwar auch den blitzsauber machenden Gamaschendienst, vor allem aber die kühnste Reiterkunst liebte, preschten vorüber, und ich hörte ihn brüllen: »Tüchtig geritten! Was stürzt, das stürzt, was den Hals bricht, bricht den Hals!«
Mir war durch Zuspruch des Grafen von Dohna der Felddienst zu Pferde unnötig gemacht worden. Ein Papier befahl mir vielmehr, mich auf den Schießplätzen aufzuhalten, um dort die Plunket’sche Kunst zu lehren, die Kugeln ins Schwarze zu lenken.
Man konnte bereits hören, welche Richtung man zu den Schießplätzen einzuschlagen hatte. Ich brauchte meinen dahintrabenden neuen Jean Paul gar nicht mit Schenkeldruck und sanftem Zügel zu animieren und bemerkte zu meiner und zu des Pferdes Freude, dass es meine pure Losgelassenheit zu Recht als eine Aufforderung erkannte, nun selbst an einer Weggabelung die richtige Richtung zu wählen, nämlich als wohl bereits tüchtig kriegserfahrenes Pferd diejenige, aus der man Schüsse hörte – und wo in diesem Moment wieder einmal der Siegellack meines Schicksals heiß gemacht wurde. Jean Branntwein alias Iwan Wodka hielt direkt auf die Stelle zu, wich nur einmal ein wenig zur Seite und schnaubte gar kopfschüttelnd, als linkerhand etwas sehr Geschwindes in der Luft, plötzlich von Morgensonnenstrahlen getroffen, aufblitzte, um dann bereits hinter uns mit einem dumpfen Schlag in einen schwarzen, an einen Eichenstamm gelehnten Schild nachbebend einzuschlagen. War denn der Klimmzug-Germane Jahn doch noch erfolgreich gewesen, wenn er zwar nun, wie zusammen mit dem Komödiendichter Kotzebue erhofft, keine Legionärinnen – nämlich eine Berliner Amazonenschaar! – auf die Beine gebracht und in Marsch gesetzt hatte? Dafür aber eine Lützower Speerwerferkohorte?
Was ich indessen da, von einer anderen alten Eiche sich abstoßend, sah, war nur ein schwarzlockiges Männchen mit nicht unansehnlichem nacktem Oberkörper, das nun losrennend ausholte mit einem weiteren gebeizten und lackierten Speer mit langer Stahlspitze und messingnen Ringen. Aber es zügelte sich scharf mitten im forcierten Lauf, senkte die es überragende Waffe, rammte sie aufrecht in den Boden und lehnte sich sinnend an sie, den Schaft in beiden Fäusten förmlich liebkosend. Ich merkte, dass ich Jean angehalten hatte – oder er mich – und stieg ab.
»Sonne traf mein Auge, lieber Kamerad«, sprach der kleine dunkelgelockte Siegfried, »ich hätte diese Möglichkeit auch unter diesem schattigen Eichbaum dort besser erkennen müssen.«
Wunderlicherweise entströmten diesem schattigen Eichbaum die lieblichsten Flötentöne, die ich jemals vernommen – und ich sah alsbald einen Rappen und einen Gelben stehen, daneben einen Reitknecht, der wie ein Hofschneider ein grünes Kollet mit kornblumenblauem Kragen säuberlich über seinen Unterarm gehängt hielt, dazu einen grauen Mantel mit rotem Kragen und der Goldprägung einer Sechs darin.
»So eine Helmfriedslanze wie diese hier wirft man eben nicht so einfach«, piepste der Offizier der Jäger-Eskadron des 6. Brandenburgischen Kürassier-Regimentes mit fistelnder Stimme. »Ist sie nicht schön? Thiudolf selber hatte keine solche zu eigen – Wer ist Er? Ich sehe ihm doch wohl an, dass er auch ein Hallodri ist! Es sind ja heute schon ein paar von Euch aus meinem lieben Halle hier vorübergelangt! – Potz Using und Yolande! Ein stattlicher, aber stummer Meckel also, der immerhin sein Billet gereicht hat – für das sein Schwurbruder de la Motte Fouqué allerdings in seinem nackten Rumpfe kein Täschchen findet. Er kann also auch keines zurückreichen.«
Der Baum endigte gerade seine betörende Melodie, ich mochte, solange sie noch vernehmlich war, gar nicht mit einem Begrüßungswort des Inhalts beginnen, dass ich diesem wackeren Verfasser der unsterblichen »Undine« von Herzen gönnen würde, dass er mit einem seiner Speere den Ballistik-Ingenieur Bonaparte erlege, ohne dass freilich dessen Hirnsubstanz dabei Schaden nähme – da trat der hinter der Eiche hervor, der sogleich mein Brustbein erglühen ließ! Der Mädchensoldat – pardonnez, mon chasseur! Selbst aus noch so großer Entfernung sah ich sein Philtrum! Es war, wie ich nun merkte, von unserer ersten Begegnung her gleich treulich in meinem innersten Herzen abkonterfeit gewesen, jenes Philtrum auf seiner großzügigen Labia oris superioris! Kurzum: Mein Entzücken erblickte zuerst seine nun trockengefallene Mädchen- und Knabenrotzrinne auf seiner Oberlippe.
Der erste überhaupt sichtbare Lützower Jäger zu Fuß auf der Welt stand nun ganz dicht vor mir. Sein Philtrum war, nahe besehen, eine weiche Mulde, die beidseits bis zur sanftesten und leicht gebogenen Auffaltung der Wangen hin von noch kaum merklichem weißgoldenem Flaum überflogen war. Das, was die Griechen Amorbogen nennen, die bei diesem hier so schöne kleine Schwinge des Oberlippenscheitels, war um ein Weniges zu rot, ja sogar mit einem Anflug des Wundseins versehen wie von Erkältungen herrührend – oder auch von zu langem Flötenspielen. Oh, da hätte wohl so manches Mädchen das Anblasloch jener nun weggesteckten Querflöte sein mögen, das solch ein Philtrum und dazu noch eine spielend flatternde Zungenspitze zu einem musikstücklangen Kusse empfing!
»Ja, Meckel von Hemsbach, da staunt Ihr nicht schlecht«, sagte Fouqué, »auf einen Kämpen des Königs zu treffen, der partout und in allen Ehren unbelehrbar seine Speere zu den Flötentönen Friedrichs des Großen schleudert, was?«
»Ich würde«, sagte ich zu dem in allen deutschen Landen und besonders auch in Halle so berühmten Mann, »wohl eher staunen, liebster Ritter Huldbrand, wenn Ihr ein englisches Schießeisen wie ich benutzen würdet, aber egal wie wir’s beide machen, mit der englischen Muskete oder mit der Thiudolflanze ...«
»Frisch auf, zum fröhlichen Jagen / Es ist nun an der Zeit«, sang da auf einmal dieser Lützower Flötist mit heller und begeisterter Stimme das auch sonst überall zu vernehmende Lied des deutschgermanische Ritterbücher schreibenden urfranzösischen Barons de la Motte Fouqué, »es fängt schon an zu tagen / Der Kampf ist nicht mehr weit!«
»Mein guter Kamerad«, sprach ich die Lützower Querflöte an.
»Albrecht von Hemsbach?«, fragte die und lachte dabei unsicher dazu. Und bei diesem Lachen verschwand das Philtrum, jene entzückende Oberlippenrinne, ja ich sah, wie sich selbst ihr niedlich-kindlicher Amorbogen streckte, während sich auf den glühenden Wangen zwei scharfe, in der Mitte etwas dünne, sonst aber überaus grazile Bögen bildeten, die von den aufgeregten Nüstern an den lachenden Mundwinkeln knapp vorbei schließlich noch ein kleines weiches Kinn umrundeten.
»August ist so ein Garnisonskind«, sagte Fouqué, »er gehört zu den achtzig Mann, die ich von Potsdam her dem Könige in Breslau zuführte.« Dabei habe Blücher selber zu ihm in kriegerischen Reimen »Die einen mit’n Sabel, die andern mit’n Schnabel!« gesagt, woraufhin er, Fouqué, dem alten Haudegen seinen altehrwürdigen Pallasch vorwies, um zu bedeuten, dass er vor allem wegen dem »Sabel« zu ihm gestoßen sei.
»Der da ist erst unterwegs zu uns gestoßen. Aber er will partout nicht mit zu meinen gut preußischen Brandenburgischen Sechsten Kürassieren! Sondern zu Lützow mit seinen Ausländern zieht es ihn, damit der ihm gelegentlich höchstpersönlich, glaubt der doch noch, vom Partisanen Schill auch erzähle! Wie der da einen Baron wie mich behandelt! Auf einmal gibt es überall solche freien Menschen, die es dennoch lieben, Preußen zu sein!«
»Ich bin August Renz und auch noch direkt aus Potsdam!«, rief der Gemeinte, erstmals Aug in Auge mit mir, und rammte mir seine ausgestreckte Hand in den Bauch. Wir beide waren, merkte ich, auch von gleicher Körperhöhe.
»August Meckel«, konnte ich nur antworten und eine schlanke, aber durchaus zupackende Hand dabei schütteln, »August Albrecht Meckel heiße ich – hast du auch einen zweiten Vornamen, lieber Kamerad? Ich kann schon den einen bei mir, August, nicht so recht leiden.«
»Freut mir, Albrecht – denn nenn mir doch Leo«, sagte August und wurde sofort rot, »oder Leopold. Falls wa uns noch mal treffen sollten. Sieht ja ganz danach aus.« Er wich von mir fort, zückte etwas ungeschickt seine Querflöte und sagte irgendwie fast flehentlich zu Fouqué: »Machen wir weiter, Herr Baron?«
Fouqué lachte mich an. »Schießen kann der olle Potsdamer August schon ausgezeichnet! Allerdings wohl nur mit Tönen aus der Flötenbüchse! – Wie wäre es nun, August, du nähmest jetzt und hier von mir deinen Abscheid ... (Fouqué, dieser doch etwas unique Duz- und Deutschbruder von Jahn, sagte doch tatsächlich auf altdeutsch »Abscheid?«) ... und folgst diesem wackeren Hallodri und Oberjäger auf den Schießplatz? Schau mal, gleich zwei Musketen hat der beiderseits an seinen Sattelblättern stecken!«
»Das sind treu bewährte englische Waffen«, sagte ich und lud Leo mit einem Wink dazu ein, an Jean Weinbrand heranzutreten. Leo fuhr mit den Fingerspitzen über das Schloss der einen, der neuen Muskete und folgte so auch sanft der dicken S-Kurve des Hahns.
»Diese ist eine ziemlich neue Indian Pattern, die ist zwar Massenware, aber man kann bei ihr auch, wortwörtlich, von einer sehr trefflichen Waffe sprechen – du streichelst gerade ihren so charakteristischen Schwanenhals-Hahn.« Leo zuckte zurück.
»Du kannst diese Indian Pattern auch gleich ganz nehmen und wenn du dich mit der gut einschießt, so sollst du sie auch behalten!«
»Danke, Albrecht«, sagte Leo, »von Hemsbach.«
»Danke mir erst, Leopold Renz, wenn du von mir mit der da auch treffen gelernt hast.«
Mein lieber Heinrich, halte mich bloß nicht für einen verdorbenen gottlosen Mann, der noch angesichts seines Todes in seinen abwegigen Lüsten zu schwelgen gedenkt, wenn ich Leos Antlitz hier noch einmal vor allem für mich selber, aber eben deshalb auch für dich, mein Sohn, auf eine nahezu anatomische Weise heraufbeschworen habe. Ach, verflucht! Sind doch auch alle Bildnisse sonst, die ich von diesem geliebten Menschen mit Feder und Stift gemacht, auf so unglaublich traurige Weise zugrunde gegangen! Alle sind verloren, bis auf jenes eine, welches dir – schon von deinen Kindestagen her so vertraut – deinen Vater als einen Hirsch abdeckenden Lützowisehen Nimrod zeigt. Dazu sind einige Kameraden zu sehen. Du konntest unten auf der Bildleiste ihre Namen lesen, etwa den des Oberjägers Palm, Bruder des auf so scheußliche Weise hingerichteten Buchhändlers, Vietinghoff auch, neuer Bataillonschef nach Jahns Ablösung durch den Lützower Ehrenrat und Friesens Freund, der später dessen sterbliche Überreste nirgendwo in den deutschen Landen beerdigen konnte, oder den des aus dem Hintergrund herangaloppierenden und uns etwas zurufenden legendären Hauptmanns Förster. Nur dem blonden und sehr knaben- oder mädchenhaften Lützower in voller Montur gleich im Hintergrund links bei jenem Leiterwagen, den unsere zweite Schwadron als möglichen Verwundetentransporter irgendwo im Mecklenburgischen requiriert hatte, genau dem habe ich unten auf der Leiste keinen Namen gegeben.
Aber genau von dem rede ich hier vor allem. Wegen dieses Menschen hätte ich der hirnanatomischen Compagnie von Reil und Meckel später beinahe den Kopf von Napoleon gebracht!
Der Plunket’sche Anschlag auf dem Rücken liegend wirkt ziemlich lächerlich und ist im Übrigen meist unbequem – »außer für Thomas Plunket selber«, sagte ich auf dem Schießplatz zu Leo, »und außer natürlich für mich! Kurzum, der Plunketanschlag ist was für Leute, die Vögel, kleine Tiere oder fast schon zu weit entfernte Generäle zu schießen haben, die sich gerade gar nicht oder nur sehr langsam in dem Feld bewegen, das sie selber angerichtet haben.«
»Für so ’ne hinterlistige Schießtechnik«, sagte Leo, »leg ich mich schon ma gerne lang!«
»Du bist allerdings, erstens, ein Jäger zu Fuß«, hatte ich nun einzuwenden – vor allem gegen meine sehr lebendige Vorstellung davon, wie ich mich gleich zusammen mit dem schönen Jäger Renz im Grase wälzen würde –, »aber du müsstest, zweitens, mit einer sehr treffgenauen Waffe oft auch schnelle Ortswechsel vornehmen können, was nur zu Pferde möglich ist, und du müsstest, drittens, wie der Name dieser Schießtechnik schon sagt, solch ein Adlerauge und solch einen kaltblütigen Fuß und Abzugsfinger haben wie jener Thomas Plunket. Also, mein lieber Leo! – dieser Plunket von den 95sten Schützen, glaub ich, in der Leichten Division von Sir John Moore – das war erst vor ein paar Jahren da unten in Spanien – erlegte mit seinem Anschlag auf dem Rücken liegend, und übrigens sein Pfeifchen dabei rauchend, den berühmten französischen Kavalleriegeneral August de Colbert.«
»Aha! Noch so ’n dummer August wie wir zwei«, sagte Leo im Gras zu meinen Füßen und mit meiner – nein, seiner Indian Pattern. Wie er mit dem rechten Fuß den Gewehrriemen und somit die ganze Waffe von sich streckte, mit der Linken sich den Kolben an die Schulter zog und mit der Rechten anscheinend ganz gut im Abzugsbereich zurechtkam, zeigte mir, dass ich ihm wohl nicht allzu viel mehr beizubringen hatte. Nur treffen musste er dann schon selber.
»Ganz falsch!«, rief ich jedoch und ließ mich zu ihm ins Gras sinken. »Man muss sich den Riemen einmal um den Unterschenkel wickeln – so hier!«
Als ich mir nun Leos rechtes Bein quasi unter meine Achsel klemmte und an seinem Unterschenkel derart hantierte, als ob ich ihn mit einem Lederriemen abbinden und zugleich entblößen wollte, da spürte ich erstmals mit Macht all mein unglückliches Glück – ich spürte es an den allmählichen Blutansammlungen an gewissen anschwellenden Körperteilen. Ich ließ, recht eigentlich entsetzt von mir selbst, ab von Leo – und der?
»Alles klar, Albrecht«, sagte Leo, »bin ja kein Kind, dem de noch die Schuhe zubinden musst!« Auf seinen Ellenbogen aufgestützt und mit einem aufgestellten und hin und her schwingenden Bein lag er im Grase und schaute mich begeistert an. Ich redete mir gleich wieder inbrünstig ein, dass dies auch tatsächlich Begeisterung sei und zwar Begeisterung nur wegen mir. Leo war einfacher Lützower Jäger zu Fuß – zwei Butterblumen nickten an seiner schwarzen Achselklappe mit den blutroten Rändern. Nahezu krampfhaft habe ich mich da an Jahns Schwarz-Rot-Gold zu denken gezwungen, an das Schwarz-Rot-Gold von Kriegern schließlich, Lützower Jägern, in einer Wirklichkeit, die selbst ein Märchendichter wie der Baron de la Motte Fouqué anscheinend ernster nahm als ein Anatom und Gerichtsmediziner wie ich.
»Komm, Albrecht«, sagte Leo, »leg dich wieder hin. Sei doch nicht so ungeduldig mit mir!« Und ich stützte mich auch auf meinen Ellenbogen auf, allerdings auf den anderen – wir zwei nun fast spiegelbildliche Entsprechungen, schwarz-rot-goldene Lützower und Plunket’sche Scharfschützen – »Pardong wird aber nich jegeben!« Das Gras und die Erde dufteten schon vorfrühlingshaft, viele freie Vögel und noch viel mehr freiheitlich gesonnene Schüsse sangen in der Luft, die Brünnlein flossen quasi, und ich musste trinken – so viel Bewegung war in und aus unseren Blicken und hin und her. Die Zeit war stehengeblieben in den Augen von Leo, unter diesem wasserblauen Himmel voller zerpflücktem hellem Gewölk, und darüber noch die etwas dunkleren goldenen Schwingen seiner Augenbrauen. Er erzählte von seinem Vater, einem invaliden und musikalisch und überhaupt gebildeten Gardeunteroffizier, und vom anscheinend gar nicht so stocksteifen Potsdam. Doch so genau hörte ich schon sehr bald gar nicht mehr hin, ich lauschte vor allem dem Instrument dieser durchaus nicht perfekten, hellrauen und manchmal sogar ein bisschen wie gekünstelt wirkenden Stimme. Zuweilen war aber ein wie eine ganze Wiese sirrendes und flirrendes Timbre darin, das mich tief im Innersten berührte. Erst als Leo mich auf einmal unverwandt und auffordernd ansah, bemerkte ich, dass er seine Erzählung geendigt hatte und nun wohl ich mit der meinigen dran war. Dem Folgenden fehlte wohl die Musik, die Leo mit jenem Instrument hervorgebracht hatte, das auch der Mediziner zu Recht mit Syrinx bezeichnet. Dafür aber konnte ich nun, wie ich immer besser herausbekam, das Wetter in Leos Augen machen, je nachdem, wie und was ich von mir und freilich auch von uns Meckeln überhaupt erzählte – und die sind nun freilich ein Alle-Wetter-Stoff! Möglicherweise war ich gerade dabei gewesen, einen Grummelturm aufzurühren, eine riesige erzählte Gewitterwolke, vermutlich mit einem blitzeschleudernden Fritze und einem donnernden Napoleon darin – als der Gottvater selbst von noch weit darüber zu sprechen begann.
»Nummer dreizehn!«, rief er herab auf uns, »ich erinnere dich bloß mal dran, dass wir in den Krieg gezogen sind, weniger in den Frieden! He! Hier ist die Achtzehn! Wir sind eiligst nach der Ortschaft Rogau nahe Zobten am Berge hinbefohlen, zu Major von Lützow nämlich – aber ohne den da!«