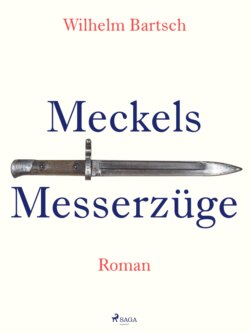Читать книгу Meckels Messerzüge - Wilhelm Bartsch - Страница 5
Wie man 1803 seinen Vater kochte
ОглавлениеIch war dreizehn Jahre alt, mein Freund Ludwig Wucherer erst zwölf, als das Unvorstellbare auch wirklich geschah – wir schnitten meinen Vater auf. Seine Eingeweide schwammen in weißlichem Wasser, und tatsächlich ragte die gewanderte Leber wie ein Inselberg daraus hervor. Die Geheime Räthin Meckel, deine Großmutter, musste eine große Schöpfkelle aus der Küche holen, weil die anatomische für die Ausschöpfung ihres Gatten einfach zu klein war. Wir köpften den Vater, natürlich vorsichtig, und wir weideten ihn aus. Dann entfleischten wir ihn und kochten seine Knochen.
Das alles sollte für uns noch mit den Jahren sehr weitreichende Folgen haben.
Philipp Theodor Meckel, Edler von Hemsbach, hatte nicht nur seit langen Jahren unter Rheumatismen des Fleisches und der Knochen zu leiden gehabt, deren Schmerzen ihn bereits krumm gehen ließen, sondern auch, wie bereits unser Großvater Johann Friedrich Meckel der Ältere zu Berlin, an den typischen Vergiftungserscheinungen eines Anatomen und Arztes, zu dessen Aufgaben es auch zählte, mit der Fingerkuppe vom Urin und von den Gallensekreten der Kranken und Toten eine Probe des Geschmackes zu nehmen. Schon allein deswegen wohl war das Antlitz unseres Vaters dann allmählich blässlich und quasi bitter geworden, sein Appetit war geschwunden, die Verdauung hatte gestockt, das Auge war trüb und triefend und die Gesichtszüge hatten ihre Haltung verloren. Seine ganze Handlungsweise überhaupt hatte begonnen, jener Bestimmtheit zu ermangeln, die man an ihm gewohnt war und die unser aller bisheriges Leben mit Stolz, Freude und Bewunderung erfüllt hatte.
Die Bestimmtheit eines großen Anatomen, aber auch die unbefangene und warmherzige Art des wahren Arztes, auf Menschen zuzugehen, hatten unseren Vater Philipp Theodor Meckel all das erreichen lassen, was er selber wollte. Und mehr! Er hatte – um gleich einmal nur ein paar wichtige Nebensächlichkeiten zu erwähnen – halbwegs erfolgreich, zumindest in Halle, gegen Schnürbrüste angeschrieben und gewettert und eine Technik des zweihändigen Zufühlens bei Schwangeren entwickelt, die sich durchsetzte. Er hatte Mütter toter Kinder vor der Todesstrafe wegen Kindstötung erretten können, beispielsweise einmal, indem er nachweisen konnte, dass das tote Kind – und nunmehrige schöne Meckel’sche Präparat – ein besonders extrem missgebildetes und im Mutterleib verstorbenes Wolfsrachenkind gewesen war. In einem anderen Falle rettete er einem als Gattinmörder angeklagten königlich-preußischen Jägermeister das Leben, indem er in der in vier heißen Sommertagen schon gut verwesten Leiche des angeblichen Schussopfers Millionen wimmelnde Maden nachwies, deren Gangaustritte in der Haut wie von Schrotkörnern hervorgerufen erschienen. Philipp Theodor Meckel entwickelte Besserungen bei der Schaambeindurchtrennung und beim Gebrauch jener Fried’schen Hirnlöffel, die die Köpfe toter Leibesfrüchte bei nötiger Kraniotomie schon im Innern so zerkleinern, dass sie mutterschonend und ohne sie vom Rumpfe abzureißen, wie es oft geschehen, herauszubringen sind.
In Göttingen war er ein Gleichberechtigter in der Runde mit Blumenbach, Lichtenberg und Albrecht von Haller, in Edinburgh und London befreundete er sich mit William und John Hunter und in Paris mit dem berühmtesten Embryologen und Geburtskundler seiner Zeit, mit Baudeloque. Sogar die Zarin Anna Pawlowna wünschte einmal, dass unser Vater ihr Geburtsarzt sei. Er war dann in Sankt Petersburg so erfolgreich, dass er dadurch reich wurde, auch ohne, wie vom Zarenhaus erbeten, die ererbte Meckel’sche Sammlung für 200 000 Rubel zu verkaufen.
Dennoch war sich unser Vater bis zu seinem Tode nie zu fein gewesen, häufig und aufopferungsvoll zu den Armen zu gehen und diese umsonst zu behandeln – freilich immer mit dem Hintergedanken, auch auf diese Weise und ohne allein den städtischen Armenvogt und die Directionen der umliegenden Zuchthäuser und Korrektionsanstalten zu bemühen, an »Cadavres« zu gelangen, besonders – wie später auch sein Sohn – an die Leichen möglichst frisch geschwängerter Weiber und Mädgen. Nicht nur dein Onkel Fritz, mein lieber Heinrich, konnte, manchmal sicherlich völlig unbewusst, sehr pietätlos werden. So beklagte unser Vater sich einmal bei der preußischen Regierung darüber, dass ihm zu wenige »Cadavres« zur Verfügung stünden. Selbst die vier kranken Veteranen im Lazarett wären als solche nicht zu erwarten, »weil sie leider ihrer baldigen Genesung entgegensehen« würden.
Unser Vater war aber im Gegensatz zu seinem Sohn Fritz, dem Haupt-Meckel, nicht so gleichgültig gegenüber einer breiteren Öffentlichkeit gewesen. Er stammte schließlich noch aus einer aufklärerischen Epoque, deren Licht in Halle besonders früh und hell erstrahlt war. Und so ahnten wir schon, noch ehe wir unsers Vaters Philipp Theodor so folgenreiches Testament kennenlernen mussten, was da auf uns zukommen könnte, als wir eines Tages in den »Wöchentlichen Hallischen Anzeigen« von Vaters Hand den Artikel »Von dem Nutzen der Zergliederung menschlicher Leichname« zu lesen bekamen: »Der Medikus, der Mensch, der Christ, können unzehligen Vortheil von der Kenntniß des menschlichen Körpers schöpfen. Ersterem ist sie eben so unentbehrlich, als dem Regenten die Kenntniß seines Landes, oder dem Uhrmacher die Kenntniß der Uhr ist. Nur der Arzt, der vermögend ist, durch die undurchsichtigen Hüllen des Körpers so zu schauen, als ob sie von Glas wären, wird vermögend seyn, mit Zuversicht Mittel zu gebrauchen, wodurch er dem Uebel entgegen arbeitet. Man erlaube mir, ohne es zu beweisen, dass ich die Unmöglichkeit davon behaupte und darauf bestehe, dass man zu der Vollkommenheit, man sey Arzt, Feldscher oder Hebamme, durch nichts als mühsame Durchsuchung erblasster Nebenmenschen gelangen kann. Ohnerachtet, dass auch sogar Hohe hiesigen Ortes behaupten, dass ich mit Zerfleischen von Lebendigem mir zu thun mache, hoffe ich doch, dass der gemeinste Mann mich anders versteht, wenn er dies Blatt zu Händen bekommt.«
Schließlich war unser Vater nun selber ein »erblasster Nebenmensch« geworden, den zu »durchsuchen« er uns testamentlich zur Pflicht gemacht hatte. Auf einer Reise nach Eisleben zu einer Patientin im letzten Herbst vor seinem Tode hatte er kurz zuvor auch noch die traurige Entdeckung gemacht, dass seine Leber bis zur Nabelgegend herabgestiegen war. Mit dem Anfang des neuen Jahres entstanden Gelbsucht mit nun fast brauner Farbe, ein unaufhörliches und schmerzhaftes Würgen und Wassersucht in der Bauchhöhle.
Mein Sohn, erspare mir hier die Schilderung der Krankheitsqualen deines Großvaters und wie er schließlich starb. Ich habe es jedenfalls viel besser als er. Ich sterbe hier in unserem Hause in Bern an der manchmal sogar Freude erregenden Lungenschwindsucht. Branntwein und Opium in der Form von Laudanum begleiten mich auf meinem letzten Weg und spenden mir wechselseitig ihren Trost, wenn beide auch öfters zu großem Schabernack aufgelegt sind.
Du, mein Heinrich, mein und Meckels Liebster, erfüllst die gesamte Hoffnung des Stammes der Meckel. Du hast nämlich den Meckelkopf, wie ihn eine offen gebliebene Stirnnaht hervorbringt. Ich, dein Vater, habe ihn nicht. Fritz hat ihn natürlich, und ein besonders schönes Exemplar der Meckelköpfe hatte dein Großvater.
Hör einmal, was Reil von ihm sagte, und zwar im »Halleschen patriotischen Wochenblatt«: »Selbst nach seinem Tode, so war es sein Wille, wollte er noch nützen, sich zu seinen Lieblingen sammeln, und durch sein Beyspiel das Vorurtheil des Pöbels im Reiche des Denkens zerstören. Sein Lieblingsaufenthalt war ihm die Galerie seiner Toten, wie dem Dichter ein romantisches Tal. Sein eigentliches Fach, die Anatomie, liebte er mit Enthusiasmus. Er kannte kein anderes Idol neben ihr; und eben dies macht groß in eigner Sphäre. Ein glücklicher anatomischer Fund war ein Ereigniß, das ihn mehr ergötzte, als andre große Lotteriegewinnste, und das selbst noch in seinen letzten Tagen mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit heitere Laune in die Züge des Trübsinns mischte. Er sah seinen Tod mit größter Bestimmtheit vorher und äußerte dies bey der Aufnahme seines letzten Willens mit großer Geistesgegenwart und Ruhe. Er litt, besonders in den letzten Wochen, unglaublich, doch standhaft; fürchtete den herannahenden Tod nicht, sondern nur die Art desselben und dies nicht ohne Grund, wie sein langsam und mit dem gewaltsamsten Kampf der Natur heranrückendes Ende bewiesen hat.«
Vielleicht sind Ludwig und ich auch deswegen nicht nur die jüngsten, sondern auch die tapfersten und fleißigsten Menschenmatzerierer gewesen, die es je gab. Tief unten in der anatomischen Küche unseres Laboratoriumsturmes in der Stadtmauer von Halle war ich an jenem 17. März 1803 auch im Kreise meiner anderen lieben Brüder, außer Fritzens, der an jenem Tage noch von Wien und Würzburg her unterwegs in das Riesenhaus war, schwer damit beschäftigt, meinen Vater zunächst zu tranchieren. Ich hatte mir dazu seine Unterkeulen auserkoren, deren Sehnen allerdings nur sehr schwer zu durchtrennen waren. Wenn mir und meinen Brüdern, und selbst dem Patenkind Ludwig, durch ihn, Philipp Theodor Meckel, dergleichen schon zur Pflicht gemacht worden war, so wollte ich solche Arbeit bei ihm doch wenigstens in einer Körpergegend verrichten, die zuvor immer gnädig von Hosen- oder wenigstens Unterhosenbeinen verborgen gewesen war, so, wie sich auch der scheinbare Vater des Himmels durch sein Himmelsblau, seine Wolken, sein Sternenzelt oder die gerippten Gewölbe seiner Kirchen verborgen hält. Diesen Über-Vater zählten wir Meckels nicht mehr zur Familie. Überhaupt hielten wir Gottes Reich, im Gegensatz zu den Reichen der unbelebten Natur, der Pflanzen und der Tiere, nicht für existent. Zumindest hatte das Himmelreich ungültig zu sein für einen Meckel, welcher Werke der Auferstehung lieber selber mit Skalpell und Kanüle, mit Drahtschlinge und Kloschwitzer Kirschgeist verrichtet.
An wen also konnte ich mich an jenem Tage wenden in meiner Not? Mein geliebter Vater lag ja nun unter mir. Zu seinem Haupte wagte ich erst gar nicht aufzublicken. Da war auch nichts mehr. Es thronte bereits enthirnt und von einer Decke verhüllt oben auf seinem eigenen Schreibsekretär und erwartete, neben sich in einem Glas das entnommene Gehirn, den Freund und Kollegen, den Hirnanatomen Johann Christian Reil, zur weiteren Durchsuchung und schließlichen Entfernung seines wieder herabgezogenen Gesichtes und aller anderen Weichteile.
Er hatte uns alle dazu verpflichtet, diesen Körper zu zerlegen, indem er es testamentlich niedergelegt hatte. »Ich will durchaus nicht begraben sein«, schrieb er da, »und mache es den Meinigen zur unverbrüchlichen Pflicht, mich zu sezieren. Mein Knochengerippe soll künstlich zusammengesetzt werden und einen eigenen Schrank zur Aufbewahrung erhalten. Sollte sich irgendetwas Merkwürdiges in meinen Eingeweiden finden, so wird es nach den gewöhnlichen Methoden aufbewahrt, so wie ich meine beiden Kinder – ach Gott! – aufbewahrt habe.«
An Vaters Sektion meines noch so winzigen Brüderchens Friedrich habe ich, zu jenem Jahr selber noch ein Knabe, ebenfalls teilnehmen müssen, durchaus auch mit schauderndem Interesse. Allerdings war es mir da noch erspart geblieben, mit eigenen Messerzügen zu der Zerlegung des eigenen Fleisches und Blutes etwas beizutragen.
Mein Freund Ludwig war da etwas weniger heikel gewesen und hatte, von Vater dazu ermuntert und von seiner kundigen Hand dabei geführt, einen langen und eröffnenden Messerzug durch des Fritzleins Bauchdecke getan. Damit begann eine wenn auch nur kurze Zeit, wo ich meinen Ludwig überhaupt nicht mehr leiden mochte, denn fortan schien unser Vater den Ludwig mehr liebzuhaben als mich. Er nahm ihn bei jeder Gelegenheit mit in sein anatomisches Arbeitszimmer, wo er ihn an weiteren Sezierungen teilnehmen ließ. Mein Freund Ludwig handhabte das Skalpell dermaßen geschickt, dass unser Vater dann gegen die Eltern Ludwigs nicht nur seine Anstelligkeit rühmte, sondern wir alle noch lange Jahre danach überzeugt waren, dass sein anatomisches Talent den Knaben Ludwig Wucherer dereinst einmal unter die akademischen Würdenträger der Medizin in ihren fleischfarbenen Talaren bringen würde.
Anderthalb Jahre später war schließlich auch noch der kleine wunderschöne Philipp gestorben, und Vater, unter Ausschluss von uns allen, hatte den Filippo zwar zu sezieren und nach der Todesursache zu durchmustern vermocht, aber ihn auf kaltem oder heißem Wege zu matzerieren, das konnte er nicht. So entstand das Skelettlein des Philipp auf dem etwas längeren Wege der Fäulnismatzeration. Er kam in eine Kiste mit lauter Löchern und wurde hinter dem Gasthaus »Zur Schwarzen Schürze« in Giebichenstein, wo wir Meckels damals schon ein sommerfrisches Zimmer dauerhaft gemietet hatten, ein paar Wochen lang unter Beigabe ungelöschten Kalks zur schnelleren Kolliquation seiner organischen Gewebe in die Saale gehängt. Später aber war ich selber noch an der Restreinigung von Filippos Knochen mit dem Schabemesser beteiligt worden. Freilich war auch Ludwig wieder dabei. Ich weiß noch, dass meinem Freunde da die ehrlichsten Tränen die Wangen herabliefen und ich mich mit ihm nicht nur wieder vertragen, sondern an jenem Tage »auf immer und ewig« verschworen habe.
Das galt auch bei der Arbeit an meinem Vater. Mein Freund, der nun die Arme unseres erblassten Nebenmenschen und seines väterlichen Anatomielehrers zu entfleischen hatte, war zugleich auch derjenige, der mich notfalls nicht nur auffangen, sondern mich überhaupt dazu bewegen konnte, das zu tun, was ich tat.
Vaters lange krumme Beine sahen auch sonst sehr schrecklich und überaus fremd aus. Seine ohnehin großen Knie ragten empor. Sie schienen mir in ihrer wehrhaften Helle, ja in ihrer fast makellos gebliebenen seltsamen Schönheit sagen zu wollen, dass ich getröstet bleiben solle. Vaters Knie waren wie unvergängliche Planetenhalbkugeln. Sie würden durch seinen Tod hindurch Bestand haben und leuchten in dem kleinen Weltall seines Glasschrankes.
Viel später, nachdem Ludwig noch die französischen Feldzüge von 1814 und 1815 mitgemacht hatte, erzählte er, wie er dann doch seinen endgültigen Abschied von der Anatomie genommen hatte. Bei Montereau an der Mündung der Yonne in die Seine unweit von Paris habe er einen vermissten Kameraden gesucht, Schmucker aus Merseburg, einen Jäger zu Fuß. Als er es schon aufgegeben und sich unter einer tiefhängenden Uferweide zum Trinken niedergebeugt hatte, sah er – und hörte er auch – die vielen Aale. Schmuckers Leiche war dort mit einem Beine an einen Ast gehängt worden, und sein Oberkörper bewegte sich wie noch lebendig hin und her im Wasser.
Aber erst als mein Ludwig dann in Paris erfuhr, dass aus jener Gegend an der Yonne die schmackhaftesten Aale kamen, nunmehr für die Tafel der siegreichen Allianz, da habe er auf einmal wieder und sehr heftig an das traurige Kistchen in der Saale mit Philipps Überresten denken müssen und sei überhaupt wie nie zuvor in die tiefste Seelennot geraten. Nach seinem »De profundis clamavi«, das länger andauerte, als er es für möglich gehalten hatte, habe er beschlossen, fortan die Welt lebendiger und auch beseelter als ein Krieger oder Anatom zu betrachten.
»Am Ende«, so lautete übrigens der brummige Kommentar des kriegerischen Anatomen Johann Friedrich Meckel, »wird er aber doch noch an der Knochenhand unseres Vaters vor den Thron seines Herrn geführt werden.« Auch mich wird Vater bis an mein schon baldigstes Ende nicht lassen. Mögen seine Knie mir dann nach Sonstwohin voranleuchten!
Wir kochten Vater mehrere Tage lang mit Ätznatron. Die Schabemesser, das Scheidewasser und das Terpentinöl für die Knochen lagen und standen schon bereit.
Da es für mich nach meiner tieftraurigen und heftig verrichteten Tranchierarbeit um Vaters doch noch ganz tröstliche Knie herum nichts mehr gab, was ich noch hätte tun wollen, ging ich ein letztes Mal Vaters Kopf besuchen, von dem ich zwischendurch unseren kleinen Ferdinand hatte rufen hören, dass er für die weiteren Bearbeitungsstufen enthüllt sei, zu denen nun Johann Christian Reil wieder eingetroffen war.
Der Kopf Philipp Theodor Meckels oben auf seinem Schreibpultaufsatz saß jetzt auf einem schwarzsamtenen Kissen, das ihm die Geheime Räthin Meckel zum letzten Male nun untergeschoben hatte – nur dieses Mal nicht unter das bereits verarbeitete Gesäß ihres geliebten Gatten.
Reil stand lange vor dem Meckelkopf und las noch einmal die leidensgezackten testamentarischen Zeilen mit dem nunmehr dem Pergament zugefügten Siegellack eines dicken Blutstropfens aus dem Meckel’schen Haupte.
Er ging hin und her wie in einem schlimmen Käfig und schüttelte immer wieder ungläubig seinen Kopf – eben gerade weil er selber ein eigentlich gläubiger Mensch war, vielleicht bis hin in die tiefsten Winkel seines Hirnes, die schon damals nach ihm als die insulae Reilii, die Reilischen Inseln, benannt worden waren.
So sah ich, mir ein bisschen zum Troste, diesen kraftvollen Friesen an einem solchen Tage ebenso ratlos und entkräftet wie mich, wenn mich meine Brüder und mein Freund Ludwig von unserer grässlich interessanten Arbeit schon fortgeschickt hatten, um Onkel Reil von ihrem Stande zu unterrichten – ich war ja, neben Fritz natürlich, Reils Liebling von all den damals noch vorhandenen Meckeln gewesen!
Einmal packte mich der sonst so kühle und berührungsscheue Reil und ich stand eine Ewigkeit im warmen Schraubstock seiner Arme und Brust. Tief bohrte sich ein nordischer Ehrenstern am Kragen seines Gehrockes in meine Wange, aber die harten Hände des großen Hirnanatomen, Klinikers und Psychologen spürte ich zittern auf meinem Kopf – bis mit einem Ruf der Begeisterung unser aller Irrwisch Ferdinand, zehn Jahre alt, hereinstürzte und rief: »Onkel Reil, Onkel Reil, denkt nur! Unser lieber Vater ist ein Monster!« Und nach einer Schnappatmung stieß er seine Sensation hervor: »Er hat einen ganzen Haufen Knochen zu viel!«
Ich stand nun Vaters traurigem Schreibsekretär zur Seite und hörte vom Hof her den Aufschrei der Geheimen Räthin, der irgendwie auch gleich noch in die Stadt gelangte, dort wie ein Wirbelwind umherlief und es schließlich bis in die jüngsten Annalen von Halle geschafft hat. »Wenn er das nur erlebt hätte!«, rief Philipp Theodors Gattin, »wie würde er sich doch noch gefreut haben!«
Philipp Theodor Meckel, der Sammler von Monstrositäten – oder von Bildungsabweichungen, wie es sein Sohn Fritz nüchterner ausdrücken würde –, war selber und ganz unbewusst ein lebendes Beispiel gewesen für eine schöne Fehlbildung, wie sie sein Sohn dreizehn Jahre später im zweiten Band seines »Handbuches der pathologischen Anatomie« beschreiben sollte: »Findet sich eine eigene, völlig getrennte überzählige Rippe, so erscheint sie entweder zugleich mit einem überzähligen Wirbel, oder sie bildet sich nur dem letzten Halswirbel oder dem ersten Lendenwirbel an.« Vaters Rippe war mit einem überzähligen Wirbel dem ersten Lendenwirbel sehr schön angebildet.
Ludwig trat damals feierlich herein, schob den Ferdel zur Tür hinaus und sprach quasi wissenschaftlich tapfer zu Reil: »Wir sollten nun mit dem Kopf beginnen mit Ihrer ganz nötigen Hilfe, lieber Herr Professor! Vermuten Sie denn nicht auch, dass sich zum überzähligen Rippenwirbel noch eine tüchtige Sutura frontalis persistens gesellen wird?«
»Bei mir ist es jetzt genau anders herum, mein kleiner tapferer Mann«, hatte Reil, der sonst nur seine Stentorstimme erklingen ließ, sehr traurig und kaum noch hörbar zum Ludwig gesagt. Er hatte das mit der Stirnnaht wohl bereits vor vielen Jahren vermutet, als er seinen Freund und Kollegen Meckel nämlich das erste Mal überhaupt zu Gesicht bekommen hatte.
Reil wollte es nun dem kleinen Ludwig Wucherer anscheinend noch näher erläutern und hatte sich dazu etwas herabgebeugt, da stand auf der Türschwelle – urplötzlich! – das von Wien und Würzburg herangeeilte neue Familienoberhaupt, der bereits von Göttingen bis nach Berlin so positiv herumgesprochene Johann Friedrich Meckel der Jüngere, welcher schon jetzt als die angesagteste Koryphäe unter den Promovierten galt auf dem weiten Feld der Missbildungen des Herzens. Er war stundenlang verzweiflungsvoll vor sich hin stammelnd in der Stadt herumgeirrt, wie noch lange Zeit später von Mund zu Mund berichtet worden ist.
Er hielt ein in verstärktes Leinen geschlagenes und reich versiegeltes viereckiges Paket unter seinem rechten Arm, mit seinem linken umarmte er mich, den zu ihm Hingestürzten, gleich gröblichst und nicht so zartfühlend, wenn auch fest wie Reil vorhin meinen Hals. Er sagte kein Wort und sandte keinem einen Blick.
Der wieder herbeigeschlichene Ferdel aber, sah ich, entzog das künftige Prachtstück der Meckel’schen Kunstsammlung, die so sorgsam verpackte nithart-gothartische Zeichnung eines Dreigesichtes aus Würzburg, dem Arm Meckels und trug es wie eine allein ihm gehörige Beute in die Nachbargemächer zur näheren Musterung.
Meckel war sogleich auf das Schreibpult unseres Vaters zugegangen und hatte, schon während er auf den Stuhl dort gestiegen, mit einem Schlage wie ein Schoßhündchen zu winseln begonnen. Er umarmte das Samtkissen mit seiner so traurigen Last und, wie ich noch nichts gesehen habe auf der Welt, küsste die geschwollenen gelben Augenlider unsers armen Vaterkopfes jeweils drei Male auf das Zärtlichste. Nun weinte auch ich, Reil weinte, selbst Ferdel im Arme der weinenden Meckelin weinte. Mein Ludwig Wucherer schluchzte bedrohlich, und Philipp Theodor Meckel selbst weinte, es tropfte ihm links etwas Dunkleres vom gelbgrünen Augenlide. Es hatte wohl niemals sonst in der Geschichte dieser Sippe so viele der überaus seltenen Meckel’schen Tränen geregnet.
Was geschah weiter nach jenem so traurigen Märzentag des Jahres 1803? Vaters Gerippe war schließlich gekocht, gut abgeschabt, gereinigt und zusammengesetzt worden, alles von uns. Seine Leber, die von ihrer Größe her durchaus auch einem Titanen wie Prometheus hätte gehören können, war nach ihrer Untersuchung mit den erwarteten traurigen Ergebnissen in einem Glasgefäß in Kloschwitzer Kirschgeist zur belehrenden Anschauung versiegelt. Auch der extra angefertigte Mahagonischrank war pünktlich geliefert worden. Von Vaters Eingeweiden sind außer seiner Leber und seinen Kaldaunen das Herz und die anderen inneren Organe in einen versiegelten Topf aus Zinn getan worden, den ein eingravierter trauernder Jüngling zierte, dessen zu Boden gerichtete Fackel im Erlöschen noch einmal ihren Rauch aufsteigen ließ. Es war dies das Hauptemblem jener Zeit.
Diese sterblichen Überreste des Professors für eine Geburtskunde des Menschen aus dem Grab Gottes ist dann noch in einen Marmortopf getan und in christlich geweihter Erde auf dem Stadtgottesacker zu Halle noch im Monat März des Jahres 1803 im stummen Beisein des Meckel’schen Seelsorgers versenkt worden.
Dies geschah nicht nur Sitte und Anstands, sondern auch des Kirchensprengels wegen, in welchem auch Leute wie wir ungläubigen Meckels am Nachbarschaftsleben und an der Stadtpolitik unseren Teil zu nehmen pflegten. Philipp Theodor Meckel war immerhin ein in der Stadt und ihrem weiten Umkreis zuhöchst beliebter Arzt und Daseinshelfer gewesen.
Sein Sohn Johann Friedrich Meckel der Jüngere war ein paar Jahre später schon weltberühmt. In der Stadt trat er weiter nicht hervor – wenn er überhaupt in den deutschen Landen war. Zuweilen flanierte er aber durch ein paar Straßenzüge um das Riesenhaus herum und grüßte dabei niemanden. Er war auch stets unter einem sehr umfänglichen neapolitanischen Hut aus geschwärztem Fischbein so gut wie verborgen und spielte hinter seinem Rücken mit seiner kleinen schwarzen geflochtenen russischen Peitsche.
Die Kinder nannten ihn bald Meckel Menschenfresser, ihre Eltern zuweilen Onkel Oger.
Meckel zuckte darüber nur die Schultern. »Binärbezeichnungen«, sagte er, »sind wenigstens schon mal ein ganz praktischer Anfang in der menschlichen Zootomie.«
Zumindest einer aber stand von 1803 an unverrückbar hinter ihm in Halle, wenn auch nur als Skelett. Es sprach sich schließlich herum, sogar hin bis zu jenem Ersten Konsul, der sich gerade anschickte, Kaiser zu werden – als auch Meckel in Paris eintraf, um der Erste seines Faches zu werden.