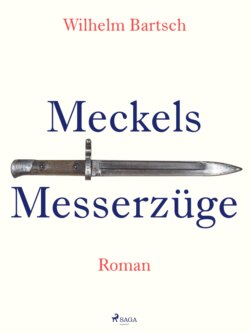Читать книгу Meckels Messerzüge - Wilhelm Bartsch - Страница 6
Wie man 1806 seinen Kaiser abservierte
ОглавлениеWir sahen und hörten im October von 1806 tagelang den preußischen Tross durch Halle rumpeln. Einmal passte er nicht mehr durch das Klaustor und war auch ohnehin unglaublich laut gewesen. Dutzende riesiger Viehwagen, die man alle vollständig umladen musste, hatten sich zu einer Art Straßenzeile vereinigt – vielleicht zwei Stockwerke hoch schrien Zehntausende Truthühner in einer Weise, die selbst ein Atheist als gottserbärmlich bezeichnen würde. Die Vögel hatten in diesem Augenblick wohl mehr eine Ahnung von Politik als ihre Transporteure.
An uns vorbei zwängten sich zudem allerlei lachende und schimpfende Weibchen und Männchen in Tuniken und Togen, um, wie wir erfuhren, zu ihrem weiteren Auftritt in Merseburg noch zurechtzukommen. Wieso sollten Theaterleute wie diese auf zwei Anatomen achten, die an jenem Tag nur zu ihrer minderen Arbeit an einem Hokka-Huhn durchgelassen werden wollten, das sich, wie sein Londoner Absender angemerkt hatte, in seiner Heimat Hinter-Indien nie wieder hat blicken lassen.
Ein strahlend gepanzerter Julius Cäsar von der johlenden Potsdamer Theater-Compagnei wurde letzlich hoch auf einen Thron erhoben und auf vielen Schultern getragen. Schließlich musste Cäsar sich tief durch das Klaustor bücken, um nicht mit seinem Lorbeerkranz oben anzustoßen. »Preußen zieht gar nicht gegen Napoleon«, kommentierte Johann Friedrich Meckel der Jüngere, »es zieht anscheinend um nach Neapel.«
Die Ortsnamen Jena und Auerstedt brauchten noch einige Tage, ehe sie zu jenem Klang verkuppelt wurden, der in seiner Fürchterlichkeit erst durch den Groß Görschener und schließlich noch unfassbarer durch Leipzigs Namen übertroffen werden sollte. Tage zuvor langte noch aus einem Städtchen namens Auma im Geraischen bei uns im Riesenhaus eine Art von Quartierbillet der superiören Classe ein. Oben in der Mitte des Briefbogens war die goldene Biene aufgeprägt, die sich Napoleon als Insignie vom Reichsgründer Chlodwig ausgeliehen hatte. Sein Generalquartiermeister teilte uns Meckeln auf diesem kostbaren Papier mit, dass wir uns über die Ehre freuen mögen, die uns mit der »visite de l’Empereur à vous et à votre collection d’anatomique« ganz gewiss zuteil werden würde.
Überbracht wurde uns das Schreiben von Monsieur Renault, dem französischen Sprachmeister der Universität. Er vermochte dabei das Kunststück, obwohl wir nie zuvor die Ehre miteinander gehabt hatten, bedeutsam und ein wenig verschwörerisch auf uns herabzublicken, obwohl er doch um etliche Zoll oder Centimetres kleiner geraten war als wir. Noch seltsamer war sein Accompagnement hinter seinem Rücken, ein nicht eben hässlicher Kerl mit gar zu chicer Windstoßfrisur und daraus unangemessen hervorstechenden Koteletten. Das war niemand anderes und erstmals auch face à face der Scharlatan Schundius, der ja, wie sich noch nach meines Bruders Meinung herausstellte, nicht einmal in der Bandagenlehre etwas genügend gelernt hatte. Dafür aber beherrschte er 1806 schon meisterlich die französische Sprache.
Dzondi oder Schundius jedenfalls war mit seiner guten politischen Witterung von der Universität Wittenberg hierher nach Halle geeilt, um bald darauf wieder über die gesamte Franzosenzeit dorthin zurückzukehren, dann aber nicht nur als Chirurgien, sondern gleich als Medicin en chef. Wenn sein Geschick mit dem Skalpell nicht so einiges zu wünschen offen gelassen hätte, so hätte er es wenig später fast geschafft haben können, als ein führender Assistent beim Baron Larrey zu arbeiten. Larrey, mein Sohn, war der auf allen Seiten beliebte Generalchirurgus Napoleons, ein Genie, das durch seine hohe Kunst einen neuen Klang nach Paris getragen hatte – das immer mehr anschwellende Toc-toc-toc der Krücken. Durch Larrey und seine Helfer nämlich konnten neuerdings Beinamputationen und sogar -auskultationen gut überstanden werden. Ein sich begeisternder Larrey, nicht so wie sein kaiserlicher Chef, wurde sechs Jahre später herzlich gern von deinem Onkel Fritz in seine Sammlungen vorgelassen.
Schundius alias Dzondi jedenfalls machte gleich, noch ehe wir überhaupt ein Wort miteinander gewechselt hatten, auf seinen Hacken kehrt und enteilte wieder. Meckel musste ihn mit bösen Blicken durchlöchert haben. Es war sofort Verachtung auf den ersten Blick in einer Liaison, die gefühlsecht, treu und unverbrüchlich bis heute geblieben ist.
»Wer war das!«, hatte Meckel aber noch dem ebenfalls abgehenden Sprachmeister Renault hinterhergerufen. »Un ami – peut-être«, so hallte Renaults Stimme im hohen Gewölbe des Riesenhaustores, »mais pas votre collègue, apparemment!«
»Was sagte er?«, fragte ich. Ich konnte damals nur notdürftig Französisch. »Das war einer, der nach befreundeten Eingeweidewürmern gesucht hat«, so Meckel, »und nun sah er, dass wir noch nicht mal als Wirtstiere tauglich sind und das Riesenhaus zwar eine anatomische Sammlung birgt, aber kein Eingeweidewürmer-Cabinet.«
Er hatte es hocherhobenen Hauptes und mit rot überflogenen Wangen gesagt. Ich kannte bereits bei meinem Bruder dieses seltsame Amalgam aus Stolz und Schaam. Zuerst hatte ich es bemerkt, als unser Vater, schon vom Tode gezeichnet, eine überschwängliche Rede auf Fritzens Doktordissertation über Herzmissbildungen hielt, nachdem anscheinend auch nur Gutes aus Göttingen vom Anatomen Wrisberg und vom berühmten vergleichenden Anatomen und Freund der Meckel-Familie Blumenbach zu hören gewesen war über Meckel Juniors gewaltige Talente.
Ein weiteres Mal hatte ich dieses erhobene Haupt und diese Wangenröte meines Bruders bemerkt, als unser Reil, dem Meckel schon nahezu gleichrangig in der Hirnanatomie zuarbeitete, einen regelrechten Freudentanz aufführte, weil Meckel, ganz in der Familientradition hoher Präparierkunst, einen genialen Kniff entdeckt hatte, Gehirne anatomisch zu bearbeiten. Man musste diese nur lange genug in Branntwein oder eben in Meckels unvergleichlichem Kloschwitzer Kirschgeist konservieren, dann schrumpften diese zwar etwas, waren aber nicht mehr die gewöhnlichen stinkenden, gallertartigen Forschungsobjekte. Man konnte die Hirne nun quasi stumpf präparieren, das heißt, man konnte sie einfach brechen. Meckel, nicht Reil, ist somit, ganz nebenbei und ohne dass er Wert darauf legen will, der Erfinder und erste Meister des Hirnbrechens.
Beim dritten Male war es das wohl schönste und bezauberndste Mädchen weit und breit, das jene stolze Röte über Meckels Gesicht hervorgerufen hatte. Das Mädchen war noch schöner, jedenfalls niedlicher als Rafaels Fornarina, an die sie uns gleich erinnerte. Ihre kleinen, etwas zu fleischig und ein wenig zu tief geratenen Ohren unterstrichen noch den Zauber dieser Erscheinung. Es war mit seinem Vater, dem Festungskommandanten von Magdeburg, Oberst von Kleist, auf dem Weg durch Halle überraschend zur Visite bei der von alters her befreundeten Geheimräthin Meckel bei uns im Riesenhaus erschienen, und zwar trotz der regnerischen Kühle draußen sehr luftig und duftig und leicht. Die junge Dame mit dem schlichten elfenbeinernen Kamm im Haar als ihrem einzigen Schmuck schwebte lautlos herein auf dezent wie Schildpatt leuchtenden Kreuzbandschuhen und in einem wehenden aprikosenfarbenen Creppkleid, an dessen Puffen die hübschesten Atlasrosen eingestickt waren. Der Oberst – der an dem Tag noch gar nicht wusste, dass er zum Adjutanten des preußischen Armeenführers, des Herzogs von Braunschweig, gemacht worden war und wenig später schon Kommandant von Halle und Maire von Neuwerk wurde – seufzte und sagte: »Kaum hat sie die eine Krankheit mit doch noch ungebrochenem Herzen überstanden, will sie sich, wie man sehen kann, auch gleich noch die Mousselinkrankheit holen.«
Als sich Meckel zu einem für so ein junges Mädchen noch unüblichen Handkuss über dessen schlanke Finger beugte, sagte es mit einer überraschend rauchigen und erwachsenen Stimme: »Ich bin mir also durch die Ehre Ihres Handkusses sicher, lieber Herr weltberühmter Professor, dass Sie heute noch nicht vom Urin der Toten genippt haben. Übrigens – tun Sie’s oder tun Sie’s nicht?«
Die Röte, die Meckel da überflogen hatte, war vielleicht eher ein Glänzen aus einer bei ihm so nicht gekannten Fröhlichkeit und einem sehr tiefen, wohlwollenden Erkanntsein. »Mein Vater nippte, Demoiselle«, sagte er. »Und daran starb er wohl auch. Ich aber sehe hier einen ausschlaggebenden Grund vor mir, mein Leben zu schonen. Mögen Sie, mit der Erlaubnis Ihres verehrten Herrn Vaters, vielleicht einmal meine Wesen aus der Ewigkeit sehen?«
Die Demoiselle erstrahlte und hielt sich sogleich, wie wir es noch so oft sehen sollten, die Hand vor den Mund, als wenn ihr bewusst sei, dass solch ein strahlendes Lächeln kein Mann überstehen würde. Meckel, nach einem zustimmenden Nicken des Obersten von Kleist, reichte ihr seinen Arm.
»Sie haben doch nicht etwa auch Engel eingeweckt – oder darf man bei Ihnen schöne neue Sorten von Flaschenteufeln bewundern?«
»Nun ja, Demoiselle«, hörte man Meckel noch im Abgang mit der schönsten Beute, die er je gemacht, am Arm, »ich will es mir ja nicht mit Himmel und Hölle gleichzeitig verderben und werde Sie vielleicht enttäuschen – allerdings sind meine Wesen wirklich ewig, denn da sie nie gelebt haben, können sie auch nicht gestorben sein.«
»Aber Sie«, hörten wir Friederike damals noch, »Sie erscheinen mir als ganz schön lebendig – obwohl sie Leichenprofessor sind!«
Friederike, deine Tante, mein lieber Heinrich, zählte damals erst siebzehn Lenze, während ich, dein damals ebenfalls von ihr betörter Vater, auch nur einen Monat älter als sie gewesen bin. Ihre merkwürdige Krankheit übrigens, von der ihr Vater sprach, war eine große Liebe zu einem griechischen Studenten gewesen, die der Oberst aus vielerlei Gründen nicht gestatten wollte, die aber vor allem aus einem anderen Grunde zu Ende gegangen ist. Diesen Studenten habe ich in flagranti, wenn auch aus Versehen, in einer peinlichen Situation mit einem anderen Studenten ertappt. Immerhin fand ich es sehr empörend, dass da ein Mann einen anderen küsste – war dem etwa ein wenig Neid beigemischt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch an der Schwelle des Todes nicht.
Es ist noch etwas zu dem Griechen zu sagen. Er hieß Apostopoulos Arsaky, ist ein weltweit geachteter Biologe vor allem auf dem Gebiet der Fische geworden und Meckels bester Schüler, er hat ihn einmal sogar auf einer längeren Forschungsreise begleitet.
Friederike und der immer noch sehr glänzende Fritz kehrten nach fast schon skandalös langer Zeit aus den Tiefen des Riesenhauses zurück. Ich weiß noch, was sie gerade zu Meckel sagte: »Angst vor Toten habe ich also gar nicht, nur mein feines Näschen mag ihren Geruch nicht besonders.« Und Meckel daraufhin: »Das Näsgen sieht auch hübsch aus mit Wattebäuschlein darin. Außerdem helfen drei Theile Kochsalz, anderthalb Theile Braunstein und darüber gegossen zwei Theile concentrierter Schwefelsäure.«
Ich, mein Sohn, war der Erste, der gewusst hat, was kommen wird. Ich war so eifersüchtig wie nie zuvor und nie wieder. Ich hätte meinen Bruder am liebsten in der von ihm zuletzt genannten Substanz aufgelöst!
Ich fühlte mich Fritz gegenüber nur all zu oft wie angesichts unseres Präparats des ungeheuren Schattenzwillings an der Uteruswand.
Was ist da zu sehen?
Ein scheinbares Zwillingskind, das seinen Widerpart an der Uteruswand erdrückt hat. Es scheint, als habe hier der Normalfall das abweichende Andere regelgerecht plattgemacht – platt wie ein Stück Papier. Dabei ist diese ungeheure Kraftanstrengung von genau diesem selber ausgegangen.
Der papierflache Zwilling mit seinem Schmiereffekt sämtlicher wichtiger Organe an der bereits prallvoll besetzten Uteruswand ist vielleicht nicht ein Zeugnis von der allgemeinen Freundlichkeit des Lebens – aber vor allen Dingen ist er ein Gegenbeweis davon, dass das Leben nichtig sei.
Und dieses Mal? Mitte des Octobers von 1806? Ich hatte gedacht, dass auch einer wie Meckel sich hochgeehrt fühlen und dabei ganz normal erröten müsste, wenn ein Kaiser, und kein österreichischer oder russischer, sondern der Cäsar einer ganzen Epoque derart bei ihm sich ankündigte. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es für Meckel längst nicht entschieden war, wer denn in diesem Falle der eigentliche Cäsar wäre – Gast oder Gastgeber.
Irgendwann zwischen 1804 und 1806, als er in Paris im Jardin des Plantes bei Georges Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire und Lamarck weilte, um sich diesen Größten ihres Faches als gleichrangig zu erweisen, muss dein Onkel Fritz eine Begegnung mit dem dort ein und aus gehenden Wissenschaftsfreund Napoleon gehabt haben. Bis weit nach dem Kriegs-October von 1806 hatte er mir davon nichts gesagt, später deutete er es allenfalls nur an. Irgendetwas war jedenfalls geschehen, sei es in der Wirklichkeit oder in Meckels wirklichkeitsträchtigem und -mächtigem Hirn, das ihn bestimmt hat, selber in einem hierarchischen System der Menschheit der berechtigte Mann dafür zu sein, auf einem Pergament zu schreiben, das von einer erhabenen goldenen Biene geziert wird, jedenfalls mehr als der gewalttätige Ägyptenforscher Bonaparte.
Du wirst gleich erfahren, mein Sohn, wie messerscharf dein Onkel noch am Tag nach der Entgegennahme des kaiserlichen Schreibens darauf reagiert hat, allerdings ganz heimlich. Ich glaube, meinen Bruder halbwegs zu kennen, bei all seinen Geheimnissen. Seine Selbstüberhebung ist einfach nur grandios – und irgendwie berechtigt. Das fängt bei unserem Adelstitel an, den wir alle, außer deinem Onkel, recht gern gebrauchen. Sowie jemand in der Anrede Meckel gegenüber auch nur zu einem »von Hemsbach« ansetzt, wird er verbal scharf geschnitten mit seinem »Ich bin nur Meckel!« Stolzer könnte sich der Kaiser von China nicht darbieten. Doch ist dies auch als ein Gemeinmachen, als Leutseligkeit gedeutet worden. Genau dann erlebt man aber Meckel meist in seiner eisigen Höhe und Abgewandtheit von jeglicher zwischenmenschlicher Stallwärme. Andererseits gibt es wohl niemanden auf dieser Welt, der wie Meckel aus heiterstem Himmel in platonische Dialoge geraten kann, die kein Außenstehender begreift. Es kann ein alter, kranker, nicht eben intelligibler Landstreicher sein wie der, der den vierfüßigen Hahn Dante im Riesenhaus abgegeben hat, der genau in Meckel denjenigen findet, dem etwas anzuvertrauen oder mit dem etwas durchzusprechen ist, das den Anschein hat, zu den wesentlichen Geheimnissen des Lebens zu rechnen. Meckel muss auf eine solche Weise auch dem grandios weltweiten Landstreicher Bonaparte in Paris begegnet sein. Wenn aber dem so gewesen sein könnte, wie hätte der Korse Meckel zu einer Schachfigur auf seinem Machtbrett auch nur denken können, ohne dass dieser nicht schon an einen ganz realen Gegenzug gedacht hätte?
Wer weiß, vielleicht gehörten ja schon die beiden Meckel’schen Steinadler von 1806 dazu. Dein Onkel hatte sie für viel Geld – allein ihre Transportation kostete ein halbes Vermögen – aus dem Berner Oberland kommen lassen. Dort war der Laborbiologe und bei Gelegenheit leidenschaftliche Feldbiologe Meckel im Winter selbigen Jahres auch dem Geheimnis des Winterschlafes der Alpenmurmeltiere um einiges nähergekommen. Zwei Kutschen jedenfalls fuhren im Spätsommer-Frühherbst 1806 in das Riesenhaus ein. In einer kreischte es markerschütternd, in der anderen randalierte der Teufel. Die beiden Kutschen blieben noch drei Tage kreischend und randalierend stehen in unserem düsteren Hof. Dann waren die Käfige links und rechts des Riesenhauses am Fuße der Meckel’schen Riesen fertig.
Am meisten an seinem Hause liebte Meckel Atlas und Hercules, die beiden Steinriesen an seinem Eingang. Ihretwegen heißt unser Riesenhaus Riesenhaus. Von Atlas, der seinen Fuß auf eine Seeschlange setzt, ist in der Odyssee gesagt, dass er »sämtliche Tiefen des Meeres kennt« – ein Motiv, das den Sehnsuchts-Neapolitaner Meckel vielleicht am tiefsten bewegt. Beide Riesen lehnen an jeweils einer ionischen Kolossal-Halbsäule und sollen alle wahren Seefahrer des Geistes zur Einfahrt ins Meckel’sche Reich einladen. Was aber wollte Meckel mit diesen gewaltigen und derart gefangen gesetzten Tieren?
Adler – und zwar preußische – gibt es schon im Metopenfries unseres großartigen Hauses. Sie weisen dort mit jeweils einer Flügelspitze – genauso wie ja gleich nebenan der Hohe Giebel der riesigen Franckeschen Stiftungen vor den dreifachen, verkommenen Stadtmauern Halles – hin zu einem zentralen Lichtmotiv, zur aufstrahlen sollenden Sonne Preußens. Aber Meckel liest es vor allem als ein apollinisches Emblem, als einen Leitgedanken seiner Messerzüge zur Erforschung des Lebens: Jupiter habe das Centro der Welt kennenlernen wollen. Er ließ zwei Adler auffliegen im Osten wie im Westen – und beide Adler treffen sich in Delphi! Delphi: Das waren hier in Halle in Meckels Augen nicht Franckens Stiftungen, sondern es war sein Riesenhaus.
Nun hatte er auch noch ein lebendiges Adlerpaar namens Friedrich und Luise da. Sollte das etwa ein Zeichen setzen gegen den Pariser Pflanzgartenkollegen, den Physiker und Ballistiker Bonaparte? Wie dem auch sei, zwei Steinadler hausten jetzt zu Füßen der Riesen, voller hungriger Wut, wenn unser Anatomiediener Starke einmal am Tag mit seinem Korbe unaussprechlicher Fleischesportionen hervortrat. Dann sprangen sie heiser kreischend hervor und krallten sich mit klatschenden Schwingen in die Gitterstäbe. Meist aber hockten sie als die kaum merklichen und unsauberen Schatten bittersten Heimwehs in ihren Winkeln. Friedrich weißte schon nach mehreren Wochen die Seeschlange des Riesen Atlas vollständig, Luise halbwegs die Keule des Hercules. Meckel, so sagte man bald in den besseren Häusern von Halle, wolle wohl das Drama »Prometheus« mit vertauschten Rollen geben, indem dieser seltsame Zootom nämlich die Thierheit an den Kaukasus seiner Wissenschaft angekettet habe.
Vielleicht muss man es gerade so machen, wenn man gegen London und den weltberühmten Pariser Pflanzgarten antreten will. Immerhin geschieht dies in einer immer schon weltweit wirkenden Stadt, die aber stets auch ihr Licht unter den Scheffel stellt, vermutlich aus Versehen.
Halle ist keltisch und heißt Salz. Saale übrigens auch. Salz war mehr wert als Gold. Auf den grandiosen Schlachtfeldern der Geschichte ringsum liegen außerdem versunken und über Jahrhunderte auch gehoben – und nicht zuletzt als potentielle Kriegsgründe – Kupfer, Kohle, Kali und so weiter. Salziger Grund nun ist geistiger Grund, auch geistlicher: Halle ist – darin seinen berühmten Medizinmännern wie Hoffmann und Stahl und den ersten großen deutschen Aufklärern Wolf und Thomasius ähnlich – ziemlich aufbrausend, ja zuweilen ätzend und sogar hinwegfegend veranlagt und zuweilen heroisch wie eine Tirade von Luther oder ein Chor des Londoner Hallensers Händel. Halle ist, zumindest für Deutsche, spürbar ein Freiheitsort, es lebt alle Kantischen Aporien ohne Aufgeregtheit, es ist zutiefst gläubig und zugleich atheistisch. Wo gibt es schon eine Stadt in den deutschen Landen, in der zuerst das Licht der Aufklärung auf Dauer durch alle Wechselfälle hindurch entzündet wurde, während zugleich erstmals auf der Welt der Gleichschritt marschierender Soldaten in Coschwitzens Anatomietheater und in der gegenüberliegenden Moritzburg zu hören gewesen war.
Vom Großen Berlin nun, wo wir Meckels residieren, wissen die Hallenser allerdings selber nicht zu sagen, ob er eine sehr breite Straße oder eher ein schmaler Platz sei. Der Große Berlin, zumal mit dem Riesenhause deines Onkels Fritz, ist, wie du weißt, durchgehend auf das Zierlichste gepflastert. Die sauberen Häuserfronten stehen lotrecht und wie mit dem Lineal gezogen da. Nur das Riesenhaus kragt und ragt hervor wie ein General.
»Das Riesenhaus ist ein steinernes Buch«, pflegte der Theologe Schleiermacher aus der Großen Märkerstraße zu dozieren, der auf die Schauseite des Riesenhauses sehen konnte, wenn er zum Beispiel mit neuen Studenten sich aus seinem Fenster nach rechts beugte. »Das Riesenhaus verkörpert eine gänzliche protomasonische Pansophie, durch die man führen könnte«, soll Schleiermacher in seiner Art mit den begeisterten Seufzern gesagt haben, »wenn man nur hineinkäme!«
Der hervorragende Stadtklatsch von Halle wusste, dass Schleiermacher nur noch darauf warte, dass der so unendlich verdienstvolle, aber genauso unheimliche Meckel damit begönne, nicht nur seinen hinteren Laboratoriumsturm zu beflaggen mit Mägen, Därmen und Häuten, sondern auch noch aus dem präsentierenden Mittelrisalit des Riesenhauses seine Trockenpräparate, wild gemischt aus Mensch und Tier, heraushängen lasse.
Meckel jedenfalls liebt sein Riesenhaus. Man konnte und kann ihn zuweilen dabei beobachten, wie er es im Ganzen und in entlegenen Einzelheiten studiert. Meckel liest es. Er hängt am Riesenhaus, so wie nur noch an dem im Gegenteil so unvollendeten und unvollendbaren Palazzo Donn’Anna in Neapel.
Er hat im Riesenhaus sein Nacktschnecken- und Kopffüßer-Cabinet ganz zauberhaft einrichten lassen. Über dem Kamin ist folgender masonischer Spruch zu lesen: »Im milden Licht des Mondes / umhuellet vom stillen Mantel der Nacht / erwachen die verborgenen Wirklichkeiten / des menschlichen Wesens«.
Meckel, wie viele gut zeichnen könnende Anatomen, ist im innersten Herzen ein Künstler, zumindest ein Kunstsammler. Er liebt die Italiener, davon die neapolitanischen und da besonders den Salvatore Rosa. Manche Wand des Riesenhauses ist allein ihnen zugedacht. Aber den Ehrenplatz, nämlich in Meckels Arbeitsraum mit dem Skelett unseres Vaters, hat die einzigartige Sepia des Nithart-Gothart. Sie ist in fast anbetungsgemäßer Höhe aufgehängt. Es ist die fahle Sepia-Zeichnung des Tricephalus, jenes dreigesichtigen Männerkopfes, welche sich Meckel als eine auch jetzt noch gültige Leihgabe der Würzburger Universität zu verschaffen gewusst hat. Gleich neben dieser ehrwürdigen Zeichnung hängt neuerdings wie ein dilettantisches Gekrakel und Gekleckse ein hingetuschter Schrecken, eine aus dem Handgelenk quasi weggeschüttelte Skizze von Meeresfrüchten, in Panik auf uns zu gleitende Wesen, die, ihrem Element entrissen, sich mit scharf bewaffneten Mäulern an uns zu rächen beabsichtigen. Man glaubt gar nicht, dass dergleichen Schrecken nicht von Delacroix, sondern von unserem Maître Ingres stammen.
Aber die Hauptattraktion des Riesenhauses war und ist natürlich die Meckel’sche Sammlung. Schon im Jahre 1804 hatte der Kliniker Friedrich Gotthelf Voigtei nur für sein Fachgebiet sich gefreut, dass die Meckel’sche Sammlung »eine reiche Erndte für die pathologische Anatomie versprechen« würde. Diese Ernte fuhr dann Meckel in den folgenden Jahren vor allem erst einmal selber ein mit seinem mehrbändigen und Schule machenden »Handbuch der pathologischen Anatomie«. Inzwischen dürfte Meckels pathologische, vergleichendanatomische und teratologische Sammlung etwa sechzehntausend Gegenstände von höchster und teilweise von einmaliger Qualität umfassen. Gezeigt werden davon in des Wohngebäudes drittem Stock in sieben tapezierten Stuben und in einem Vorsaal osteologische und siebenhundert vollständige Thierskelette und siebenundsechzig Säugethierköpfe. Im rechten Flügel des Hinterhauses kann der gewöhnliche Besucher etwa tausendfünfhundert Feuchtpräparate in zwei langen Sälen und in zwei Stuben betrachten. Dazu befinden sich dort mehr als sechshundert größere, mittlere und kleine Gläser und Töpfe sowie zahlreiche Fässer, Eimer und Tonnen mit ganzen Thieren und Eingeweiden. Ein großer Teil davon ist mit dem anatomischen Messer gar nicht oder nur wenig berührt worden.
Hauptattraktionen für Besucher aus aller Welt sind natürlich jene Zyklopen, Sirenen, Janusköpfe, Kopflose und in ihren Nabelschnüren strangulierte Föten, wie sie sich keine Monstrenwerkstatt von Neapel je ausdenken könnte. Aber ein Monstrencabinet ist das hier nicht. Meckels Cabinet besteht vielmehr aus lauter sich gegenseitig verdeutlichenden Sichtfenstern in die Gesetze und Daseinsweisen des Lebens. Somit ist es auch kein Friedhof. Deshalb müsste über der Eingangstür dieser Sammlung stehen: mors porta vitae – Der Tod ist die Pforte zum Leben.
Das nicht zu leugnende Unheimliche aber, das von solchen Sammlungen ausgeht, liegt in etwas anderem. Derartige Föten sind schon von einer Wesensart, wie sie Meckel Friederike gegenüber im ersten Stadium ihrer wachsenden Liebe noch charmös beschrieben hat: Wesen der Ewigkeit, einer negativen Ewigkeit quasi, nämlich Leichen, aber von einer ungeheuerlichen Art. Es sind Leichen in Gläsern und in filigransten Mensuren, die nie geboren und die nie gestorben sind.
Der oberste Kriegsgott Europas hatte sich also hierher zu Gast geladen. Meckel hasste den Krieg, weil der nicht sorgsam mit Gläsern und Mensuren umzugehen pflegte. »Ich bin nur ein Fabriquebesitzer«, sagte Meckel, »da ich eine fabrica aliena in Konkurrenz zu denen in London und in Paris aufgebaut habe. Aber ich will meine Konkurrenten nicht zerstören. Ich will sie nur in der Qualität und auch im Umfange meiner Waaren übertreffen.«
Dann kamen die Tage, wo kaum mehr etwas, das zum preußischen Tross gehören konnte, das Klaustor Richtung Süden passierte. Nun war ein Andrang nach Norden, nach Berlin, nach Magdeburg, und nach Westen, nach Braunschweig, nach Hamburg entstanden. Die meisten Gefährte langten von Leipzig zur Weiterfahrt ein. Man sah etwa eine englische, ganz fashionable, aber schlecht geschlossene Equipage mit sechs Pagen darauf gepfercht; in der dieser folgenden soll die nachmalige Gattin des Königlich-Westphälischen Oberhofmeisters, Frau von Waldburg-Capustigall, mit ihren beiden Wachtelhündchen Blanchette und Mimi gefahren sein. Man sah allerlei Rumpelwagen, überdachte Landauer, hochrädrige, ungefederte Kaleschen mit Einschnallstühlen, nur hinten gefederte Chaisen mit Leinwandverdeck, abstrapazierte Ungetüme älterer Modelle, alle mit schwankenden Schachteln bepackt. Pakete hingen an den Seiten, sogar offene Anzüge, Uniformen – und in seinem eigenen Kabriolett verließ der Universitätstanzmeister Schallenwein die Stadt, angeblich um zu Hamburg an einem wichtigen Treffen verschiedenster Ballett- und Tanzmeister teilzunehmen. Alle abgehenden und durchfahrenden Diligencen waren hoffnungslos überfüllt.
Lediglich die dottergelben Leberecht’sehen Kutschen zwischen Halle und Leipzig verkehrten wie immer pünktlich. Nur während der Eroberung von Halle soll eine davon ausgefallen sein.
Henrik Steffens, Professor der Naturgeschichte und Mineralkunde in Halle, war gegen Mittag des 14. October aus dem Klaustor geritten, gut fünf preußische Meilen bis nach Delitz am Berge im Königreich Sachsen, und hatte, das Ohr am Boden, am heiligen römischen Erdreich deutscher Nation gehorcht. Er hatte als Norweger und preußischer Major in spe beschlossen, etwas zu tun. Es bebte. Die deutschen Kauplatten knirschten und zerrieben alle noch verbliebenen Zahnstummel.
Ich traf Steffens so an, weil mich Meckel ebenfalls hierher nach Delitz am Berge geschickt hatte, um die Erde abzuhorchen. Wir hatten in unserem Laboratoriumsturm an einem Crocodil gearbeitet und auch einige Integumente zum Trocknen aus den Turmfenstern gehängt. »Diese Objekte können eigentlich in ihrem wesentlichen Wert gar nicht beschädigt werden, falls Kugeln hindurchgehen sollten«, hatte Meckel gesagt.
»Er soll ja auch Doktor der Ballistik sein«, plapperte ich. »Aber wie das schon klingen würde: Doktor Napoleon, Kaiser der Franzosen! Ein Doktor Napoleon hätte in Austerlitz niemals gewonnen.«
Da hatte mir Meckel mit zugleich wütenden und belustigten Seitenblicken den Befehl zum Ausritt nach Delitz am Berge erteilt.
»Die Meckelen träumen in der Gegend herum und lachen sich auch noch eins!«, rief da der stadtbekannte Henrik Steffens, der norwegische Naturkundeprofessor in Halle. »Aber ihr Meckelen solltet am besten nachher schon den Kaiser-Thee und eine ernstere Miene als du aufsetzen. Wird denn auch das weltberüchtigte Geripp im Empfangs-Comite antreten?« Der an sich eher wortkarge Steffens hatte es in Halle zum Oberhaupt der Beredsamen und zum Universitätsfechtmeister mit mehr oder weniger deutschen Worten gebracht.
»Die Toten gehen nirgendwo mehr hin«, sagte ich bloß. »Sie blicken so grundanständig unter Ihrem Pferdebauch hervor, Herr Professor Steffens, Sie führen heute bestimmt nichts Gutes im Schilde?«
»Wie sollte ich das auch an so einem Tag!« Professor Steffens sah glühend auf zu mir. »Noch haben wir Zeit bekommen für solche tête-à-têtes!«, formulierte er mit einem Brustgrollen norwegischer Herkunft. »Eure Patrioten sterben aber wohl gerade aus. Aber gab es eigentlich überhaupt welche bei euch? Wieso sind denn nur wir beide jetzt hier am Berge zu Delitz?«
»Ich bin vielleicht gar nicht hier. Meckel wollte, dass ich mal die Hölle abhorche.«
»Man muss sie nicht mehr abhorchen«, sagte Steffens. »Man hört sie jetzt auch so schon deutlich genug bis nach Halle. Vielleicht kann Meckel den Studiosus Meckel gerade nicht gebrauchen? Will er dann vielleicht ein Patriot werden und das Deutschland retten?«
»Und wer schickte eigentlich den ebenfalls überflüssigen Professor Steffens hierher?«
»Irgendwann, hoffentlich bald«, tremolierte Steffens aufrichtig, »werden wir beide uns in die erste Liste von Deutschlands Befreiern und Gründern eintragen!«
»Ist dieses denn besetzt?«, frug ich den Norweger. »Und wie wäre es überhaupt zuerst mit Unterschriften zur Befreiung Norwegens von Schweden?«
»Eure unerträglich rolfinckenden Scherze!«, rief Steffens wiederholt auf dem verregneten Rückzug von Delitz am Berge. »Ich gehe wohl schnurstracks nach der Aufwiegelung der Studentenschaft Halles ab nach Breslau! Denn ich lehre keinesfalls unter dem Kaiser Cuviers!«
»Nur zu!«, rief ich auf der Klausbrücke. »Übrigens, Herr Professor – wo liegt es denn, das Deutschland?«
»Das wird sich finden!«, orakelte der glutvolle Steffens. »Jedenfalls liegt es nicht in Frankreich.«
»Und?«, rief Meckel von der Galerie.
»Ja«, rief ich zurück, »Preußen wird gerade aufgefressen. Ein verdammt saftloser Braten! Du kannst für deinen Herrn Bonaparte schon mal eindecken lassen!«
»Albrecht«, sagte da Meckel, »ich zeig dem Schwein meine Sammlung nicht – schon gar nicht zeig ich dem unsern armen Vater! Ich hab alles verschlossen und versiegelt, ich nehme die gelbe Leberecht’sche Kutsche nach Leipzig zum Kollegen Rosenmüller. Komm her!«
Ich sah in die ruhigsten und lavendelblausten Augen der Welt. »Deshalb musste ich also nach Delitz am Berge? Dass ich dir nicht im Wege stehe bei deinen Vorbereitungen zur Flucht?«
»Ihr müsst noch den Saju abbalgen«, sagte Meckel, »und das Wasserschwein sofort matzerieren, eh es am Ende, wie es grad heftig tut, noch derartig fault, dass seine Knochensubstanz Schaden nimmt.«
»Es ist Krieg, Herr Bruder«, sagte ich.
»Es ist auch sonst immer was los«, sagte Meckel. »Nur die Kadavres wissen nichts davon. Sie müssen aber rechtzeitig durchsucht und bearbeitet werden.«
»Es ist Krieg – mon frère Frederic!«, sagte ich ein wenig zu pathetisch.
»So?«, sagte Meckel. »Und wir gewinnen eine Schlacht der Wissenschaft nach der andren. Wie findest du das?«
»Großartig«, sagte ich, »Professor Steffens hat mich allerdings auch schon für Ruhm und Ehre rekrutiert.«
»Der schon wieder! Nichts unter der Hand, aber umso mehr davon reden! Glaubst du etwa, ich flüchte? Und dann auch noch zu Rosenmüller?«, fragte Meckel.
»Zu Rosenmüller«, sagte ich, »das ist ja eher ein Angriff von dir auf Leipzig! Wie wäre es aber stattdessen mit Standhaftigkeit gegen Napoleon?«
»Standhaft!«, rief Meckel. »Ich hab keine Zeit zum Herumstehen. Sei du standhaft! Aber vergiss dabei das Crocodil und das Wasserschwein nicht!«
»Zu Befehl«, sagte ich, auf einmal den Tränen näher, als ich geglaubt hätte. »Du lässt mich also allein, mon General?«
»Ja«, sagte Meckel. »Na und?«
»Aber ich bin erst siebzehn!«, rief ich und biss mich vor Wut auf die Unterlippe.
»Was«, sagte Meckel ganz verwundert, »schon siebzehn und immer noch nicht Doktor? Aber wenigstens ist er jetzt schon höher gewachsen als ich!«
Ich rang nach Atem. Ich wollte, dass mich Meckel, dieses eine Mal nur, umarmte! Es war doch Krieg, verdammt! Und mein großer Bruder ließ mich im Stich und eilte schlüsselbundklappernd durch das Riesenhaus.
»Befreie den Affen und behüte ihn!«, rief er. »Schließ immer wieder ab! Und dass du mir dieses Schlüsselbund hier gut versteckst!«
Ich eilte auf meinen Bruder zu, vergeblich.
Meckels Stimme dröhnte noch im Torweg: »Wehe euch, ihr zeigt dem Schwein meine Sammlung!«
Als er verschwunden war, zündete ich die Argant-Lampe auf dem Tischchen an und richtete ihren Lichtkegel auf den Dokumentenschrank hier im Vorraum. Meckel hatte die Lade der Fensterlinse über der Tür vorlegen lassen, durch welche sich noch nicht einmal der Hofzwerg von einem althergebrachten Kaiser hätte zwängen können.
Ich folgte dem Lichtstrahl geradewegs zu dem Fach, in dem sich der Katalog für die Besucher und das Gastbuch befanden. Ich schlug es auf, Großvaters kostbares kleines Federmesser fiel heraus. Nun überrieselte mich wirklich ein erster Vorschauer des Krieges.
»Vive Le Prusse! Pereat – empereur! Meckel.«
Meckel schrieb sonst, wenn er Zeit dazu hatte, in gestochener, aber sehr kleiner Schrift. Hier war sie ihm fast kindlich geraten bei der Mühe, möglichst groß zu schreiben. Jedes Wort begann mit Versalien, die lateinische Verfluchung sogar durchgehend, als sollte dies Pereat noch in Stein gemeißelt werden. Nur der empereur, der Kaiser, den man auf alle Fälle groß schreibt, der steht auf einmal auch in Meckels Schriftzügen klein da.
Ich stieß mit dem Fuß gegen das Federmesser, hob es auf, setzte zum Schnitt an im Gästebuch, zögerte – und musste auf einmal ganz unbändig und laut über Meckel lachen. Ich ließ Großvaters Federmesser in meine Brusttasche gleiten.
Ich hatte die Saaltüre aufgeschlossen. Aber da waren kein Reil, kein Fritz, kein Ferdel, kein Ludwig, keine weinende Meckelin mehr. Nur der matte braune Vater in seinem neuen Gehäuse war jetzt sehr aufrecht am gegenüberliegenden Ende des Saales zu ahnen.
Groß schien Vaters Grinsen darüber, wie dicht er um sich die Seinen zu sammeln vermocht hatte. Überall sind sie im Dämmerschein, im Funkel- und Schattenspiel der von mir getragenen Argant-Lampe, sie wirken – und sind auch – kostbarer als Gold und Elfenbein, Silber, Seide und Brokat.
Das Skelettlein gleich links vorne in der Reihe zuckte zusammen. Dies einzige Kuriosum der Sammlung – und zwar noch aus der Zauberhand des Präparators Frederick Ruysch! – ringt seine Händchen zum Himmel auf seiner dürren kleinen Insel aus Pantoffelholz, das quasi von der Küste eines bleichen, aber kostbar mit Perlen schäumenden Strumpfbandes umbrandet wird.
Einen Augenblick später fiel weiter vorn bei den Hautpräparaten etwas klackernd zu Boden. Ich sah eine der Glasblasen hervorkullern, wie sie zur Aufhängung von kleineren Feuchtpräparaten in den gläsernen Gefäßen verwendet werden. Ich sah auf zu jenem Piedestal mit dem Kopf eines Schreckgespenstes, welches sich dem medizinisch weniger geübten Besucher dieser Sammlung jedesmal als ein duftiges Gebilde größter Schönheit herausstellt – nämlich das höchstberühmte Korrosionspräparat der Gesichtsspannadern des älteren Meckel.
Es waren hier Stücke versammelt, die man in der Walther’schen Sammlung zu Berlin schmerzlich vermisste, darunter der Situs inversus von Johann Friedrich Meckel d.Ä., ein graziler Rumpf mit seitenverkehrten Organen. Oder die verschiednen Beispiele der Combination von Mehrfingrigkeit, Gaumenspalte, Wolfsrachen und hinterem Gehirnbruch. Sähe man in diese Art Wesen hinein, entdeckte man immer auch, so fand es Meckel heraus, Nierenvergrößerungen und Zystenbildungen.
Das Prachtstück der Sammlung war aber eine Doppelmonstrosität, von der Meckel sagte, sie sei sein Doppel-David des Michelangelo, nur nicht in Marmor, sondern viel komplizierter, nämlich in Fleisch.
Am Tag, als ich ausgeritten war und zusammen mit dem Professor Steffens die deutsche Erde abhorchte, begann ganz Halle, in gestikulierenden Grüppchen umherzugehen oder in banger Erwartung herumzusitzen. Die Einschläge kamen immer dichter. Ich musste bemerken, dass eine der französischen Passkugeln – zunächst recochettiert, indem sie auf die Torbastei vor dem Schmohl’schen Garten geschlagen und im spitzesten Winkel hohen Bogens zurückgesprungen war – zwei der vorm Turmfenster ausgehängten Trockenpräparate hinwegnahm.
Meckels Gast begann sich zu nähern. Wie würde er es hinnehmen, dass weder sein Gastgeber ihn freudig empfangen würde noch dass er eine weltberühmte Attraktion zu sehen bekäme? Vielleicht schoss er das Riesenhaus zusammen. Wenn nicht, konnte er die Sammlung auch einfach konfiszieren.
Dann prasselten von Westen und Süden die Gewehrschüsse heran mit seltsam sich verschlingenden und verirrenden Echos in den Straßen. Die Nord- und Ostseite der Stadt vergrollte ängstlich mit Rädern. Die Reste der stolzen preußischen Armeereserven setzten sich ab. Seltsamerweise war kein Menschenlaut zu vernehmen, kein Siegesgebrüll, kein Schrei eines Getroffenen. Es war nahezu totenstill geworden – unterstrichen von ganz vereinzelten Schüssen –, als die Reiter zu hören waren. Sie drangen in die Stadt.
Innerhalb der gewaltigen, wenn auch morschen Stadtmauern klang es, als sollte das uralte Halle unter Steinlawinen begraben werden. So jedenfalls vernahm es das sich ängstigende Ohr. Es vernahm jetzt auch vereinzeltes Geschrei und das Splittern von Glas und Holz. Das war die beutehungrige »Schwefelbande« des Marschalls Bernadotte mit ihren großen blanken Löffeln am Hut, die nur wenig Zeit zum Marodieren und Plündern mitgebracht hatte. Sie bildete im October 1806 die Avant-Garde der kaiserlichen Armee auf dem Weg nach Berlin.
Kurz darauf kamen sie, zunächst die Einquartierungsabteilung, dann die Mamelucken, die sich in der Toreinfahrt vor den Riesen und Adlern postierten. Dann erblickte man von unserem Haus über den Großen Berlin und durch die Große Märkerstraße bis auf den Marktplatz links und rechts und Mann an Mann die berühmte Alte Garde mit ihren abenteuerlichen Bärten und Bärenfellmützen. Sie bildete die Gasse, durch die ER kommen musste.
Man hörte ein einzelnes Pferd im scharfen Galopp herannahen, und schließlich sah man den schwarzen Zelter mit goldenem Hauptschmuck und lichtblauer Schabracke und auf ihm eine Gestalt wie aus einem maßlosen Märchen, mit Federbüschen, goldenem Schwert, in blutroten Pantalons und in gelben Stiefeln, mit dem wallenden lockigen Haar über dem Kragen eines azurfarbenen Pikeschenrockes und so weiter und so fort. Das war meine erste Begegnung mit dem genäschigen Sohn einer südfranzösischen Gastwirtin, die ihm schon seit dem Ägyptenfeldzug einen Topf Traubenmus nach dem andern bis direkt auf die Schlachtfelder nachzuschicken pflegte. Das war der sagenumwobene Reitergeneral Joachim Murat, der nachmalige Schwager Napoleons und König von Neapel. Merke hier auf, Heinrich, denn dieser teils liebenswerte, teils furchtbare Irrwisch zwischen Lächerlich und Erhaben sollte später noch das Schicksal von uns Meckeln vielleicht tiefer beeinflussen, als wir jemals herausfinden können. Das also war der Mann, der sich willenlos wie ein Kind im Schoße seiner hintergründigen Karoline auszuweinen pflegte und der zugleich, wie die Kaiserin Josephine dann einmal sagte, auf eine Meile nach Kanonenpulver rieche und imstande sei, den Herrn im Himmel niederzusäbeln.
Achim Murat hielt vorm Riesenhaus und beugte sich vom Pferd herab zu den Mamelucken. Da bemerkte ich, dass es Napoleons getreuer Mameluck Roustam war, dem Murat etwas ins Ohr flüsterte und sogleich scharf nach rechts wieder davonsprengte.
Napoleon aber ließ sich Zeit. Mir war, als hörte ich mitten im Hurra der Alten Garde am Markt zugleich ein mehrstimmiges, wütendes »Pereat!« gegen Napoleon. Der Rest ist bekannt und führte zur Schließung der bedeutendsten Arbeits-Universität der deutschen Lande. Es ging auch das Gerücht von einem missglückten studentischen Gewehranschlag auf den Kaiser. Sieben Jahre später dann, im wieder preußischen Halle, konnte man deinen Onkel diebisch grienen sehen, wenn die Sprache darauf kam. Aber wenn man die Vermutung äußerte, was er davon wisse, antwortete er eigenartig, dass er doch »kein Desperado« sei. Nun – der Desperado in dieser Familie bin ja wohl ich ...
Napoleon kam auf einem unscheinbaren braunen Pferd. Er war selber unscheinbar – für den ersten Moment. Und er war wütend. Er eilte seinem Roustam nach in unser Haus und beachtete uns zuerst gar nicht.
Dann sprach er nicht gerade leise und höflich mit unsrer Hofräthin Meckel, die nicht ein bisschen stolz darauf zu sein schien, einem Kaiser das Diner richten zu können. Aber immerhin hatte sie für die zweitägige Anwesenheit solcher Gäste das Tafelgeschirr aus Sankt Petersburg aufgesetzt, alles Zarensilber.
Napoleons fernere militärische Bedienstete allerdings brachten zwei Tage später bei seiner und ihrer Abreise feinlederne Säcke mit sich. Darin verschwanden die russischen Schätze, ganz schaamlos offen und unabgewaschen außerdem. So hat es einer der vielen sonstigen Gäste unseres Hauses, Ernst Moritz Arndt, in seiner Königsberger Schrift »Die Glocke der Stunde« von 1813 berichtet, deinem Lieblingsstück, mein lieber Heinrich, das ich dir schon so oft vorlesen musste, weil deine Großmutter so gut darin wegkommt. Wie endet jene Szene bei Arndt? »Ein solcher will Kaiser heißen.« Übrigens, was das Zarensilber betrifft: Die Geheimräthin Meckel klagte gegen Frankreich – und gewann, Monate später. Das Silber kehrte heim – allerdings ohne die sieben vielarmigen Leuchter ...
Stunden nach seiner Ankunft und einem Inspektionsritt durch Halle hatte mich Napoleon vorgelassen. Ich war auf alles vorbereitet. Ich war sogar bereit, für meinen Bruder zu sterben ... Napoleon stand am Erkerfenster und schaute auf den Großen Berlin hinüber. Er hatte sich beruhigt, ja er schien sogar guter Dinge zu sein, denn ein Papier nach dem andern mit anscheinend nur guten Nachrichten gelangte in seine Hände. Immer öfter lächelte der Kaiser.
Es war kein gewinnendes, sondern ein seltsam bedrückendes Lächeln. Ich sah, dass Napoleon im Grunde nur einen einzigen Lachzug benutzte, den Musculus risorius im linken Mundwinkel. Normale Menschen müssten lange üben, um dergleichen in einem ansonsten starren Gesicht auszulösen.
Ich hatte schließlich dem Kaiser noch einmal durch einen Dolmetsch zu bestätigen, dass Meckel dringlichst verreist und deshalb seine Sammlung geschlossen sei.
Napoleon sagte nichts und kniff nachdenklich sein Kinngrübchen. Er blickte mich starr an, oder vielmehr durch mich hindurch. Scheinbar war er in Gedanken wieder an ganz andrer Stelle, aber nur scheinbar.
Vielleicht in diesem Augenblick schon war in den zehntausend Seitenfalten und -taschen dieses Gedächtnis-Elephanten ein Entschluss gefasst worden, der das Leben von uns Meckels entscheidend zu prägen die Macht hatte. Dann wendete sich Napoleon wieder brüsk dem Erkerfenster zu und klopfte mit einer gerollten Depesche auf die Finger seiner Linken in seinem Rücken.
Ich überlegte schon, ob ich mich entfernen solle, als der Kaiser mich quasi mit seinem kleinen Finger heranwinkte, ohne sich mir auch nur halbwegs zuzuwenden dabei. Dann wies Bonaparte mit dem Mittelfinger hinaus auf den Großen Berlin, der von französischem Militär nur so wimmelte, darunter zum allgemeinen Spaß die alljährlich in Halle gastierenden englischen Bereiter.
Vor allem die Kinder liebten diese Seiltänzer- und Schabernacktruppe, die mindestens einmal im Jahr in die Stadt kam. Aber nicht auf diese wies der kaiserliche Mittelfinger, sondern hin zum Norzel’schen Haus. Ich setzte an zu einer Erklärung, doch der Imperator machte bloß »pschschsch«. Denn gerade rannte dort unten Norzels gigantischer Ziegenbock Martinus in den zugespitzten Eisenfuß des »Adlers«, der stolzen Fahne des ersten Regimentes zu Fuß von Napoleons Alter Garde. Und alle applaudierten dem Torero, dem bärtigen Adlerträger – Franzosen, Engländer, die meisten Deutschen.