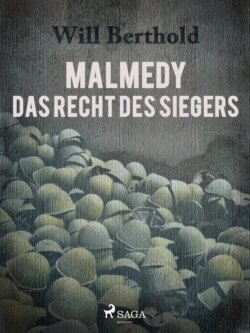Читать книгу Malmedy - Das Recht des Siegers - Will Berthold - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. kapitel
ОглавлениеDer alte Ford fährt auf die Einfahrt des Untersuchungsgefängnisses Dachau zu. Die Insassen reden nicht viel miteinander. Vorne, neben dem langen, schlaksigen Leutnant Tebster, sitzt Vera Eckstadt, hinter ihm Leutnant Morris und daneben Brigitte, die sich mit Vorwürfen quält, daß sie den Mann, den sie liebt, für einen Mörder hielt.
Morris hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um eine Sprecherlaubnis zu erwirken. Rigoros schob er Colonel Evans vor, spielte dessen Dienstgrad aus, drohte, versprach, befahl, schrie, bat … bis er fast ein Wunder erreichte: man gab die Erlaubnis, Werner Eckstadt zu besuchen. Zum ersten Mal durften Angehörige das Untersuchungsgefängnis betreten.
Aber was geschieht, wenn der Oberst davon erfährt? denkt Leutnant Morris. Der Colonel versteht in diesen Dingen keinen Spaß. Aber Morris hat es Vera versprochen, und er hält es. Vera, die der Begegnung entgegenfiebert und in diesen Tagen schmal und blaß geworden ist.
Tebster ist aus anderem Holz. Er grinst vergnügt vor sich hin. Ihm macht die Sache Spaß. Beinahe soviel wie die Aktengeschichte. Brigitte nestelt an ihren langen, dunklen Haaren.
„Wir sind da“, sagt Tebster.
Morris zeigt die Ausweise vor.
Langsam rollt der Wagen in den Innenhof. Es ist später Nachmittag. Die Sonne hat sich hinter Wolken versteckt. Vier, fünf Posten schießen auf den Ford zu, polnisches Wachpersonal in amerikanischen Uniformen, die man dunkel färbte.
Die Sprecherlaubnis wird wieder und wieder kontrolliert.
In diesem Augenblick geschieht gerade das, was Leutnant Morris am meisten fürchtete. Er prallt unter der Türe mit seinem Chef zusammen. Mit Colonel Evans. Der Oberst hat ihn sofort gesehen.
„Was ist hier los?“ fährt er ihn an.
Aus, vorbei, denkt der Leutnant, danebengegangen. Und er redet schnell, unbesonnen und vollkommen unmilitärisch auf den Colonel ein. Er spricht von Vera und deutet auf sie. Er berichtet den Aktendiebstahl, von dem der Colonel noch gar nichts weiß. Er stellt Leutnant Tebster vor, während die beiden Mädchen ängstlich im Hintergrund bleiben … und er weiß, daß das alles sinnlos ist. Daß ihn der Oberst hinauswerfen wird. Zuerst aus dem Gefängnis und dann aus seiner Dienststelle.
Evans hört seinen Assistenten an, ohne ihn ein einziges Mal zu unterbrechen. Dann reagiert er ganz seltsam: er läßt Morris stehen und geht auf Vera zu, die ihn schon einmal in seiner Dienststelle besuchte. Er gibt ihr die Hand.
„Sie sind ein schönes Mädchen“, sagt er, „und Ihr Bruder ist ein tapferer Bursche … Ich habe seinen Fall übernommen.“
Ohne sich um die anderen zu kümmern, steigt der Colonel in seinen Wagen und fährt davon.
Morris starrt ihm nach, schüttelt den Kopf, boxt Tebster in die Seite.
„Träume ich?“ fragt er ihn.
Der Captain des Wachpersonals kommt zurück.
„Alles O.K.“, sagt er, „Sie können den Gefangenen sprechen.“
Man führt die vier in einen Vernehmungsraum. Ein Posten bleibt vor der Türe stehen.
Brigitte starrt auf die Türe. Ihre hellen Augen glänzen. Vera zerknüllt ein Taschentuch zwischen den Fingern. Tebster bearbeitet mit seinen weißen Zähnen einen Kaugummi. Morris läuft wie ein gefangenes Tier hin und her. Keiner spricht. Es ist still. Totenstill. Und es dauert lange. Viel zu lange. Man hört Kommandos auf den Gängen. Man hört den gedämpften Schritt der Gummistiefel. Irgendwo plärrt ein Radio. Der Posten vor der Türe erzählt einem Kameraden das Liebesabenteuer der vergangenen Nacht. Jedes Wort ist zu verstehen.
Tebster sieht auf die Uhr, spuckt seinen Kaugummi aus, schiebt den nächsten in den Mund.
Da, endlich geht die Türe auf …
Werner Eckstadt sah nicht auf, als die rostige Zellentüre in den Angeln knarrte. Er saß auf seiner Pritsche und starrte auf den schmutzigen Fußboden. Er hörte nicht, was die Zelleninsassen sagten. Er sah auch nicht die langbeinigen häßlichen Spinnen, die an der Wand hochkrabbelten. Hinter seinen leeren Augen schaukelten die Gedanken, ungut und unfroh, drehten sich blitzschnell im Kreise und endeten wieder an der gleichen Stelle, die nur 200 Meter vom Gefängnis entfernt war: sie endeten unter dem Galgen, den gerade deutsche Arbeiter aufstellten.
„Du mitkommen“, sagte der polnische Wachposten und stieß Werner an.
Mechanisch stand Eckstadt auf und ging mit steifen Beinen neben dem Posten her. Er wußte noch nicht, welche Überraschung ihm bevorstand. Man sagte den Häftlingen nie, ob es zum Galgen ging oder nur in die Sprechzelle … die Gefangenen würden schon rechtzeitig merken, wohin der Weg führte …
Der Posten verließ mit ihm den Block. Er lief rasch, und Werner blieb einen halben Schritt zurück. Der Pole drehte sich um und schrie:
„Mach schnell, mach schnell!“
Vor dem Gebäude übergab er Werner einem amerikanischen Sergeanten, den er noch nie gesehen hatte. Der blasse Gefangene atmete frische Luft, aber er spürte sie nicht. Er hatte den Kopf gesenkt. Die grauen Schlacken, der Bodenbelag von Dachau, knirschten unter den Gummistiefeln des Sergeanten. Sie passierten endlose Fluchten von Steinbaracken, gerieten von einem Sperrkreis in den anderen, und sie alle waren vom Symbol der Zeit umgeben: vom Stacheldraht.
An den Durchlässen standen verdrossene MP-Posten oder geschäftige Polen in dunklen Uniformen. Je weiter sich Werner vom Mittelpunkt des Lagers entfernte, desto dichter wurde der Betrieb.
Amerikanische Offiziere und Soldaten hasteten mit Akten unter dem Arm an ihm vorbei. Jeeps schossen auf den Barackenwegen hin und her, und in manchen saßen Frauen, junge und hübsche Frauen, und auch sie trugen Uniformen. Vor ihm knirschten die Bremsen eines Wagens. Ein Captain stieg aus und reichte seiner Begleiterin den Arm. Sie war jung, blond und groß, und an ihren Beinen sah Werner zum ersten Mal hauchdünne Nylons.
Sie gingen weiter über einen Platz, dessen Seite durch eine verwitterte Bretterwand abgeschlossen war.
„Arbeit macht frei“, stand in großen, verwaschenen Lettern auf der Wand. Die Amis hatten es gleich stehenlassen. Nur dem Hoheitsadler auf der anderen Seite des Platzes hatten sie den Kopf abgeschlagen und das Hakenkreuz aus den Krallen gerissen.
Jetzt begegnete Werner zum erstenmal seit Monaten Zivilisten. An ihren armseligen Jöppchen und an ihren mageren Gesichtern erkannte er sie als Landsleute. Sie sahen weg, als er vorübergeführt wurde. Einer spuckte aus.
Noch nie war der Weg zu einer Vernehmung so lang gewesen, mit jedem Schritt, den Werner ging, steigerte sich die Beklemmung, legte sich bleischwer auf seinen Brustkasten, schnürte ihn zusammen, bis ihm die Übelkeit vom Magen her hochkroch. Seine Augen hatten endlich Gelegenheit, etwas anderes zu sehen als graue Zellenwände, als Kameraden, die vielleicht abgefeimte Mörder waren. Aber der Blick fing sich wieder an den hölzernen Türmen mit den MG-Ständen und Scheinwerfern, die nur am Tage blind waren. Und Werner hörte, wie sich die Posten die Zeit mit Witzen, Flüchen und Weibergeschichten vertrieben.
Hat sicher mit Colonel Evans zu tun, redete Werner sich ein, daß sie mich hier entlangführen, und einen Moment wich die Beklemmung. Dann war sie wieder da. Werner wußte selbst nicht, warum. Er hatte auf einmal die Empfindung, daß sich in Dachau nichts geändert hatte, daß aus einer riesigen Knochenmühle des Verbrechens eine ebenso große Garküche der Gerechtigkeit geworden war. Und Werner hatte einfach Angst, verkocht zu werden … trotz Colonel Evans, der ein Mann, ein Mensch, ein Gentleman war …
Zu dem Sergeant stieß jetzt noch ein Leutnant. Werner betrat in ihrer Mitte eine abseits gelegene Baracke. Die Sonne fiel so schräg durch die Fenster, daß er ein paar Sekunden geblendet war, als man die Türe zu einem Zimmer aufgestoßen hatte.
Dann sieht er vier Silhouetten: zwei Männer, zwei Frauen, hört eine Stimme, die wie in einem leichten Aufschrei ruft:
„Werner!“
„Vera“, sagt Werner leise, mechanisch. Er starrt seine Schwester an und begreift nichts. Und seine Gedanken lösen sich vom Verstand, jagen sich schnell, unsinnig und nutzlos. Vera, die Schwester, Vera neben einem Amerikaner, Vera in Nylons, Vera lächelnd, Vera mitleidig, Vera, Vera, Vera …
Sein Blick tastet sich an ihr entlang. Allmählich bekommt das Bild auf seiner Netzhaut Farbe und Gestalt. Sein Gesicht verzerrt sich zu einem automatischen Lächeln. Er steht da, mittelgroß, schmächtig, hilflos, vom Licht geblendet, und hat Angst vor der Begegnung mit der Schwester, die er liebt.
Und jetzt erst sieht er Brigitte.
„Sie haben 15 Minuten Zeit“, sagt der Leutnant zu ihm. Seine Stimme ist kühl, teilnahmslos. Es ist der Tonfall, in dem Urteile verlesen werden.
15 Minuten Zeit, denkt Werner, sieht Brigitte, sieht sie in weißer Schwesterntracht vor sich, fühlt die Wunde am Arm, merkt, wie seine Beine zittern, starrt und starrt, wischt sich mit der Hand über die Augen, will den kreisenden Nebel wegfegen. Brigitte … Vera … Brigitte … Vera … die Amerikaner. Alles schaukelt vor seinen Augen, verwebt sich, tanzt …
Jemand schiebt ihm einen Stuhl in die zitternden Kniekehlen, Werner fällt krachend auf den Sitz.
„Poor guy“, entfährt es dem jungen, schlaksigen Leutnant Tebster … „armer Kerl.“
Leutnant Henry F. Morris sagt gar nichts. Zum erstenmal sieht er Werner, den Mandanten seines Chefs, den Bruder des Mädchens, in das er sich verliebt hat und deretwegen er sich Sprechkarten erschlich. Und er denkt automatisch: viel Lärm um nichts. So hat er sich den Bruder der strahlenden Vera nicht vorgestellt, überlegt er.
„O Gott … Werner“, sagt Vera und geht mit ein paar schnellen Schritten auf ihn zu, weil sie fürchtet, daß er vom Stuhl sinkt. Sie will seine Hände nehmen.
„No“, sagt der Leutnant des Wachkommandos am Fenster. „Das ist verboten!“
Brigitte will etwas sagen, aber sie kann nicht. Ihre Lippen bewegen sich lautlos, ihre Augen glänzen, ihre Hände flattern.
Die drei Worte des Leutnants genügen, um Werner zu sich zu bringen, um die Schwäche zerfließen zu lassen. Klare, kalte Bitterkeit setzt sich wieder in den Hirnzellen fest, das Blut pocht in den Schläfen. Er rappelt sich auf, lächelt dümmlich, seine Stimme ist brüchig:
„Das ist aber eine … Überraschung.“
Vera schluckt. Sie steht dicht vor ihrem Bruder. Sie möchte ihm um den Hals fallen, möchte ihn an sich ziehen, möchte seinen Kopf streicheln. Aber ihre Arme hängen schlaff herab. Sie darf ja nicht. Sie könnte ja dem Kriegsverbrecher Eckstadt irgend etwas zustecken, Gift vielleicht oder einen Napfkuchen …
Da sind die Tränen, laufen ihr über das Gesicht, und je energischer sie sie abwürgen will, desto leichter fließen sie.
Werner fühlt sich so elend wie noch nie. Noch immer ist das verzerrte Lächeln in seinem Gesicht.
„Ist schon gut“, sagt er blechern. Und er versucht, an seiner Schwester vorbeizusehen, dabei begegnet er dem Blick Brigittes, sieht, wie blaß sie ist, und ihm wird noch elender. Die Wunde brennt, und es riecht nach Karbol, und er küßt sie, und er streichelt ihre Haare, tollt mit ihr herum … und das alles ist so weit weg … so unendlich weit weg … und kommt nie wieder, nie wieder … nie wieder. So jedenfalls hämmert es in seinen Adern, pocht das Herz, schlägt es gegen seinen Kopf, grinst es aus seinem Gehirn, zittert es in seinen Kniekehlen. Vorbei, aus, nie wieder, nie wieder. Hauchdünne Nylons …
„Das ist Leutnant Morris“, sagt Vera mit unsicherer Stimme, „und da am Fenster, das ist Leutnant Tebster.“ Sie wendet sich hilfesuchend nach den beiden Offizieren um. „Wir haben ihnen sehr zu danken, Werner“, setzt sie leise hinzu.
Etwas bäumt sich in Werner auf. Vielleicht kann er die olivgrüne Farbe der Uniform nicht mehr ertragen? In den letzten Monaten sah er nichts anderes, Leutnant Prince hatte sie an, Cornedbeef saß sie prall auf dem üppigen Leib … und olivgrün flimmerte es vor seinen Augen, so oft der Sergeant mit dem Gummiknüppel zudrosch. Werner steckt schon zu tief in der Rolle des Gefangenen, des Ausgestoßenen, des Wehrlosen, des Verdächtigen, des Angeklagten … und da sieht er nun seine Schwester und das Mädchen, das er liebt, zusammen mit zwei Männern in amerikanischen Uniformen, in tadellos gebügelten Hosen, in makellosen Hemden, mit ordentlich gebundenen Schlipsen … und er sieht die Goldknöpfe auf den Uniformjacken, und sie glänzen genauso wie die Augen Veras, wie die Augen Brigittes.
Werner beißt die schmalen, blassen Lippen zusammen, versucht ein Kopfnicken, aber es wirkt nicht wie eine Geste der Zustimmung, es ist eher eine Grimasse der Abwehr. Was geht mich das alles an, denkt er.
Leutnant Morris erwidert nichts. Tebster redet auf den Bewachungsoffizier ein. Der schlaksige Mann aus Texas ist ein Mensch, und er findet die Art, mit der man Werner vorführt, deshalb zum Kotzen.
„O.K.“, sagt plötzlich der Offizier des Bewachungskommandos, „three minutes!“
Tebster nimmt Vera und Morris und schiebt sie einfach aus dem Zimmer.
Der Gefangene ist mit Brigitte allein. 180 Sekunden lang. Sie stehen einander fremd gegenüber. In Werners fahlem Gesicht haftet ein gefrorenes Lächeln. Er steht auf, läuft im Zimmer hin und her, immer, wenn er in ihre Nähe kommt, stockt sein Fuß und er wendet sich dann fast abrupt um.
„Es geht dir hoffentlich gut“, sagt er hart.
Brigitte sieht ihn immer nur an.
„Werner?“ fragt sie leise, „… ich weiß nicht, wie das alles gekommen ist. Haben sie wirklich das Geständnis von dir erpreßt?“ Sie erschrickt vor ihrer Frage. Sie bereut sie bereits, aber sie muß das einfach wissen. Vielleicht nur deshalb, weil sie eben zum erstenmal in ihrem Leben durch das Konzentrationslager Dachau gegangen ist, weil ihr plötzlich das Bild ihres toten Vaters vor Augen stand, den SS-Leute in einem solchen Lager ermordet hatten.
Werner sieht durch das Mädchen hindurch. Seine Augen sind flach und kalt. Sein Trotz ist dumm und böse.
„Du mußt auf den Prozeß warten“, entgegnet er mit höhnischer Stimme, „man soll einem schwebenden Gerichtsverfahren nicht vorgreifen … nicht wahr, du weißt doch, daß die amerikanische Justiz erstklassig ist.“
„Oh, Werner“, flüstert Brigitte. Sie steht jetzt ganz nahe neben ihm, sieht zu ihm auf, ihre Lippen zucken, „verstehst du denn nicht?“
„Nein, ich verstehe nicht. Und es ist auch ganz egal.“
Er könnte sich ohrfeigen, aber er kommt nicht dagegen an. Es ist auf einmal alles so falsch, so verbogen, so verwickelt … und er riecht den Duft ihres Haares. Eine Geste würde genügen, ein Wort, eine Zärtlichkeit. Aber er findet sie nicht. Zwischen ihm und dem Mädchen steht die Zeit mit ihrer geballten Gemeinheit, mit ihrem blinden Zufall, mit ihrer gedankenlosen Tücke.
„Ich hoffe, du bist nicht allein“, sagt Werner brutal. Er sieht zum Fenster hinaus. In sein lebloses Gesicht, das in einer Hölle von Qual, Stumpfsinn und Einsamkeit geformt wurde, schrieb sich die Hoffnungslosigkeit ein, das die Verlorenheit zur Maske degradierte. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes, aber Gott schien seine Hand von der Zeit genommen zu haben, schien sich auszuruhen, schien sich mit der Unmenschlichkeit seiner Geschöpfe abgefunden zu haben.
Brigitte weint.
„Werner“, flüstert sie. Mehr kann sie nicht sagen.
Er quält sich, indem er sie verletzt. Und er verletzt sich, indem er sie quält. Vor seinem Verstand steht der eiserne Vorhang des Trotzes.
„Ich fände das vernünftig von dir“, sprudelt er heraus, „es hätte sowieso keinen Sinn … Wahrscheinlich hängen sie mich. Wenn ich mit 20 Jahren davonkomme, habe ich Glück … Und so lange zu warten, ist doch Quatsch. Das siehst du ja ein, nicht?“
Ich lüge, denkt er, mein Gott, ich lüge. Ich muß lügen. Ich muß es einfach. Lieber Gott, laß es sie merken, laß sie etwas erwidern, reiß diese Mauer ein, laß mich aufwachen, laß mich ihr sagen, was ich denke, fühle, hoffe, glaube … trotz alledem.
Da geht die Türe auf. Der Leutnant des Bewachungskommandos grinst. Der Sergeant ebenfalls.
„Bißchen kurz, drei Minuten“, sagt er zu Tebster.
Der CIC-Offizier wird rot vor Ärger, denn er hat begriffen, für welchen Zweck der Leutnant die Zeit knapp fand.
Brigittes Gesicht ist ohne Ausdruck, ohne Leben.
Aber Vera hat sich in der kurzen Zeit draußen zusammengenommen. Sie ist entschlossen, den furchtbaren Druck, das Falsche, das Verlogene zu überbrücken. Sie spricht darauf los wie ein Wasserfall. Sie redet fiebrig über alles hinweg, spricht vom Alltag und von Lebensmittelkarten und davon, daß Tante Erna schön grüßen läßt …
Werner ist ihr dankbar, obwohl er gar nicht zuhört. Noch dankbarer ist er seinem Bewacher, der das Handgelenk hochhebt und mit dem Finger auf die Armbanduhr tippt.
Schöne Uhr, denkt Werner mechanisch, und er stellt fest, daß es eine Pilotenuhr der deutschen Luftwaffe ist.
In diesem Augenblick geht Tebster auf Werner zu. Er schiebt einfach den Kaugummi von einer Seite auf die andere. Er haut Werner Eckstadt auf die Schulter, packt ihn mit der Hand im Genick. Es ist eine warme, gute, trockene Hand …
„Take it easy“, sagt der Leutnant, „nimm’s nicht so schwer.“ Er hat eine rauhe Stimme und flucht kurz und bündig: „Verdammt!“
Werner schluckt.
„Wir kommen bald wieder“, sagt Vera.
„Sicher“, antwortet Werner.
„Und verlaß dich drauf“, fährt Vera fort, „wir holen dich hier heraus. In einem Vierteljahr lachst du drüber.“
„Sicher“, erwidert Werner zerstreut.
Und Vera senkt den Kopf und verläßt sehr schnell den Raum. Als Brigitte ganz dicht an ihm vorbeigeht, bewegt Werner die Lippen. Aber er kann nichts mehr sagen, weil ihm ein dicker Kloß die Kehle zupreßt, seit ihm der amerikanische Leutnant Tebster ins Genick faßte und schüttelte, und seitdem er spürte, daß das eine einfache, ehrliche Geste war … Und auch Brigitte findet kein Wort, wirkt fast erleichtert, daß sie aus dem Raum herauskommt, daß sie Werner nicht mehr zu sehen braucht, den Mann, den sie liebt, trotz alledem. Und jetzt, Sekunden später, Sekunden zu spät, wird ihr einfallen, was sie alles zu sagen vergaß, was sie nie mehr vergessen wird, wenn sie jemals eine zweite Chance hätte.
Als die vier wieder in dem Wagen sitzen, sagt Vera:
„Wir hätten nicht hierherkommen dürfen. Noch nicht …“
Niemand gibt ihr Antwort. Von Dachau bis München flucht Leutnant Tebster in unregelmäßigen Abständen vor sich hin …
Diesmal wurde Colonel Evans im Hauptquartier der amerikanischen Armee in Heidelberg sofort beim Zwei-Sterne-General Simson vorgelassen.
„Hallo!“ rief der General schon von weitem, während er langsam die zu lang geratenen Beine von der Schreibtischplatte nahm. „Wie geht’s, Colonel?“ Er lachte. „Haben Sie nun endlich Ihre verdammte Sprechkarte gekriegt?“
„Jawohl, Sir.“
„Na also … Kommen Sie, mein Lieber, wir gehen in den Club. Ich habe einen französischen Koch engagiert. Solche Steaks haben Sie noch nie gegessen.“
„Jawohl, Sir.“
Der General ließ sich an einem reservierten Tisch nieder und las umständlich und genußfroh die Speisekarte. Er bestellte eine Flasche Mosel, blinzelte dem Colonel zu.
„Das Beste an Deutschland ist der Mosel. Ich bin eigens hingefahren und habe 50 Flaschen eingekauft. Sie werden staunen, Oberst.“
„Gewiß, Sir.“
„Sind Sie nicht so dienstlich, Evans … Nehmen Sie Schildkrötensuppe voraus?“
„Gerne.“
„Wie geht’s denn in München?“
„Danke.“
„Und wann gehen Sie in die Staaten zurück?“
„Ich weiß es noch nicht, Sir.“
„Na, mir pressiert es auch nicht mehr … Bleibt’s beim Steak?“
„Die Sache ist die, Sir“, begann Evans, „ich komme bei meinen Ermittlungen nicht weiter.“
„Nehmen Sie die Pommes frites. Ausgezeichnet. Und jetzt will ich nichts von Ihrem verdammten Prozeß hören. Mein Arzt hat mir verboten, beim Essen über Probleme zu reden.“
„Entschuldigung, Sir.“
Der General aß mit schweigendem Behagen. Er war für zwei Dinge berühmt: für verwegene Panzerangriffe und verfeinerten Geschmack. Das erste brachte ihm drei Reihen Orden, das zweite zehn Pfund Übergewicht, die er mit Golfspiel bekämpfte.
„Wie geht es Ihrer Familie?“ fragte er beim Nachtisch.
„Danke, Sir … Darf ich jetzt zur Sache kommen?“
„Erst noch die Zigarre. Oder ziehen Sie Zigaretten vor?“
Evans nahm eine Zigarre und sah auf die Uhr. Der General bemerkte es verdrossen.
„Na, dann schießen Sie los mit Ihrem Ärger.“
„Ich habe die Verteidigung im Malmedy-Case übernommen …“
„Das weiß ich“, knurrte Simson.
„Und was ich übernehme, übernehme ich ganz.“
„Weiß ich auch.“
„Ich muß nach Malmedy fahren, Sir. Ich muß mit den Zeugen sprechen. Ich muß mir ein klares Bild von der Geschichte machen können.“
„Na, dann fahren Sie doch.“
„Ich brauche Autos, Rechercheure … Ich brauche Geld.“
Jetzt wurde der General ärgerlich.
„Ein Auto haben Sie, recherchieren können Sie selbst, Oberst, wenn Sie schon überall Ihre Nase ’reinstecken müssen. Geld? … Sind Sie verrückt geworden? Meinen Sie, die Armee gibt noch Geld dafür aus, daß Sie diese verdammten Kriegsverbrecher vom Strick abschneiden? … Was ist mit Ihnen los, Evans, wissen Sie denn nicht, was bei Malmedy passiert ist? Ich warne Sie! Sie haben sich in den Fall verbissen!“ Der General stand auf. „Aber glauben Sie nicht, daß die Armee auch noch Geld für Ihre Marotten ausgibt!“
„Sir“, entgegnete Evans stockend, „das ist eine Beschneidung der Verteidigung.“
„Von mir aus ist es, was es will! … Ich mag Sie gern, Evans. Ich halte viel von Ihnen …“ Er lächelte belustigt. „Wenn ich mal in eine dumme Sache gerate, Sie werden mein Verteidiger, verlassen Sie sich darauf.“ Der Ton des Generals schlug plötzlich um. Seine Stimme wurde schneidend und barsch: „Doch eines merken Sie sich ein für alle Mal: die Armee hat kein Geld für die Verteidigung ihrer eigenen Mörder! Das ist mein letztes Wort, Colonel.“
Schon als sich der Oberst beim General frostig verabschiedete, wußte er, was er zu tun hatte. In seiner gradlinigen Art blieb ihm keine andere Wahl. Er fuhr von Heidelberg direkt nach Malmedy. Er bezahlte es selbst. Nicht nur das. Jahrelang wird er weiterkämpfen, wird fast sein gesamtes Privatvermögen opfern, wird mehr als hunderttausend Dollar ausgeben, damit unschuldige Männer gerettet werden, die einer verbrecherischen Organisation angehörten, die die Feinde seines Landes waren. Er wird es nicht einmal für sie tun … auch wenn es ihnen zugute kommt. Er wird es tun, damit auf Amerika kein Makel fällt. Er will beweisen, daß die Cornedbeefs die schlechtesten Amerikaner sind, eine winzige Minderheit krimineller Schläger, die es überall auf der Welt, in allen Ländern, in allen Armeen, unter allen Flaggen gibt.
So kam der Oberst zum erstenmal nach Malmedy, sprach mit Zeugen, sondierte scharf und unerbittlich, ließ die schrecklichen Erlebnisse, den berechtigten Haß der Bewohner über sich ergehen, stand mit zusammengebissenen Zähnen an der Wegkreuzung, schluckte das Unfaßbare, das Grauenhafte, das Ungeheuerliche noch einmal. Er widerlegte falsche Aussagen, zerpflückte fahrlässige, nahm die Zeugen in die Zange, wieder und wieder, ließ ihren Unwillen über sich ergehen, wurde selbst unwillig und begann wieder von neuem, von vorne. Er entwirrte mit unendlicher Geduld das Netz von Lüge, Verrat, Verbrechen und Zufall. Es lief ihm heiß den Rücken hinab, als er abermals erfuhr, was er schon wußte. Die Hilferufe der niedergemetzelten Soldaten gellten in seinen Ohren. Ihre toten Augen sahen ihn an.
Und er wollte in dieser Minute alles liegen- und stehenlassen, zurückfahren, die Verteidigung abgeben. Riesengroß wurde die Versuchung … niemand konnte von ihm verlangen, daß er, der Amerikaner, der Offizier, in dem Dunkel dieser abscheulichen Verbrechen herumstocherte.
Evans stieß auf einen belgischen Waldarbeiter, einen Mann mit gutmütigem Gesicht, das noch jetzt jede Farbe verlor, wenn er wiedergab, was er mit eigenen Augen gesehen hatte.
„Ich spreche deutsch“, sagte er zum Oberst, „ich verstand jedes Wort. Ich hatte mich in ein Dickicht verkrochen, neben dem es passierte. Ein SS-Mann in Unteroffiziersuniform hatte einen amerikanischen Soldaten eingeholt. Es war schrecklich.“
Der Oberst nickte.
„Der Mann zerrte den Amerikaner auf die Beine, zog die Pistole und lachte. ,Einen Schuß für Mutti‘, sagte er und schoß in das linke Bein.
Der GI brach zusammen.
,Und der für Vati‘, fuhr der Mörder, noch immer lächelnd fort, zielte und durchschoß das rechte Bein.
Der Soldat hatte große, flehende Augen und schrie, schrie, daß ich mir die Ohren zuhielt.
,Und eine Braut hast du sicher auch‘, stieß der Mörder hervor, ,und das ist für sie.‘ Wieder drückte er ab. Wieder knallte ein Schuß.
Ich wollte hinstürzen. Ich war blind vor Haß und Zorn. Aber ich konnte nichts machen. Ich erlebte es aus nächster Nähe, ich sah, wie der Mörder auf den Unterleib zielte. Ich sah sein Gesicht.“ Der Waldarbeiter machte eine Pause. „Ich sehe es immer noch. Wochenlang träumte ich davon. Und selbst jetzt noch erscheint es mir mitunter.“
„Wie sah der Mörder aus. Um Gottes willen, sprechen Sie doch! Wie sah die Bestie aus“, unterbrach Oberst Evans den Arbeiter.
Hastig und mit zitternden Händen warf er seine Fotos auf den Tisch. Der Zeuge nahm Bild für Bild in die Hand, starrte sie an, schüttelte jedes Mal den Kopf.
„Er ist nicht dabei“, antwortete er dann, „ich habe die Fratze nicht vergessen. Ich erkenne sie unter tausend Gesichtern wieder.“ Er zuckte mit den Schultern, „aber hier ist er nicht darunter. Leider.“
Der Oberst zweifelte an Gott, an der Welt, am Fortschritt, an der Menschheit. Er zweifelte an allen Idealen, denen er bisher gelebt hatte, als er von Malmedy zurückfuhr. Er war angeschlagen, angeekelt, erschüttert, verzweifelt. Er war müde, zerschlagen, leergebrannt. Er war unfähig, noch etwas zu begreifen, zu verstehen, zu fassen.
Und er war entschlossen, trotzdem die Verteidigung der Malmedy-Angeklagten zu übernehmen, soweit er sie für unschuldig hielt …
Aber er stand allein. Ein Mann, ein Mensch, ein Fanatiker des Rechts in einer Flut von Blut, Intrige, Mord, Folter und Verbrechen. Auf beiden Seiten. Hüben wie drüben. Zwischen deutschen und amerikanischen Verbrechen … denn die Gemeinheit ist an keine Sprache, an kein Land, an keine Farbe gebunden. Sie ist international.
Die Weltherrschaft des Teufels.
Werner Eckstadt lief der Schweiß über das Gesicht. Er lag auf dem Rücken und starrte gegen die Decke, immer auf den gleichen Fleck, bis er sich durch seine Augennässe verwischte. Er biß sich auf die Zunge, bis sie blutete. Er krallte die Nägel in das Fleisch. Der körperliche Schmerz tat ihm fast wohl. Was war er, gemessen an der Qual seiner Gedanken.
Werner haßte sich. Jetzt hängen sie dich mit Recht, dachte er verbissen, ganz mit Recht. Und sie sollen, sie werden sich einen Dreck drum kümmern, ob du unschuldig bist. Du hast Menschen, die dich schätzen, die dich lieben, die dir helfen wollten, vor den Kopf gestoßen. Du hast nicht gesehen, wie viele Sorgen sie sich um dich machten, was sie alles für dich taten. Du hast nur ihre hauchdünnen Nylonstrümpfe betrachtet und deinen dreckigen Vorstellungen freien Lauf gelassen … Kaugummi, Schokolade, Zigaretten, Strümpfe, Fräuleins. Und sie sollen dich auslöschen, denn du bist ein Cornedbeef auf anderer Ebene …
Alles sollte gut werden, und alles ist falsch gelaufen. Ein paar Monate Haft hatten genügt, seinen Lebenswillen auszulöschen. Er hatte sich damit abgefunden, daß er stellvertretend für Verbrecher büßen sollte. Jetzt aber, nach dieser Begegnung, war es vorbei. Die Sucht, der Drang weiterzuleben, da wieder zu beginnen, wo er einmal aufgehört hatte, waren da. Hoffnung gesellte sich dazu. Zum Sterben zuviel, zum Leben zuwenig Hoffnung.
Jetzt, unmittelbar vor dem Prozeß, wurde das Essen besser, die Behandlung menschlicher. Aber Werner rührte nichts an. Er sprach mit niemandem. Er saß auf seiner Pritsche und grübelte. Wenn es niemand sah, weinte er. Mitunter schrie er im Schlaf auf, fluchte oder versuchte zu beten. Seine Arme griffen nach Brigitte. Sie griffen ins Leere. Hundertmal rechnete er sich aus, was er hätte sagen müssen, und jedesmal biß er sich hinterher auf die Zunge. Alle gingen ihm aus dem Weg.
Als Colonel Evans von Malmedy zurückkommt, am Vorabend des Prozesses gewissermaßen, findet er Werner völlig verändert vor. Haftpsychose, denkt der Oberst. Aber dann begreift er, daß es etwas anderes ist.
„Sie hatten Besuch?“ fragt er.
„Ja“, versetzt Werner knapp.
„Ihre Schwester ist ein nettes Mädchen“, fährt der Oberst fort, „und sehr tapfer. Denken Sie an sie. Vielleicht geht es Ihnen dann besser.“
Werner nickt.
„Nun reißen Sie sich zusammen, Mann. Das ist ein Anfang. Die Verhandlung wird nicht schön. Eine verdammt dumme Sache, Ihr Geständnis. Ich weiß nicht, wie das Urteil ausgeht. Ich mache Ihnen gar keine Hoffnung … aber etwas kann ich Ihnen versichern: Ich hole Sie ’raus. Auch noch nach der Verurteilung.“
„Warum tun Sie das alles für mich?“ fragt Werner.
„Denken Sie sich, was Sie wollen“, versetzt der Oberst kalt. Er betrachtet seine Fingernägel. „Nicht Ihnen zuliebe, obwohl Sie mir ganz gut gefallen. Nicht wegen Ihrer Schwester, die mir noch besser gefällt … Glauben Sie an Gott?“
„Mitunter“, antwortet Werner.
„Ich glaube an ihn und deshalb glaube ich auch an den Menschen … trotz Malmedy. Aber lassen wir das. Zurück zu damals. Sie begannen also Ihren Einsatz in einem Tigerpanzer?“
Werner starrt vor sich hin. In seinem Gesicht zuckt es. Seine Hände verkrampfen sich. Er stiert auf den Boden, wagt es nicht, den Oberst anzusehen.
„Wie hieß der Kompaniechef?“ fragt der Oberst weiter.
In dieser Sekunde bricht Werner Eckstadt zusammen. Er stützt den Kopf auf die Hände, sein Gesicht verzerrt sich, sein Atem geht stoßweise.
„Was haben Sie denn?“ fragt Evans barsch.
Werner richtet sich auf. Der Krampf läßt allmählich nach.
„Ich muß Ihnen etwas gestehen, Sir“, antwortet er langsam. „Dann sind Sie ein für alle Mal mit mir fertig. Aber ich muß es Ihnen sagen. Sie sind … Sie sind der erste Amerikaner, der anständig zu mir war … und ich habe Sie angelogen, Sir …“
„Was?“ schreit Colonel Evans.
„Ja“, erwidert Werner, „und jetzt sollen Sie erst alles erfahren. Ich war gar nicht in dem Panzer. Zuerst wenigstens nicht. Ich kam mit dem Flugzeug … in amerikanischer Uniform … Sabotagetrupp …“
„So“, erwidert der Oberst. Er betrachtet Werner von oben bis unten. Endlos. Die Zeit bleibt stehen. Er sagt nichts. Sein Gesicht ist ruhig wie seine Hände. Er sieht und sieht auf Werner, durch ihn hindurch.
„Und dann?“ fragt er.
„Dann war alles so, wie ich es Ihnen berichtete.“
Der Oberst tritt an das Fenster, sieht hinaus. Er kehrt Werner den Rücken, dreht sich langsam um, zündet sich eine Zigarette an. Das Streichholz verfehlt zweimal die Reibfläche.
„Sir, ich bitte Sie, mich nicht zu verteidigen“, sagt Werner leise. „Niemand kann Ihnen das zumuten … nun wissen Sie alles.“
Werner Eckstadt hebt den Kopf, als ob er seiner verlorenen Stimme nachhorchen wollte. Er schluckt. Seine Augen kleben im Niemandsland. In dieser Sekunde hängt er wieder an den Gurten des Fallschirms, gleitet lautlos zur Erde, landet im Dorfteich bei dem Transformatorenhäuschen, spürt den Stiefelabsatz des bulligen MP-Mannes, wird aus dem Stroh gezerrt, zu Boden geprügelt, abgeführt.
Und wieder rumpeln die deutschen Tigerpanzer heran und wieder steht er da in olivgrünen Unterhosen, hebt die Hand und schreit, brüllt, bettelt um sein Leben …
Und dann schlägt Cornedbeef zu. Sein Knüppel vibriert durch die Luft, und durch die Schwingungen hindurch sieht Werner Colonel Evans, der reglos am Fenster steht, mit abwesender und abweisender Miene, der nichts sagt, der sich nicht anmerken läßt, was er denkt, der schweigt, endlos, gedehnt, vernichtend. Und noch einmal wiederholt Werner:
„Verteidigen Sie mich nicht, Sir. Jetzt wissen Sie alles … ich kann Ihnen das nicht mehr zumuten.“
Der Satz schwebt im Raum, im primitiven Vernehmungszimmer. Ein Tisch, zwei Stühle, eine Blechbüchse als Aschenbecher und Harry S. Truman an der Wand mit Siegerlächeln unter verstaubtem Glas …
Endlich dreht sich der Oberst um.
„Wer weiß das noch?“ fragt er knapp.
„Wieblich“, erwidert Werner.
Der Colonel nickt.
„Das ist der Mann, der Sie beschuldigt, die Gefangenen ermordet zu haben?“
„Ja, Sir.“
„Und das mit der Sabotagelandung in amerikanischer Uniform?“
„Er weiß es. Sein Panzer hat mich schließlich aufgefischt … Aber keiner hat ihn bis jetzt gefragt, ob ich von Anfang an im Panzer war.“
Der Colonel gibt sich einen Ruck.
„Sie halten gefälligst Ihren Mund“, bellt er dann.
„… Von dieser Sache will ich nichts wissen. Für mich saßen Sie im Panzer. Von Anfang an. Alles andere habe ich nicht zur Kenntnis genommen!“
In dieser Sekunde begreift Werner gar nichts. Er steht da wie ein trotziges, schmächtiges Kind und redet sich immer wieder ein: ich habe ihm alles gesagt. Ich bin kein Lügner mehr. Ich bin anständig. Verdammt, wie anständig ich bin! Nichts mehr zu verheimlichen. Ich brauche keine Angst mehr vor seinen forschenden Augen zu haben. Ich brauche mich nicht mehr zu fürchten, daß er zur Türe hereinkommt und sagt: „Sie sind ein Lügner, Eckstadt! Ich übergebe Sie dem Henker. Sie haben es nicht anders verdient!“
„Haben Sie mich verstanden?“, knurrt der Oberst.
Werner nickt mechanisch.
„Wiederholen Sie!“
Zögernd beginnt Werner:
„Sie haben es nicht zur Kenntnis genommen … ich bin nicht mit dem Fallschirm gelandet … ich war von Anfang an im Panzer, nur im Panzer.“
Der Oberst nickt.
Jetzt begreift Werner erst, was der Verteidiger meint.
„Nein, Sir“, sagt er leise, „Sie haben nur Schwierigkeiten … Lassen Sie nur. Ich bin eben verloren … ein paar sind immer verloren, nicht wahr? Es ist eben alles ein so … gemeiner Zufall.“
Colonel Evans geht mit großen Schritten zur Türe. Er dreht sich noch einmal um. Sein Gesicht ist ruhig und gelassen, aber seine Augen sind freundlich, fast warm.
„Sie sind ein anständiger Kerl, Eckstadt“, sagt er. „Ich wünsche Ihnen alles Gute. Sie sind nicht allein beim Prozeß. Denken Sie daran!“
Während Werner vom Posten abgeführt wird, denkt er: Schlag zu, Cornedbeef, schlag zu, so fest du kannst! Brich die vernarbte Wunde am Arm auf! Steckt mir brennende Streichhölzer unter die Fingernägel! Veranstaltet Scheinhinrichtungen! Schickt mir eure Spitzel als Priester getarnt in die Zelle! Mästet die Denunzianten! Bezahlt die Verräter!
Ich spüre es nicht mehr. Ich höre nicht mehr die tierischen Schreie der Gefolterten. Mir dreht sich nicht einmal mehr der Magen um, wenn ich euch sehe. Ich sehe euch nicht mehr.
Ihr könnt mich nicht mehr vernichten! Ihr könnt mir nicht mehr beibringen, daß auch die Amerikaner manchmal unmenschlich sind … daß sie bloß eine andere Uniform anhaben.
Ihr habt den Colonel Evans. Und ein Evans wiegt hundert, wiegt tausend, wiegt euch alle auf! Werners Gesicht ist gerötet. Zum ersten Male seit Wochen. Die stumpfe Angst, die Beklemmung fallen von ihm ab. Zuversicht durchdringt ihn ganz.
Auf einmal ist Brigitte kein blasser Schatten mehr … das Mädchen atmet, lächelt, ist aus Fleisch und Blut und ist nahe, ganz nahe …