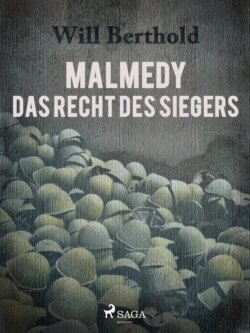Читать книгу Malmedy - Das Recht des Siegers - Will Berthold - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. kapitel
ОглавлениеDiesmal landet Colonel Evans an der richtigen Stelle: im Kriegsverbrechergefängnis von Dachau. Ein baumlanger MP-Soldat führt ihn zum Kommandanten.
„Freut mich, Sie zu sehen“, beginnt Oberst Bowler.
Colonel Evans kommt gleich zur Sache.
„Ist ja noch Zeit“, fährt der Kommandant fort, „der Prozeß beginnt erst in der nächsten Woche … Sie haben sich da auf eine schöne Sache eingelassen … Das sind ausnahmslos Verbrecher. Sie gehören gehängt. Und sie werden gehängt … Ich weiß nicht, was Sie noch wollen?“
„Vielleicht haben Sie recht“, antwortet Evans. „Aber nur vielleicht. Ob ich die Verteidigung übernehme, hängt von einer Unterredung ab, die ich mit einem Ihrer Gefangenen führen möchte. Bitte rufen Sie den Häftling Werner Eckstadt.“
„Sofort.“
Man führt den Oberst ins Vernehmungszimmer. Nach fünf Minuten öffnet sich die Tür.
Ein blasser, schmächtiger Mann wird in den Raum gestoßen. Er hat die Augen am Boden und hebt sie ganz langsam, zögernd, flackrig.
„Sie sind Werner Eckstadt?“ fragt der Colonel.
„Yes, Sir“, antwortet Werner auf englisch.
„Ihr Fall interessiert mich. Vielleicht übernehme ich ihn.“ Colonel Evans steht auf, geht mit unruhigen Schritten im Raum auf und ab. „Damit wir uns recht verstehen“, er verharrt einen Moment und dreht sich nach Werner um, „wenn ich Sie bei einer einzigen Lüge fasse, ist es aus. Eine einzige Unwahrheit genügt.“
„Jawohl, Sir.“
„Sie waren im Malmedy-Einsatz?“
Werner Eckstadt nickt.
„Sie waren auf der Straße bei Werbomont?“
„Auch das“, erwidert Werner.
„Sie hatten mit der Erschießung wehrloser amerikanischer Soldaten nichts zu tun?“
„No, Sir.“
„Und Sie haben insgesamt drei Geständnisse unterschrieben?“ fährt Colonel Evans fort. „Sie haben in allen grausame Einzelheiten geschildert, wie Sie meine Landsleute ermordeten. Und diese Schilderung deckt sich genau mit den Berichten der Augenzeugen.“
„Ja“, antwortet Werner Eckstadt.
„Warum haben Sie das getan?“
Der schmächtige Mann mit den blonden Haaren, mit dem verhärmten, blassen Gesicht, mit den unsicheren Augen streckt mit wortloser Geste seine Hände mit nach oben gehaltenen Außenflächen dem Oberst entgegen.
„Da ist die Antwort, Sir“, sagt er, „betrachten Sie meine Fingernägel.“
Die Nägel des Häftlings Werner Eckstadt sind zu kleinen Stummeln zusammengeschmort. An den Fingerspitzen gaffen blaurote Brandwunden. Zwei Finger der linken Hand stecken in einem weißen Verband.
„Diese beiden sehen noch schlimmer aus, Sir“, sagt Werner Eckstadt. Seine Stimme ist schwach und dünn. Sein Gesicht ist immer noch mit einer starren Maske überzogen. Seine Augen können noch immer nicht an einem Punkt verharren. Nur sein lebhafter Atem zeigt die Erregung.
Colonel Evans schaut zum Fenster hinaus. Sein Gesicht ist rot. Er hat es abgewendet. Vielleicht, damit der Häftling die Schamröte nicht bemerkt. Ruckartig fährt er herum.
„Und wie kommt es dann“, sagt er fast barsch, „daß Sie in Ihrem Geständnis alle Einzelheiten richtig wiedergegeben haben? Das konnten Sie doch gar nicht wissen, wenn Sie nicht beteiligt waren.“
„Doch“, entgegnet Werner. „Man hat es mir so lange vorgesagt, bis ich es behielt. Und dann steckten sie mir wieder die Zündhölzer unter die Nägel, und wenn ich Ihnen alles beschreiben soll, was sie sonst noch mit mir machten, dann brauchte ich eine Viertelstunde. Ich nehme an, daß Ihre Zeit knapp bemessen ist, Sir.“
Lange und kalt betrachtet der Oberst sein Gegenüber. In diesem Zustand hat der ehemalige Gefreite nicht viel, was ihn einnehmend machen könnte. Aber seine knappen, schlichten Worte, seine dünne Stimme, seine müden Augen, sein ausgezeichnetes Englisch, seine guten Manieren … das alles übersieht Oberst Evans nicht. Er hat eine intuitive Menschenkenntnis; aber er ist weit davon entfernt, sich auf sie zu verlassen.
„Setzen Sie sich“, sagt der Colonel, „und erzählen Sie mir Ihre Geschichte, ganz langsam und ganz von vorne und ohne jede Beschönigung. Sie brauchen keine Rücksicht auf meine Zeit zu nehmen.“
Der Oberst setzt sich auf einen Stuhl, schlägt die Beine übereinander.
„Das allerdings“, fährt er fort, und wieder streift er mit einem zerstreuten Blick das Fenster, „gilt nur so lange, wie Sie bei der Wahrheit bleiben.“
Langsam schüttelt Werner Eckstadt seine Befangenheit ab. Langsam rötet sich sein Gesicht. Er wird lebhafter, spricht ohne Stocken, sieht auf, sieht dem Colonel in das Gesicht, ohne zu zucken, ohne abzugleiten. Er spricht ruhig, fast leidenschaftslos.
„Das ganze Drama beginnt“, sagt er, „mit meiner Versetzung zur SS.“
„Sie waren also nicht freiwillig bei dieser Organisation?“ unterbricht ihn der Oberst.
„Na, hören Sie, Sir, wer meldet sich schon freiwillig zu der Garde des Satans?“
„Ich kenne eine Million Deutscher, die das getan haben.“
„Und ich kenne eine halbe Million, die dazu gezwungen wurden“, antwortet Werner.
„Sprechen Sie weiter“, erwidert der Oberst, und wieder sieht er dabei zum Fenster hinaus …
24 Stunden kannte Leutnant Tebster erst Vera, die Schwester von Werner Eckstadt. Aber diese 24 Stunden hatten genügt, sie jetzt ständig vor Augen zu haben. Er sah ihren Gang, ihre hübschen, flehenden Augen. Er hörte ihre volle, weiche Stimme … und er konstatierte fast ärgerlich, daß er sich in das Mädchen verliebt haben mußte. Verliebt … das war nichts für Vera, das wußte er genau. Sie war kein Mädchen für das Flüchtige. Sie war anders als die anderen. Und ständig würde der Schatten ihres Bruders zwischen Vera und ihm stehen …
Ein Gedanke läßt den Leutnant nicht los: die in dem Büro von Evans gestohlenen Akten. Von der ersten Sekunde an war er überzeugt, daß eine amerikanische Dienststelle hinter dem Einbruch steckte. Leutnant Tebster arbeitet nicht gerne bei der CIC. Nur seiner Sprachkenntnisse wegen hat man ihn zum amerikanischen Geheimdienst gesteckt. Wenn’s nach ihm ginge, würde er jetzt in Florida Wasserschi fahren und mit Jane und Harriet flirten oder mit Margaret Tennis spielen.
Gegen Mitternacht betritt er sein Büro. Er folgt blind seinem Verdacht: Bauer, der deutsche Agent der CIC, den er nicht leiden konnte, der Vera rufen ließ, um sie einzuschüchtern …
Woher die Anzeige gekommen war, kann Leutnant Tebster nicht feststellen. Sie blieb anonym. Bauer wußte es sicher. Aber Bauer log ihn aus irgendeinem Grunde an. Und das machte den Leutnant stutzig.
Leutnant Tebster steht in Bauers Zimmer. Er hat die Schlüssel zu seinen Schränken und zu seinem Schreibtisch. Und er zögert nicht eine Sekunde, sie zu benutzen. Im Schrank ist nichts zu finden. Das Schloß am Schreibtisch klemmt zuerst. Tebster würgt seine Ungeduld und sein Unbehagen hinunter und versucht es noch einmal.
Endlich gibt die Schublade nach. Obenauf liegen drei Packungen Camel, darunter Manuskriptpapier, daneben Bleistifte, zwischen den Bleistiften ein Brief. Stück für Stück nimmt der Leutnant den Inhalt heraus.
Ganz unten steckt in einem braunen Umschlag ein dickes Paket. Zugeklebt. Tebster reißt es auf. Akten. Er zieht sie hervor.
Mit einem Blick stellt er fest, daß es sich hier um die aus dem Büro von Colonel Evans entwendeten Protokolle über den deutschen Gefreiten beziehungsweise SS-Rottenführer Werner Eckstadt handelt.
Der Leutnant läßt sich auf einen Stuhl plumpsen, zündet sich eine Zigarette an und überlegt. Vor ihm liegen Aussagen der Malmedy-Voruntersuchung … und ein geschmuggelter Brief an Vera.
Der Teufel mag wissen, denkt Tebster grimmig, was ich jetzt zu tun habe …
Nach der dritten Zigarette weiß er es.
Er hat einen Ausweg gefunden; sein Plan ist so selbstverständlich, so einfach, daß er breit über sein sympathisches Jungengesicht grinsen muß …
Der Zigarettenrauch kringelt sich in blauen, dichten Schwaden zur Decke. Die einfarbigen, verschmutzten Vorhänge sind zugezogen. Der gelbe Lampenschirm gießt sein gedämpftes Licht über ein Aktenbündel im braunen Umschlag. Draußen gähnt die Straße, schläfrig und leer. Vor dem säulengeschmückten Eingang des CIC-Hauptquartiers halten zwei bullige MP-Posten mit gleichgültigen Gesichtern sinnlose Wache …
Nur ein Mann ist im Haus: Leutnant William R. Tebster, ein junger, schlaksiger Bursche mit lustigem Gesicht und viel zu lang geratenen Gliedern.
Eben hielt er Razzia in fremden Schubladen. Mit Erfolg. Vor ihm liegen Protokolle, die gestern aus dem Büro von Colonel Evans gestohlen wurden. Colonel Evans ist der Hauptverteidiger des in einigen Tagen beginnenden Malmedy-Prozesses.
Der Leutnant aus Texas sitzt bequem im Stuhl, die Beine auf dem Schreibtisch. Ab und zu greift er gedankenverloren nach einem Wasserglas mit Whisky und trinkt in langsamen, bedächtigen Schlucken. Er ist allein. Aber er grinst breit über sein Jungengesicht. Seine Gedanken machen ihm Spaß, von welcher Seite sie ihn auch angehen.
Da folgte er einer plötzlichen Eingebung, daß sein deutscher Assistent Bauer etwas mit dem Aktendiebstahl zu tun haben könnte. Schließlich hatte der Mann Vera Eckstadt gewarnt. Impulsiv folgte er seinem Verdacht, stürmte an den MP-Posten vorbei, die ihn verdrossen grüßten, schnappte sich die zweite Schlüsselgarnitur … und entdeckte, daß der unbekannte Einbrecher bei seiner eigenen Dienststelle saß. Und Bauer hieß. Er hatte diesen deutschen CIC-Angestellten nie leiden können. Zufällig aber war Bauer sein Assistent. Somit war der Leutnant eigentlich der Auftraggeber eines Diebstahls, von dem er nichts wußte.
Tebster lacht lautlos vor sich hin, greift sich das Aktenbündel und die halbvolle Flasche Whisky, verstaut sorgfältig beides in seiner Aktentasche, räumt Bauers Schreibtischschublade ein, legt die Reserveschlüssel an ihren Platz, löscht das Licht und stürmt dem Ausgang entgegen. Er freut sich auf Veras große Augen, und er freut sich auf Bauers Gesicht am nächsten Morgen.
Diesmal erwidert er den Gruß der MP-Posten, springt in sein Auto, einen klapprigen Ford, gibt Gas und würgt den Motor ab, weil er vergaß, die Handbremse zu lösen. Er braust die Kurven am Friedensengel hinunter, rast durch die nachtdunkle Prinzregentenstraße, biegt nach rechts in Richtung Schwabing ein, wo Vera in einem Mansardenzimmer wohnt.
Leutnant William R. Tebster pfiff vergnügt vor sich hin, als er Veras Haus betrat …
Vera Eckstadt und Leutnant Henry F. Morris hatten sich betroffen angesehen, als vor einer halben Stunde Tebster plötzlich aufgesprungen war und ohne ein Wort der Erklärung davongestürmt war. Sie verbrachten den Abend zu dritt in Veras Wohnung. Eigentlich sollte um zehn Uhr Schluß damit sein. Aber es zog sich in die Länge. Es war durchaus keine Party. Man unterhielt sich über Werner Eckstadt, man beriet im Kreise, wie man ihm helfen konnte.
Denn er steht unter dem Schatten des Galgens …
„Tebster ist verrückt“, meinte Morris.
„Glauben Sie?“ fragte Vera lächelnd.
„Wer mit Verrückten umgeht, wird schließlich selbst verrückt“, brummte Henry vor sich hin.
„Ich mag ihn gern“, versetzte Vera.
„So … Von mir sagen Sie so etwas nie.“
„Über Sie gerne … zu Ihnen nicht“, antwortete das Mädchen.
Das Radio spielte halblaut. Vera hatte den amerikanischen Soldatensender eingeschaltet. In einer Viertelstunde ist Sendeschluß. In einer Viertelstunde würde sie auch ihren nächtlichen Besucher hinauskomplimentieren. Ein netter Kerl, ein Gentleman, ein wenig verliebt und sehr korrekt. Ein Mann, der ihrem Bruder helfen will.
In diesem Augenblick platzt Leutnant Tebster wieder zur Türe herein, unter einem Arm ein Aktenbündel, unter dem anderen die Whisky-Flasche. Zuerst wirft er die Protokolle auf den Tisch, dann stellt er den Whisky behutsam ab.
„Was sagt ihr nun?“ schießt er los.
„Zum Whisky?“ fragt Henry.
„Nein, zu den Akten natürlich.“
Vera springt auf.
„Da habt ihr sie wieder“, fährt Tebster fort. „Unversehrt. Da ist der geschmuggelte Brief … hier die Vernehmungsprotokolle. Nichts fehlt. Du kannst sie morgen deinem Boß wieder übergeben“, wendet er sich an Henry, „schließlich herrscht bei uns Ordnung.“
„Bei euch?“ fragt Vera verdutzt. „Bei der CIC?“
„Ja, einer unserer Leute ist eingebrochen.“
„Saubere Dienststelle“, entgegnet Henry. Er lacht, füllt die Gläser voll, „Prost!“
Sie trinken. Der Whisky heizt ihnen ein. Sie sprechen laut und aufgeregt durcheinander. Sie freuen sich gemeinsam über Tebsters Streich.
Vera sitzt auf der Couch, den Rücken angelehnt, die Beine übereinandergeschlagen. Sie summt leise die Melodie mit. Ihr Gesicht sieht verträumt aus, frisch, jung. Sie trägt eine einfache Bluse zum dunklen Rock. Die Clips an ihren Ohren klirren leicht, wenn sie den Kopf bewegt und dabei ihre dunkelblonden Haare durcheinanderschüttelt. Sie tut es oft, denn sie muß ihre Aufmerksamkeit zwischen zwei Männern teilen. Links neben ihr sitzt Morris, ein wenig kleiner und ein wenig ernster als Tebster. Tebster ist eine Nuance häßlicher als hübsch, eine Kleinigkeit dünner als schlank, eine Winzigkeit schnoddriger als erlaubt. Er springt auf, verrenkt seine zu lang geratenen Glieder im Rhythmus eines Jitterbugs.
„Nehmen wir mal an, der Ankläger steckt hinter dieser Geschichte“, beginnt er wieder, „warum läßt er wohl Akten verschwinden? Na, warum?“
Morris zuckt mit den Schultern.
„Weil er Dreck am Stecken hat“, gibt er sich selbst die Antwort. „Und warum hat er Dreck am Stecken? Weil die Sache mit Veras Bruder eben doch nicht so stimmt, wie er es sich ausgerechnet hat.“
Um 1 Uhr endet die Musik.
Um 1 Uhr 05 ist der Whisky ausgetrunken.
Um 1 Uhr 10 sitzen die beiden Männer in Tebsters klapprigem Ford, und Morris fragt verdutzt:
„Warum sind wir eigentlich schon gegangen?“
Vera steht am Fenster und sieht ihnen nach. Die frische Luft tut ihr gut. Sie kann nicht einschlafen. Sie grübelt über der Aktengeschichte, bis ihr endlich der Schlaf die verworrenen Gedanken abnimmt …
Der Raum ist kahl und unfreundlich. Er besteht aus einem Tisch, zwei Stühlen und einer als Aschenbecher verwendeten Konservenbüchse. Er besteht weiter aus einer zu kurz bemessenen Gardine und dem Bild des amerikanischen Präsidenten an der Wand.
Ohne ein Zeichen von Ungeduld läßt Colonel Evans stundenlang die Erzählung des deutschen Häftlings Werner Eckstadt über sich ergehen. Er macht sich ab und zu Notizen und bedeutet gleichzeitig mit einer Handbewegung dem Untersuchungsgefangenen in der zerschlissenen Wehrmachtsuniform, weiterzusprechen.
Der Colonel kennt sich aus im Umgang mit Gefangenen. Gewöhnlich merkt er jedes Zögern, jede Beschönigung, jede Übertreibung, jede Lüge. Hinter seiner gleichgültigen Miene verbirgt sich gespannte Aufmerksamkeit. Der Oberst weiß, ohne es sich einzugestehen, daß er froh wäre, wenn er Werner Eckstadt bei einer Lüge fassen könnte … wenn diese ungeheuerlichen Vorwürfe gegen eine amerikanische Anklagevertretung, gegen eine offizielle Institution seines Landes, haltlos zusammenbrächen. So stellt er mit verborgenem Mißmut fest, daß er beginnt, dem armseligen Soldaten Glauben zu schenken.
Colonel Evans steht auf, geht an die Türe, winkt den an der Wand lehnenden GI heran.
„Holen Sie mir zwei Flaschen Coca-Cola“, sagt er.
„Yes, Sir“, antwortet er, „aber der Häftling darf kein Coca-Cola trinken.“
„Führen Sie gefälligst den Befehl aus!“ brüllt ihn der Colonel zusammen. „Und vergessen Sie die Gläser nicht.“
Der Soldat braucht zehn Minuten. Vermutlich hat er sich inzwischen noch beim Anstaltskommandanten beschwert. Er stellt unlustig die Gläser auf den Tisch, wirft im Vorbeigehen Werner einen bösen Blick zu. Der Oberst schenkt ein.
„Nehmen Sie“, sagt er zu Werner.
Und weiter geht die Vernehmung. Wieder dauert sie Stunden. Wieder kommt Werner alles kreuz und quer über die Zunge. Plötzlich verliert er die Nerven, springt auf, schreit:
„Hat ja alles keinen Sinn! Gehen Sie, Sir! Sie glauben mir nicht. Sie dürfen mir gar nicht glauben.“ Seine Augen sind starr. Blaue, eckige Adern treten an seiner Stirn hervor. Speichel sitzt in seiner linken Mundecke. Die Haare hängen ihm in die schweißnasse Stirne. „Das darf für Sie ja gar nicht wahr sein!“
Er plumpst auf den Stuhl zurück. Der Kopf sinkt auf seinen Arm. Das Geschrei geht in Röcheln über.
„Sie sind ja Amerikaner“, stößt er hervor. „Sie können mir ja doch nicht glauben!“
Der Oberst betrachtet die Szene kalt und distanziert. Er steht auf, geht an das Fenster, öffnet es, schließt es im nächsten Augenblick wieder, dreht sich um.
„Sie sind müde“, erwidert er, „ruhen Sie sich eine Stunde aus, dann komme ich wieder.“
Er ruft den Posten.
Werner Eckstadt wird in seine Zelle zurückgebracht. Für eine Stunde, für 60 Minuten, für 3600 Sekunden …
Werner Eckstadt läßt das Essen stehen. Seine Gedanken gehen im Kreise herum. Er schiebt angewidert die Schüssel mit dem grauen Fettbrocken zurück. Ich Idiot, denkt er verzweifelt, und da stoße ich den einzigen Menschen, der seit meiner Verhaftung mich wenigstens anhörte, vor den Kopf.
Blitzartig ziehen die Stationen der Hölle an ihm vorbei: die Versetzung zur SS, der Absprung mit dem Fallschirm, die Szene vor dem Tigerpanzer, der Angriff der „Lightnings“. Damals stand er mit Wieblich, dem Richtschützen, an der Waldschneise. Der Wind hatte die Wolkendecke endgültig aufgerissen. Der Himmel wurde zum Rangierbahnhof für amerikanische „Lightnings“. Wo immer sich Fahrzeuge zeigten, wo Soldaten in Gruppen beieinanderstanden, krepierten die Bomben der Flugzeuge.
„Aus der Bescherung sind wir ja rechtzeitig entwischt“, grinste Wieblich zufrieden. Der Mann begriff, was die deutsche Generalität, die mit der Ardennenoffensive den Krieg gewinnen wollte, nun auch einsehen mußte. Sowie die amerikanischen Tiefflieger wieder freies Schußfeld hatten, knallten sie den Weihnachtsangriff in tausend Fetzen.
Jetzt blieben die deutschen Panzer nicht nur wegen Spritmangels liegen. Das Ende des letzten deutschen Vorstoßes war ebenso rasant wie sein Beginn …
Auf den Straßen verendeten, brennend, zur Seite gekippt, die Panzer, die SPWs, die Sturmgeschütze, die Spähwagen. Nun spritzten die Körper zerfetzter deutscher Soldaten auseinander wie vor Stunden noch die ihrer Feinde.
Aber davon sahen Eckstadt und Wieblich zunächst nicht viel. Es entging ihnen auch etwas anderes. Sie wußten nicht, daß es immer noch wahnsinnige, anonyme Mörder gab, die, ihrem niedrigen, gemeinen Instinkt folgend, wahllos Menschen schlachteten … um wenigstens eine Erinnerung aus dem letzten deutschen Angriff mit nach Hause zu nehmen: die Erinnerung an die freigegebene Treibjagd auf Kriegsgefangene.
In diesen Tagen erschoß ein Oberscharführer zehn amerikanische Kriegsgefangene, mit denen er sich vorher unterhalten hatte …
In diesen Tagen knallten aufgesessene Infanteristen von Panzerfahrzeugen aus belgische Frauen nieder, die an der Dorfstraße standen …
In diesen Tagen wurden amerikanische Kriegsgefangene erschossen, weil sie verwundet waren und weil man sich nicht um sie kümmern wollte …
Und all diese Verbrechen tobten sich in einem engen Kreis um die belgische Stadt Malmedy aus.
Während dies geschah, füllten sich die Wälder mit versprengten deutschen Soldaten. Eckstadt und Wieblich blieben nicht lange allein. Erst war es ein kleiner Haufen, dann ein großer, schließlich ein halbes Bataillon. Auch Offiziere waren dabei.
Wenn Offiziere dabei sind, gibt es wieder Befehle. Eckstadt und Wieblich wurden auseinandergerissen. Werner Eckstadt war nicht traurig darüber. Er hoffte, dem Richtkanonier nie mehr wieder zu begegnen.
Er irrte sich …
Er gehörte nunmehr zu einem sogenannten „Rabbatzhaufen“, wurde erneut versprengt und wiederum mit anderen zusammengezogen, bis die Ardennenoffensive endgültig versickert war.
Dann kam er zu einem Ersatztruppenteil der SS nach Deutschland. Man hatte ihm diese Einheit während der Sonderausbildung in Sennelager ins Soldbuch eingetragen.
Er glaubte, daß jetzt die Gelegenheit gekommen sei, sich endgültig von der SS zu trennen. Er ließ sich beim Kompaniechef melden.
Der Hauptsturmführer hatte eine roten, feisten Nacken. Er trug die üblichen Auszeichnungen, hatte sich wohl aber inzwischen auf den Heimatkriegsschauplatz spezialisiert.
„Na, was ist mit Ihnen los?“ bellte er. „Urlaub gibt’s nicht, Herrschaften, das sage ich euch gleich …“
Werner verzog keine Miene.
„Jawohl, Hauptsturmführer“, antwortete er stur.
Der Kompaniechef hatte wasserblaue Schweinsaugen. Er zwinkerte nervös.
„Was wollen Sie dann?“
„Hauptsturmführer, ich bitte um Versetzung.“
„Was wollen Sie?“
„Ich bitte um Rückversetzung zur Wehrmacht.“
Der Hauptsturmführer legte die Hand an das fleischige Ohr.
„Was haben Sie da gesagt?“
Eckstadt holte tief Luft.
„Ich wurde vor sechs Monaten für einen einzigen Sondereinsatz zur SS versetzt … Mir wurde gesagt, ich käme anschließend wieder zum Heer. Ich bin Gefreiter bei der Panzerwaffe.“
Der Kompaniechef lief gleichzeitig blau und rot an.
„Was sind Sie?“ brüllte er. „Halten Sie ’s Maul! Gefreiter bei der Panzerwaffe? Sie haben wohl ’nen Furz gefrühstückt!“ Er bellte so laut, daß die Fensterscheiben leise klirrten. Dabei ging ihm die Puste aus.
„Hinlegen!“ brüllte er.
Werner zögerte einen winzigen Moment … Ist ja doch alles Scheiße, dachte er und warf sich auf den Fußboden.
„Auf!“ schrie der Hauptsturmführer. Er kam um seinen Schreibtisch herum. „Hinlegen! Auf! Hinlegen! Auf! Hinlegen! Auf!“
Dann ließ der Kompaniechef Werners Zugführer kommen.
„Diesen Defätisten schleifen Sie so lange, bis er nicht mehr weiß, ob er ’n Männchen oder ’n Weibchen ist!“
Der Hauptsturmführer sah Werner von oben bis unten an. Sein Ton wurde gefährlich leise:
„Sehen Sie sich ja vor! Mit Leuten wie Sie machen wir verdammt kurzen Prozeß! Wehrmacht, was? Bei uns wird Ihnen wohl der Boden zu heiß, wie? Sie Lump! Sie möchten sich wohl, bevor der Ofen ausgeht, noch ein Alibi sichern, he?“
Werners Kieferknochen mahlten.
„Ich habe nicht gesagt, daß der Krieg verlorengeht. Das haben Sie jetzt gesagt, Hauptsturmführer.“
Der Kompaniechef wurde spitz und blaß im Gesicht.
„’raus mit dem Kerl!“ brüllte er.
Werner zockelte hinter dem Zugführer her. Er nahm ihn, wie befohlen mit auf den Hof.
„Marsch! Marsch!“ leierte der Oberscharführer im tranigen Kommandoton.
Werner lief, nicht übertrieben schnell, quer über den Hof, an dem Geräteschuppen vorbei, immer weiter, bis er hinter sich „Achtung!“ hörte.
Er erstarrte zur vorgeschriebenen Säule, die Hände an der Hosennaht. Der Zugführer war hinter ihm hergelaufen. Sie waren jetzt außer Sicht des Kompaniegebäudes.
Der Oberscharführer grinste.
„Du hast den Arsch ganz schön auf, Mensch“, sagte er, „wie kannst du denn so was machen? Stell dir mal vor, zu dir kommt eener, wenn dein Boot am Absaufen ist, und sagt: Icke kann ja aussteigen, du nich! Da wirste ganz schön sauer, was … Mensch, denk doch! Die Amis sind am Rhein, und die hier, die können vor lauter Nervosität schon nicht mehr loofen.“
Der Oberscharführer wühlte in der Hosentasche und brachte ein Päckchen zum Vorschein.
„Zigarette?“ fragte er.
Eckstadt nickte.
„Danke.“ Seine Hände zitterten.
„Quatsch“, brummte der Oberscharführer.
Der Hauptsturmführer dachte sich für Werner eine Bestrafung aus, die selbst einem phantasielosen Offizier einfällt: er schickte ihn an die Front.
So wurde Werner einer der wenigen deutschen Soldaten, die sich im Durcheinander des Zusammenbruchs in Ungarn, in der Tschechoslowakei und schließlich in Österreich noch wohler fühlen als an einer anderen Front. Hier war er eine anonyme Nummer, die zusammen mit den Kameraden durch den Wolf gedreht wurde. Daraus würde man ihm später keinen Vorwurf machen können.
Im März 1945 beendete ein verirrtes Infanteriegeschoß für Werner vorzeitig den Krieg. Er landete in einem Lazarett in Bad Reichenhall.
„Na, diesen Krieg haben Sie überstanden“, sagte der Oberarzt. Er war von der Wehrmacht. Und der Schußbruch in Werners Oberarm war nicht von schlechten Eltern …
Werner lag in einem schneeweißen Bett und versuchte zu vergessen. Er hatte Grund genug, zu vergessen, und auch die Möglichkeit dazu fehlte ihm nicht … Denn die Gegenwart war betäubend nah. Die Gegenwart hieß Brigitte.
Sie war Schwester auf der Station. Sie trug aufreizende Strümpfe über aufreizenden Beinen. Sie war sehr zurückhaltend und sprach mit Werner Eckstadt grundsätzlich nur das Nötigste. Sie hatte große, graublaue Augen und enganliegende, schwarze Haare.
Wie schwarz ihre Haare waren, sah Werner eines Tages im Stationszimmer, wo Schwester Brigitte gerade ihre zierliche weiße Haube vor dem Spiegel aufsetzen wollte.
„Donnerwetter“, sagte er, „sind Sie hübsch!“
Sie fuhr herum. Sie musterte ihn kalt.
„Nicht für Sie“, erwiderte sie.
„Ja, ich weiß, daß Sie was gegen mich haben … Ich merke es schon die ganze Zeit. Warum eigentlich?“
Sie sah ihm fest in die Augen. Von unten nach oben breitete sich die Röte in ihrem Gesicht aus. Ihre Augen glänzten.
„Ihre Uniform gefällt mir nicht“, entgegnete sie fest.
„Oh …“, sagte Eckstadt. Er lächelte gequält. „Die SS-Uniform meinen Sie?“
„Mein Vater sitzt im KZ“, versetzte sie ruhig. „Er hat am Stammtisch einen Witz erzählt. Heimtücke … nennt man das wohl. Sie werden verstehen, daß ich keine Lust habe, mit seinen Bewachern zu flirten.“
Werner schluckte.
„Ich bin kein Bewacher Ihres Vaters … Ich könnte dort genauso sitzen.“ Er dachte daran, wie er sich beim Hauptsturmführer gemeldet und um Versetzung zur Wehrmacht gebeten hatte. „Ich habe mir die Uniform nicht ausgesucht. Man hat sie mir zugeworfen. Damit Sie es genau wissen: ich bin hineingepreßt worden.“
Er drehte sich um und ging.
Sie sah ihm nach.
Am Abend, als die Lampen ausgegangen waren, als das Lazarett schlief, stand sie plötzlich vor seinem Bett. Er spürte ihre Nähe, bevor er sie noch sehen könnte. Seine Hand griff ins Leere, dann faßte sie Brigittes Arm.
„Es tut mir leid“, flüsterte sie.
Er antwortete nichts. Der Druck seiner Hand wurde fester. Er fühlte, wie sie zitterte. Sie ist höchstens 20, dachte er.
Es lagen mindestens 15 Mann auf der Stube. Ein paar schnarchten, andere stöhnten im Traum vom Krieg. Es stank nach Eiter. Das Zimmer war überheizt. Sie saß auf seinem Bett. Er atmete ihren Duft, er zog sie an sich.
Ihre Lippen waren weich und zärtlich. Da zog er sie noch fester an sich. Sein verwundeter Arm hatte auf einmal Kraft. Freilich, hinterher schmerzte er. Aber in diesen langen, brennenden Sekunden spürte er es nicht.
Sie machte sich von ihm frei, stand auf, lächelte ihm zu. Wieder stöhnte einer im Schlaf. Wieder schrie einer um Hilfe, und hinten schnarchte der Doppelamputierte.
In diesem stinkigen, überheizten Raum, in dieser schmutzigen, traurigen Umgebung hatten sich zwei junge Menschen gefunden. Es war nur eine flüchtige Zärtlichkeit gewesen, aber Brigitte und Werner wußten von da an, daß sie zueinander gehörten.
Am nächsten Morgen kam sie wieder.
„Die Amerikaner sind in der Stadt“, raunte sie ihm zu. Sie hätte es auch laut aussprechen können. Jeder wußte es, und die meisten freuten sich darüber.
Am Abend huschte Brigitte wieder in den Saal.
„Du mußt hier ’raus, Werner“, sagt sie leise. „Die SS wird von den Amis in besondere Lager zusammengetrieben.“ Ihr Atem ging hastig, sie drängte. „Ich habe ein kleines Zimmer hier in Reichenhall … Wir warten nur noch die erste Aufregung ab. Dann kommst du zu mir.“
In dieser Minute hatte Werner alles vergessen. Wie er meinte, hoffte, glaubte, für immer. Aber die Hölle hatte ihm nur für ein paar Tage Urlaub erteilt …
Alles ging nach Brigittes Willen. Von einem Gang in den Waschraum kam Werner nicht mehr in das Krankenzimmer zurück. Sie hatte an alles gedacht. Sogar seine Papiere verschwanden aus der Schreibstube des Lazaretts.
Sie schmiedeten Zukunftspläne. Brigitte wollte weiter Medizin studieren. Und Werner wollte … irgend etwas, was ihnen zusammen ein glückliches Leben ermöglichen würde. Er lag tagsüber allein in ihrem Zimmer. Am Abend kam sie, strich mit ihren zärtlichen Händen über sein heißes Gesicht. Sie war gleichzeitig Ernährerin, Krankenschwester und Geliebte.
Aber vor dem neuen Leben lag eine Hürde. Je mehr Werner der Genesung entgegenging, desto öfter dachte er daran. Er mußte wieder in die Legalität zurück, Papiere bekommen, offiziell aus der Wehrmacht entlassen werden … aus der Wehrmacht, nicht aus der SS!
„Ich werde mich melden“, sagte er eines Tages zu Brigitte.
„Warum?“ Ihre Augen wurden ängstlich. „Sie werden dich in ein Lager stecken.“
„Das tun sie so oder so“, antwortete er, „und es ist besser, ich komme freiwillig, als daß sie mich eines Tages holen. Verstehst du? Im Lager werde ich nicht ewig sitzen. Sie haben ja viel zu viele geschnappt. Sie entlassen schon die Landarbeiter und Jugendlichen. Na, da bin ich eben Landarbeiter.“
Brigitte senkte den Kopf. Er hatte ja recht. Aber es war ihr nicht wohl dabei. Zwei Tage blieb er noch. Zweimal 24 Stunden.
Er ging, wie er meinte, für höchstens drei Wochen …
Brigitte weinte nicht.
„Geh schnell … bitte, geh schnell!“ Dann krampfte sie die Hände ineinander.
Er stellte sich auf der amerikanischen Stadtkommandantur. Die Amis waren nicht unfreundlich. Aber sie behielten ihn gleich da. Mit 50 anderen PWs wurde er auf einem riesigen Truck in das Kriegsgefangenenlager nach Bad Aibling gefahren.
Seine Wunde eiterte. Er mußte zum Arzt. Zu einem amerikanischen Arzt. Der Gipsverband wurde aufgeschnitten.
Der Captain zögerte eine Sekunde, starrte auf die Wunde, säuberte sie eingehend mit Alkohol, verband sie frisch. Er sagte kein einziges Wort dabei. Wenigstens zu Werner Eckstadt nicht …
Am Nachmittag wurde sein Name über den Lautsprecher ausgerufen. Er mußte zum Kommandanten, einem Major. Hinter dem Kommandanten ein Mann in olivgrüner Uniform ohne Rangabzeichen.
Sechs Augen musterten ihn streng. Der Dolmetscher saß geschäftig in einer Ecke, aber Werner winkte ab. Er sprach ja perfekt Englisch. Es machte keinen Eindruck auf den Kommandanten …
„Sie sind kein Soldat der Wehrmacht“, begann er, „Sie sind SS-Mann.“
„Wollen Sie das leugnen?“ schoß der Uniformierte ohne Rangabzeichen sofort hinterher, weil er bemerkte, daß Werner angestrengt nachdachte.
„Ich war bei der Wehrmacht“, entgegnete Werner zögernd.
Was sollte ihm passieren? Wer sollte beweisen, daß er tatsächlich bei der SS war? Schließlich hatte die Kugel das Brandmal auf seinem Oberarm … das Blutgruppenzeichen, ausgelöscht. Auch Brigitte hatte ihm bestätigt, daß nichts mehr zu sehen sei.
Ein grausamer Zufall: der Blutgruppenstempel war seitlich der Wunde von Gipsresten verklebt. Deshalb hatte ihn Brigitte nicht sehen können.
„Wenn Sie weiterlügen“, fuhr ihn der Arzt an, „schneiden wir Ihnen den Verband noch einmal herunter.“
„Wie hieß Ihre Einheit?“ bellte ihn der Uniformierte ohne Rangabzeichen an.
„Sagen Sie die Wahrheit!“ drohte der Kommandant.
Aus, dachte Werner, bleib bei der Wahrheit, das ist noch das beste. Den Kopf werden sie dir nicht herunterreißen.
„SS-Division Leibstandarte“, erwiderte er leise.
„Gut, daß Sie nicht leugnen“, sagte der Lagerkommandant versöhnt. Für ihn war die Sache erledigt. Er verteilte Befehle, und er führte Befehle aus. Einer dieser Befehle lautete, den Leuten auf den Oberarm zu sehen.
Aber die Augen des Uniformierten ohne Rangabzeichen verengten sich.
„Oh …“ Er zog den Ton genießerisch in die Länge, „ich bin von der CIC“, fuhr er fort. „Sie wissen wohl nicht, was das ist.“ Er lachte. „Sie werden es noch kennenlernen.“
Es war still. Der CIC-Mann zündete sich eine Zigarette an. Er warf Werner das Streichholz vor die Füße und wendete sich an den Kommandanten.
„This guy has to be arrested …“ Dieser Bursche muß verhaftet werden!
Der Dolmetscher übersetzte es. Aber Werner hatte es sofort verstanden.
Brigitte, dachte er, und schnelle, silbrige Funken tanzten vor seinen Augen. Er sah durch sie hindurch, sah ihren Kopf, ihre Augen, ihr Lächeln. Lautlos formten seine Lippen ihren Namen.
„Verhaftet!“ wiederholte der Dolmetscher noch einmal.
Werner Eckstadt hatte ein Gefühl, als ob er den Magen aus dem Unterleib verlöre …