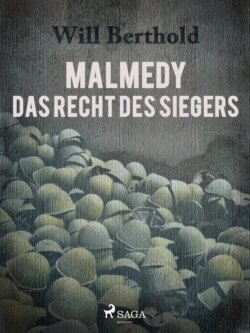Читать книгу Malmedy - Das Recht des Siegers - Will Berthold - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. kapitel
ОглавлениеDraußen scheint die Sonne. Kecke, warme Strahlen fallen durch das kleine Fenster, bahnen eine Lichtgasse quer durch den trostlosen Raum, in dem schon Hunderte, Tausende standen, um ihr Leben kämpften, logen, verzweifelten, die Wahrheit beteuerten … voll tödlicher Angst, voll bodenlosen Hasses, voll stumpfer Verzweiflung, voll sinnloser Hoffnung.
Denn der Boden, auf dem das Vernehmungszimmer steht, ist blutig. Der Raum ist inmitten des Konzentrationslagers von Dachau. Die Uniformen der Bewacher haben sich gewandelt. Die Vernehmungsmethoden auch. Das wenigstens hofft Oberst Evans, der Chefverteidiger des Malmedy-Prozesses. Er hofft es noch immer, obwohl es ihm während der Erzählung Werner Eckstadts abwechselnd kalt und heiß überläuft. Aber er läßt sich nichts anmerken. Ruhig und gelassen sitzt er, Stunde um Stunde, jetzt den zweiten Tag schon, auf seinem unbequemen Holzstuhl. Die klugen, wachen Augen des Offiziers lassen den Angeklagten nicht einen Augenblick los …
Und weiter berichtet Werner Eckstadt, manchmal stokkend, manchmal schnell, mitunter heftig und dann wieder leise, verloren, verzweifelt. Fahl und grau ist sein Gesicht, flattrig sind die Hände, fiebrig die Augen. Er wühlt in seiner Vergangenheit …, und er kämpft dabei um seinen Kopf. Stück um Stück bricht er aus der Verschwörung des Zufalls heraus, oft scheint er dabei so fern zu sein, als ginge ihn alles nichts an, dann wieder spürt er die Nähe des Galgens, und das Grauen peitscht ihn vorwärts …
Wochenlang kauerte er auf seiner Pritsche und erlebte wieder und wieder die letzten Jahre und Monate, sah wieder und wieder die kalten Augen des CIC-Mannes, der ihn aus dem Kriegsgefangenenlager aufgefischt hatte, und hörte seine Stimme, die immer wieder sagte: „That’s all“ … Das wär’s.
Dann wurde die Tür aufgestoßen. Zwei Militärpolizisten mit blauen Armbinden traten grinsend ein. Der CIC-Mann schnippte mit den Fingern in Richtung auf Werner. Die Uniformierten gingen auf ihn zu. Der eine der beiden hatte von der reichlichen amerikanischen Heeresverpflegung so viele violette Äderchen im Gesicht, daß seine Backen aussahen wie frisch geöffnete Büchsen Cornedbeef. Seine wasserhellen Augen waren gewöhnt, Menschen als Insekten anzusehen. Er schlenkerte einen Holzknüppel in der Hand und sagte lässig: „Let’s go!“
Dann gingen sie über die Straße des Kriegsgefangenenlagers Bad Aibling. Tausende deutscher Soldaten mit dem weißen PoW auf dem Rücken drängten sich zwischen den Baracken. Es war die Stunde der täglichen Promenade. Man tauschte die Latrinenparolen aus und verkaufte Orden gegen Zigaretten. Werner fing ihre Blicke auf, mitleidige Blicke, mißtrauische Blicke, gleichgültige Blicke. Einer rief ihm zu: „He, Kumpel, was hast du ausgefressen?“
Werner drehte den Kopf. Im gleichen Augenblick fühlte er einen stechenden Schmerz in der rechten Niere. Das Cornedbeef-Gesicht hatte zugeschlagen. Wortlos, aber gekonnt. Werner Eckstadt verfärbte sich. Schweiß lief über seine Stirne. Er ging keuchend weiter.
Sie sperrten ihn in einen Käfig inmitten des Lagers. Hier wurden Verstöße gegen die Lagerdisziplin bestraft. Man mußte bis zu zehn Stunden aufrecht, ohne Wasser und Brot, stehen, ob es regnete, ob die Sonne herabbrannte. Der Platz war kaum größer als ein Quadratmeter. Als sie Werner wieder abholten, hing er kraftlos in den Stäben. Sein verwundeter Oberarm brannte wie Feuer, und seine Zähne klapperten im Schüttelfrost aufeinander.
Sie warfen ihn auf einen Armeelastwagen. Der Lkw rumpelte durch Süddeutschlands sonnengleißende Frühsommerlandschaft. Der Wagen war mit menschlicher Fracht überfüllt. SS-Leute aller Dienstgrade und aller Einheiten, wahllos nebeneinander, Menschen und Schweine.
An Sitzen war in dem überladenen Wagen nicht zu denken. Zwei mitleidige Gefangene ließen Werner zwischen sich auf den Boden gleiten. Er sah nur noch Beine. In seinem Fieberdelirium verwandelten sich die Drillichhosen der Mitgefangenen in bemooste Baumstämme, und wenn der Lkw eine Kurve ausfuhr und die zusammengepferchten Soldaten auf die Seite fielen, dann glaubte Werner Eckstadt, Waldlichtungen zu sehen. Dann wieder wurden die Beine seiner Kameraden zu einer Revue von Chorgirls … und plötzlich sah er Brigitte. Er sah sie ganz deutlich, und er stöhnte. Er wollte seine Arme nach ihr ausstrecken, aber ein genagelter Schuh trat ihm auf die Finger. Da begriff er, daß es vergeblich war, nach ihr zu fassen, daß jede Radumdrehung dieses Lkws ihn weiter von ihr fortführte …
Die Fahrt endete vor dem Gefängnis einer Kleinstadt. Als sie ausgeladen und durch ein Spalier von Militärpolizisten geführt wurden, rief einer von ihnen einem Passanten zu: „Wo sind wir?“
Er erhielt dafür den Lauf einer Maschinenpistole ins Kreuz. Aber der Passant rief zurück: „Schwäbisch-Hall.“
Über dem Portal des Gefängnisses hing ein großes Schild mit einem flammenden Schwert auf blauem Grund, und darüber stand „War Crimes Division“, „Kriegsverbrecherabteilung“.
Werner kam in Einzelhaft. In der Ecke stand eine Pritsche. Daneben als Klosett ein stinkender Eimer. An der Zellentüre war ein Guckloch, und dahinter meinte Werner Eckstadt Cornedbeefs wasserhelle Augen zu sehen.
Plötzlich rasselte die Türe. Und der Mann stand in der Zelle.
„Nix schlafen!“ sagte er und ließ den Knüppel pendeln.
Werner taumelte hoch. Cornedbeef grunzte befriedigt. Er spuckte bräunlichen Tabaksaft aus seinem Mund und ging grinsend hinaus.
Werners Arm brannte noch immer wie Feuer, aber er erholte sich langsam von der Strapaze des Stehkäfigs. Zunächst schien sich kein Mensch um ihn zu kümmern. Werner fragte sich, was die Amerikaner mit ihm vorhatten. Ob sie etwas von mir wissen, dachte er verzweifelt! Und er erlebte immer wieder die Nacht, da er in amerikanischer Uniform hinter den alliierten Linien abgesprungen war. An den Tag danach, als er im Panzer über die Straßenkreuzung bei Malmedy fuhr, dachte er nicht. Er wußte ja noch immer nichts von der entmenschten SS-Treibjagd auf wehrlose Kriegsgefangene. Und er wußte nicht, daß man ihn dafür mitverantwortlich machen würde.
Einmal kam er auf dem Gang mit anderen Häftlingen zusammen.
„Bei welcher Einheit warst du?“ fragte ihn ein Oberscharführer.
„SS-Division Leibstandarte.“
„Dann waren wir bei der gleichen Division“, erwiderte der Mann.
Werner machte ein unbehagliches Gesicht.
„Ich war nur kurz dabei …“
„Nur zum Schluß?“ fragte der Oberscharführer. „Bei der Ardennenoffensive?“
„Ja“, nickte Werner.
„Da war ich auch. Bei welchem Haufen bist du denn gewesen?“
„Bei der Vorausabteilung der Vorhut.“
„Ach nee“, lachte der Oberscharführer, „genau wie ich … Warum hast du Wehrmachtsuniform an?“
„Ich lag im Lazarett. Sie hatten keine andere Uniform“, erwiderte Werner. Was sollte er ihm auch alle Einzelheiten auf die Nase binden.
„So“, sagte der Mithäftling ganz freundlich, „wir dachten schon, du wolltest von unserem Haufen nichts mehr wissen. Es gibt auch solche Brüder …“
Werner schwieg. An diesem Tag brachte man ihm eine K-Ration, die amerikanische Kampfverpflegung für Soldaten im Einsatz. Je drei Mann erhielten einen Karton, der acht Kekse, zwei Beutel Nescafe, ein Büchschen gesalzener Butter, vier Zigaretten, eine winzige Dose Wurst und einen Streifen Früchtebrot enthielt. Die Zigaretten waren herausgenommen, und Wasser gab es auch nicht.
Nach vier Tagen, als Werner gelernt hatte, mit zwei Keksen am Tage auszukommen, holte ihn ein Feldwebel, mit Pickeln im Gesicht, ab. Hinter ihm stand Cornedbeef. Er riß die Augen auf, als er merkte, daß Werner fließend Englisch sprach. Während sie über den Gang gingen, sagte der MP-Soldat:
„Du sprichst Englisch, du Schwein?“ Ohne eine Antwort abzuwarten, setzte er hinzu: „Das ist großartig. Da können wir uns wenigstens noch unterhalten dabei. Das macht mehr Spaß …“
Der Raum, in den Werner Eckstadt geführt wurde, hatte nur einen Schreibtisch, zwei Stühle und an der einen Wand die amerikanische Flagge. Zu Werner Eckstadts Erleichterung hatte sich Cornedbeef gar nicht mit ihm zu unterhalten, sondern mußte ihn nur abliefern. Durch eine Türe von nebenan erschien ein amerikanischer Offizier mit einem sonnverbrannten Gesicht, schweren, müden Augenlidern, die verquollen aussahen, als ob er geweint hätte. Mit einer Handbewegung entließ er den blassen Feldwebel und Cornedbeefs Wachkommando.
Als er mit Werner Eckstadt allein im Raum war, lächelte er gewinnend.
„Rauchen Sie?“ Er sprach in jenem fließenden Deutsch, das später in den Sendungen der „Voice of America“ so oft zu hören war. Ein Deutsch, das mit seinem singenden Unterton keinen Zweifel darüber lassen sollte, daß der Sprecher Amerikaner ist. Echter Amerikaner …
„Ich heiße Prince. Leutnant Prince“, sagte der amerikanische Offizier mit dem gleichen gewinnenden Lächeln. Werner Eckstadt nahm die Zigarette aus der gebotenen Packung. Als er den ersten Zug inhalierte, wurde ihm leicht schwindlig.
„Lügen haben kurze Beine“, fuhr Leutnant Prince fort, „ich hoffe, daß Sie uns jetzt die Wahrheit sagen werden … Alles andere hätte sowieso keinen Sinn. Wir wissen genug. Sie können Ihre Lage nur verschlechtern …“
Werner Eckstadt schmeckte die Zigarette nicht mehr. Auf diesen Überfall mitten aus dem gewinnenden Lächeln heraus war er nicht gefaßt. „Wir wissen sowieso schon genug“, dieser Satz stieg drohend vor ihm auf. Jeden Augenblick mußte es kommen, dachte er. Jeden Augenblick wird er dir auf den Kopf Zusagen, daß du versucht hast, als Partisan gegen die Amerikaner zu kämpfen.
„Sie waren bei der SS-Division Leibstandarte?“ fragte Prince.
„Ja.“
„Bei welcher Waffengattung? Bei welcher Abteilung?“
Werner Eckstadt wußte: dies ist die entscheidende Frage. Aber er konnte die Wahrheit nicht sagen. Er konnte nicht sagen, daß er in amerikanischer Uniform abgesprungen war, das hätte augenblicklichen Selbstmord bedeutet – nach seiner Meinung. Da war es besser, die Einheit von Obersturmführer Klausen zu nennen, der ihn aufgelesen hatte.
„Ich war bei der Vorhut“, antwortete Eckstadt zögernd. Hoffentlich glaubt er es, dachte er. Leutnant Prince glaubte es aufs Wort. Er war geradezu überrascht.
„Sie scheinen vernünftig zu sein“, lächelte Prince. Er öffnete eine Schreibtischschublade und zog eine Landkarte heraus, die er Eckstadt entgegenhielt. Sein manikürter Finger fuhr in die Gegend von Malmedy.
„Sind Sie am 17. Dezember 1944 hier über diese Straßenkreuzung gekommen?“
Werner Eckstadt kniff die Augen zusammen. In dem späteren Hin und Her des Ardennenkampfes hatte er die Gegend ganz gut kennengelernt. Er orientierte sich nur kurz.
„Ja“, antwortete er mit großer Erleichterung, daß er nichts anderes gefragt wurde. Die Amis wollten offenbar nur die damaligen Kämpfe rekonstruieren …
„An der Kreuzung haben Sie Gefechtsberührung gehabt?“
„Ja. Das stimmt. Mit einer amerikanischen Nachschubkolonne.“ Eckstadt sprach nahezu eifrig.
Der amerikanische Leutnant lehnte sich weit zurück, verschränkte die Arme.
„Die Amerikaner haben sich bei diesem Gefecht ergeben, nicht wahr?“ fragte er lauernd.
„Ja.“
Der Offizier wurde plötzlich ernst, und die Frage kam sehr schnell:
„Und warum habt ihr unsere Leute trotzdem erschossen?“
Werner Eckstadt sah den Offizier verständnislos an.
„Wir haben keine Gefangenen erschossen. Wir haben nur so lange geschossen, so lange Gegenwehr geleistet wurde …“ Eckstadt war entgeistert und empört zugleich.
„Ach so …“, sagte Leutnant Prince durch die Nase. „Das ist die beste Ausrede, die ich bisher gehört habe. Sie behaupten also, die ganzen Morde an der Straßenkreuzung seien noch im Kampf passiert. Damit wären Sie natürlich aus dem Schneider …“ Der Leutnant sah gelangweilt auf seine Fingerspitzen. „Leider oder Gott sei Dank haben wir für das Gegenteil Zeugen …“
Werner Eckstadt verstand bald nicht mehr, wovon gesprochen wurde. Er rauchte hastig die letzten Züge der Zigarette.
„Wir haben keine Gefangenen umgebracht“, betonte er noch einmal.
Der Leutnant sah ihn unter müden Lidern gleichgültig an.
„Ich weiß nicht, für wie dämlich Sie uns halten … Sie selbst haben zugegeben, daß Sie bei der Vorhut waren. Und was Ihre saubere Vorhut angerichtet hat, das weiß die ganze Welt inzwischen. Das wird von keinem Menschen mehr bestritten, nicht einmal von Ihren eigenen Kameraden. Es dreht sich nur darum, wer was getan hat – weil, wenn wir Ihren Leuten glauben, kein Mensch der Vorhut einen Amerikaner umgebracht hat, aber alle zugeben, daß Amerikaner umgebracht worden sind …“ Der Offizier hatte einen angeekelten Zug um die Mundwinkel.
„Ich war nicht direkt bei der Vorhut“, sagte Eckstadt leise, „ich war bei der Vorausabteilung der Vorhut …“
„Kommen Sie! Kommen Sie! … Auf einmal! Auf einmal merken Sie, daß Sie aufs Glatteis geraten.“
Werner Eckstadt hatte noch selten in seinem Leben ein menschliches Gesicht sich so schnell verändern sehen. Der Leutnant lief nicht rot, sondern gelb an. Er sprang auf und schrie:
„Ein Lügner sind Sie! Ein Dreckschwein! Ein verdammter deutscher SS-Bastard! … Stehen Sie auf, wenn ich mit Ihnen spreche!“ brüllte er im reinsten Kommisdeutsch.
Bei dem Geschrei hatte Werner Eckstadt gar nicht gehört, wie das Wachkommando ins Zimmer kam, Cornedbeef allen voran.
„Legen Sie die Hände an, wenn ich mit Ihnen spreche!“ schrie der Leutnant. „Wenn ihr auf unseren Ton nicht hört, versteht ihr vielleicht euren eigenen …“
Weil Werner Eckstadt den verwundeten, verbundenen Arm nicht gerade an die Hosennaht legen konnte, traf ihn der Knüppel Cornedbeefs mit voller Wucht. Eckstadt schrie auf. Er dachte, der Arm sei ihm abgeschlagen worden.
„Sie werden uns kennenlernen“, brüllte der Leutnant. „Demokraten sind wir nur mit Demokraten. EureMethoden sollt ihr, wenn es sein muß, am eigenen Leib erfahren …“
Werner sollte erleben, daß der Leutnant nicht übertrieben hatte. Noch in der gleichen Nacht wurde er zum nächsten Verhör herausgerissen. Der Leutnant schien keine Müdigkeit zu kennen. Das Verhör begann genauso freundlich wie das erste. Genau an der gleichen Stelle lief es wieder fest. Genau dort, wo Werner Eckstadt wiederum beteuerte, nicht an Erschießungen von Amerikanern beteiligt gewesen zu sein. Nur was dann kam, wurde schlimmer. Leutnant Prince schrie zwar nicht. Aber er rief Cornedbeef herein.
„Bringen Sie den Mann zurück zur Zelle!“ befahl er. Dann drehte er sich um.
Cornedbeef brachte Eckstadt nicht direkt in die Zelle. Er brachte ihn erst in einen anderen Raum, der Doppeltüren hatte.
„Wenn du es dem Leutnant nicht sagen willst, daß du unsere Jungens massakriert hast, dann willst du’s mir vielleicht sagen?“
Eckstadt schwieg.
„Nein?“ fragte Cornedbeef bedauernd.
Eckstadt sah ihn an. Der Sergeant sah Eckstadt an. Und ganz ruhig haute er ihm mit dem Knüppel wieder auf den Oberarm.
Eckstadt stöhnte auf.
„Was willst du? Ich schlage nicht sehr stark …“ Und wie zur Bekräftigung versetzte Cornedbeef ihm noch einen mittleren Schlag auf den verwundeten Arm. Aber der Schlag genügte, um Werner Eckstadt das Gefühl zu geben, den Arm wieder und wieder gebrochen zu bekommen.
„Dein Arm ist beschissen!“ meinte Cornedbeef und schlug wieder drauf. „Du solltest ihn dir amputieren lassen“, riet er Werner freundlich und schlug noch einmal zu. „Ich könnte das auch. Brauchst gar keinen Arzt!“ Und noch einmal holte er aus. Mit aller Kraft.
Werner Eckstadt rutschte an der Wand herunter, gegen die ihn Cornedbeef gestellt hatte. Der Militärpolizist stieß ihn an.
„Steh auf!“ sagte er gleichmütig.
Werner sah schwarze Kreise. Dann bemerkte er nichts mehr.
Das nächste, was er wieder sah, war Leutnant Prince. Der Offizier lächelte.
„Warum nicht gleich so, Eckstadt?“ fragte er.
Werner Eckstadt erbrach sich.
Der Leutnant hielt ihm ein Papier vor. Werner tanzten die Buchstaben vor den Augen.
„Unterschreiben Sie Ihr Geständnis?“
„Kein Geständnis“, murmelte Eckstadt.
Der Leutnant lachte.
„Sie haben eben dem Sergeanten alles zugegeben … Warum stellen Sie sich nur bei mir so an?“
„Ich habe nichts zugegeben“, entgegnete Eckstadt mühsam.
Da bekam er einen Schlag auf den Oberarm.
„Willst du behaupten, daß ein Amerikaner lügt!“ schrie Cornedbeef.
Und für Werner Eckstadt wurde es zum zweitenmal Nacht.
Man zerrte ihn in die Zelle zurück. Cornedbeef hatte ihn sich halb über die Schulter gehängt. Er kniff ihn unterwegs dreimal so infam in die Nase, daß Werner Eckstadt die Tränen kamen.
Wann immer Werner eine Minute Zeit zum Überlegen hatte, zwischen den Folterungen der Anklagevertretung, zwischen der Qual der eigenen Gedanken, überlegte er wieder und wieder: wie kommen sie dazu, sich wie ein Haufen wildgewordener Faschisten zu benehmen? Wie kommen sie dazu, Hitlers Methoden zu übernehmen? Er hatte sich nach der Demokratie, die er nicht kannte, gesehnt. Und die Enttäuschung, die er jetzt, buchstäblich am eigenen Leib, erfuhr, schien ihm noch größer zu sein als die körperliche Qual. Er dachte dabei nicht an Cornedbeef. Typen dieser Art gibt es in allen Ländern, in allen Uniformen … sadistische, erbärmliche, geborene Mörder, manchmal leider auch in einer Demokratie.
Nein, diesen Schläger zog er nicht in seine Überlegungen ein. Was aber veranlaßte den zwar farblosen, aber sicherlich korrekten Leutnant Prince, solche Methoden nicht nur zu dulden, sondern noch anzuregen?
Von Hauptscharführer Müller wußte Werner nichts. Vielleicht hätte das Wissen um dessen Tat den Kreislauf seiner verzweifelten Gedanken beendet. Er hätte das Benehmen seiner Peiniger wenigstens begreifen können. Verstehen schon, entschuldigen vielleicht, billigen natürlich nicht …
Als Müller als einer der ersten Untersuchungsgefangenen in das Vernehmungszimmer geführt wurde, kannte Leutnant Prince genau sein Verbrechen. Ein Verbrechen ohne Beispiel. Damals, an der Straßenkreuzung bei Malmedy …
Eben hat das Massaker begonnen. Dutzende von Amerikanern fliehen um ihr Leben. Aber die Mörder lachen nur. Einige GIs laufen auf den Wald zu, die meisten fallen, noch bevor sie ihn erreichen. Nur Leutnant Johnson, ein drahtiger, junger Offizer aus New York, kommt weiter. Aber hinter ihm ist Hauptscharführer Müller. Die Todesangst treibt den Leutnant vorwärts. Er wenigstens hat eine Chance, zu entkommen. Aber er stolpert über eine Baumwurzel und bleibt liegen.
Da ist schon der Verfolger neben ihm. Johnson kommt langsam hoch, hebt die Hände in die Höhe. Sein aschfahles Gesicht zuckt, seine Augen bitten, seine Lippen bewegen sich wortlos. Abseits vom Gemetzel stehen sich zwei Menschen gegenüber. Und der Leutnant fällt auf die Knie, hebt die Hände. Die Todesangst gibt ihm Worte. Er betrachtet seinen Verfolger … ein Gesicht, zwei Augen, ein Mund, eine Nase, Hände, ein Herz … das alles hat der Hauptscharführer. Äußerlich gesehen ist er ein ganzer Mensch. Nichts wurde vergessen. Nichts, außer einer Spur von Gewissen.
„Ich habe zwei Schwestern“, stammelte der Leutnant, „und eine alte Mutter … Sie lebt von mir. Wenn Sie mich erschießen …“
„Pistole“, sagt Müller.
Mit zittrigen Händen macht sie Johnson los und übergibt sie ihm.
„Ich bin nicht freiwillig in den Krieg gezogen“, fährt der Amerikaner fort, „so wenig wie Sie.“ Seine Worte überschlagen sich. Er spricht Englisch. Müller versteht mehr seine Gebärden als seine Worte.
„Brieftasche“, sagt er.
„Ich bin Arzt … Ich werde es. Sobald der Krieg aus ist.
Nur ein Examen fehlt noch.“
„Armbanduhr“, sagt der Hauptscharführer.
In der ersten Sekunde begreift es der Leutnant nicht. Dann reißt er sich die Uhr vom Arm, lächelt irre dabei, denkt, hofft: alles ist gut, der Mann will nur die Uhr, nicht das Leben. Hundert Uhren will ich ihm geben, ein Leben lang würde ich für Uhren arbeiten und sie ihm geben. Nur meine Mutter soll nicht weinen. Nur meine Schwestern sollen nicht allein sein.
Der Oberscharführer grinst. Er fuchtelt mit der Pistole herum. Kaliber neun Millimeter, „Smith & Wesson“. Er schiebt den Entsicherungsflügel zurück und wieder vor. Er spielt damit wie ein Kind mit einem Feuerzeug.
„Zigaretten“, sagt er dann.
Hastig langt der Leutnant in die Tasche, gibt ihm ein Päckchen.
Der Oberscharführer zündet sich eine Zigarette an, grinst immer noch, betrachtet die Uhr, durchstöbert die Brieftasche, nimmt ein paar Dollarscheine heraus, schiebt sie ein.
Noch immer knallt es in naher Ferne. Noch immer flehen Menschen vergebens um das Leben. Noch immer werden sie von Panzern, deren Besatzungen zum Schießen zu faul sind, in die Mitte genommen und zu Brei zerrieben.
„No“, schreit der Leutnant, „no!“
Müller geht ganz nahe an ihn heran. Er zeigt dem Offizier die eigene Pistole, läßt wieder den Sicherungsflügel zurückklinken, hebt die Pistole an die Schläfe von Leutnant Johnson, grinst immer noch, läßt sich Zeit, zieht noch einmal an der Zigarette, blinzelt gegen die Sonne, freut sich über das Gestammel seines Gefangenen, lacht schallend … und drückt ab.
Daneben, das erstemal. Daneben, das zweitemal. Absichtlich. Grinst immer noch.
Dann erst macht er Schluß mit ihm.
Die Sache hat ihm Spaß gemacht. Sein Gesicht weist das aus. Er lächelt noch immer. Deutlich können ein paar belgische Waldarbeiter seine verzogene Fratze sehen, die ganz in der Nähe standen, die Szene verfolgten und sich das Gesicht des Mörders einprägten. So wurde er überführt, ohne es zu wissen.
Deshalb läßt Leutnant Prince den Militärpolizisten Cornedbeef mit dem Holzschlegel wahllos auf die Untersuchungsgefangenen eindreschen, bis, wie bei Werner, die Wunde aufbricht, bis der Arm abzufallen droht. Der Leutnant glaubt, daß er im Recht ist dabei. In einem barbarischen Recht.
Dieser Mörder Müller behauptet, unschuldig zu sein.
Das gleiche beteuert Werner Eckstadt.
Das sagen alle Untersuchungsgefangenen.
Hauptscharführer Müller wird gestehen. Die Wahrheit.
Seine Mitgefangenen werden auch gestehen. Verbrechen, die sie nie begingen.
So kommt Leutnant Prince ans Ziel: so glaubt er wenigstens, am Ziel zu sein. Denn, daß unter den Kriegsverbrechern Unschuldige sind, daß sogar die Mehrzahl von ihnen nichts mit dem Massaker zu tun hat, daran denkt er nicht.
Er denkt nur an Leutnant Johnson …
Während Werner in dem Vernehmungszimmer von Dachau dem wortlosen Oberst Evans das Unfaßbare berichtet, während dem Chefverteidiger dabei der Ekel langsam hochkriecht … Ekel vor den Untersuchungsmethoden seines eigenen Landes, fährt ein alter, klappriger Ford mit amerikanischer Nummer über die Autobahn München–Salzburg. Der lange, schlaksige Leutnant Tebster sitzt am Steuer, neben ihm Vera Eckstadt, hinter ihr Leutnant Morris.
Der Himmel ist wolkenlos blau. Die Sonne streichelt die Erde. Ein Tag, wie er eigens für Ausflüge junger, übermütiger Menschen geschaffen scheint. Rechts liegen im Dunst des schönen Wetters die Berge. Und weiter rollt der Wagen. Die drei jungen Leute im Auto schweigen. Jeder denkt vor sich hin … ohne einen Blick für die Landschaft, für die friedlichen Berge, für den blauen Himmel. Das Ziel ist Bad Reichenhall. Hier wohnt Brigitte, wenn man so will, Werners Braut …
Kurz nach Rosenheim überholt Tebster eine Armeekolonne. Ein paar GIs winken Vera lärmend zu. Tebster gibt Gas. Ich liebe sie, denkt er. Und ich werde sie erobern. Stück um Stück. Und ich will sie mit nach Amerika nehmen. Sie soll meine Frau werden … Aber ich kann nichts machen. Ich darf mich ihr nicht nähern, solange die Sache mit ihrem Bruder nicht in Ordnung ist. Und Tebster gibt noch einmal Gas.
Ein solches Mädchen muß die Schwester eines Kriegsverbrechers sein, denkt Leutnant Morris verbittert. Und dann muß ich mich noch in sie verlieben. Und dann muß ich Assistent von Colonel Evans sein, der unbestechlich ist, auch Gefühlen gegenüber. Und ich verspreche ihr, zu helfen. Und dabei kann ich es gar nicht. Eine Sprechkarte vielleicht. Aber wird es nicht noch schlimmer, wenn sie ihren Bruder noch einmal sieht, bevor er hingerichtet wird?
„Wir müssen jetzt rechts herunter“, sagt Vera.
Der Wagen hat die Ausfahrtstraße nach Reichenhall erreicht. Vera weiß wenig von Brigitte. Das Mädchen hätte sich längst bei ihr melden müssen. Vielleicht ist es völlig sinnlos, sie aufzustöbern. Aber Vera weiß, wie verzweifelt Werner ist. Wenn er Brigitte wiedersieht, wenn er ihr noch einmal begegnet, vielleicht gibt ihm das mehr Mut, mehr Zuversicht. Denn in ein paar Tagen beginnt der Prozeß. Und wenn Werner sich selbst aufgibt, ist alles vergeblich.
Sie erreichen das Lazarett. Brigitte arbeitet hier immer noch als Schwester. Flankiert von ihren beiden Begleitern fragt sich Vera nach Brigitte durch. Sie werden in das Wartezimmer gewiesen. Schwester Brigitte ist bei einer Operation. Nach einer halben Stunde betritt das Mädchen mit den blauen Augen und den dunklen Haaren das Zimmer.
„Ich bin Werners Schwester“, beginnt Vera.
„Ich habe von Ihnen gehört“, versetzt Brigitte. Sie ist blaß und schmal, wirkt überarbeitet, gibt Vera die Hand, ohne sie dabei anzusehen.
„Ich brauche Ihre Hilfe“, fährt Vera fort. „… Sie lieben doch Werner. Und er ist so verzweifelt. Es kommt jetzt darauf an, welche Figur er bei dem Prozeß macht.“
Brigitte wirkt verwirrt. Ihre Augen kleben am Boden. Mit einer mechanischen Gebärde richtet sie ihre Schwesternhaube.
„Ich liebte ihn“, erwidert sie. Ihre Stimme klingt rauh. „Damals, als er verschwand, stellte ich Nachforschungen an. Die Amerikaner gaben mir Auskunft.“ Brigitte stockt. „Ich erfuhr, daß Werner als Kriegsverbrecher inhaftiert ist.“ Ihre Stimme wird heftiger. Ihre Augen glänzen feucht. „Ich erfuhr weiter, daß er gestanden hat, wehrlose Amerikaner niedergeschossen zu haben.“ Brigittes Gesicht verfällt. Es wirkt müde und zerquält.
Blitzschnell ziehen die letzten Wochen an ihr vorbei. Da liebte sie einen Mann, den ersten Mann ihres Lebens, pflegte ihn, hoffte mit ihm, sehnte sich nach dem Tag, da sie für immer mit ihm Zusammensein konnte. Dann stellte sich heraus, daß dieser Mann ein Mörder ist. Nein, Brigitte dachte bei Gott nicht voreilig. Sie glaubte, Werner besser zu kennen als die amerikanische Untersuchungskommission. Aber dann zeigte man ihr das Geständnis. Und dazu kam noch etwas, was sie bei Werners Abschied nicht wußte …
„Und das glauben Sie?“ fragt Vera.
Brigitte zuckt mit den Schultern.
„Ich muß Ihnen noch etwas erklären“, erwidert sie dann.
„Ich hatte einen Vater. Er erzählte einen Witz. Dafür kam er ins KZ nach Dachau. Ich habe Monate nichts von ihm gehört. Dann fand ich ihn wieder.“ Brigittes Stimme klingt schrill: „Wissen Sie, wo? Auf einer Gruppenaufnahme von 50, 60 Toten. In einem Eisenbahnwagen. Verhungert. Nackt. Die SS-Bewacher haben den Waggon einfach auf den Schienen stehenlassen, bis die Insassen tot waren. Verstehen Sie mich? Mein Vater war darunter!“
Vera unterbricht sie.
„Wollen Sie damit sagen, daß Werner Ihren Vater ermordet hat?“
„Natürlich nicht … Aber er trug die Uniform seiner Mörder. Und bei Malmedy benahm er sich wie ein Mörder. Er gab es selbst zu.“
„Wenn Sie das glauben, haben Sie ihn nie geliebt“, sagt Vera barsch.
„Ich liebe ihn noch immer“, entgegnet Brigitte fast lautlos, „das ist es ja gerade … tausendmal rede ich mir ein, daß er unschuldg ist. Und dann sehe ich meinen Vater vor mir, und dann weiß ich, was ich zu tun habe. Die Amerikaner haben mich nicht belogen. Werner hat alles gestanden. Oder wollen Sie behaupten, daß das nicht stimmt?“
Vera sieht verzweifelt von Tebster zu Morris. In diesem Augenblick gibt sich der lange CIC-Leutnant einen Ruck.
„Stop“, sagt er, „ich bin Leutnant Tebster von der CIC. Das ist der amerikanische Geheimdienst. Und jetzt sage ich Ihnen etwas, Fräulein: Werner Eckstadts Geständnis wurde erpreßt. Der Mann ist unschuldig.“
„Erpreßt?“ fragt Brigitte verständnislos.
„Ja. Von meiner eigenen Dienststelle. Und ich werde das vor jedem Gericht der Welt behaupten.“
„Das sagen Sie als amerikanischer Offizier?“ fragt Brigitte zögernd.
„Genau das. Und jetzt können Sie entscheiden, wem Sie glauben wollen!“
Jetzt erst begreift Brigitte. Ihr Gesicht wirkt auf einmal jung und frisch. Ihre Augen glänzen, aber anders als zuvor. Sie wird lebhaft, sieht Vera voll an, betrachtet die beiden Männer.
„Mein Gott“, sagt sie, „mein Gott … das habe ich ja alles nicht gewußt …“
Tebster lächelt.
„Dann kommen Sie gleich mit“, erwidert er.
Brigitte nickt. Jetzt erst laufen ihr salzige Tränen über das heiße Gesicht …
An diesem Morgen gibt Colonel Evans zum ersten Mal Werner Eckstadt die Hand. Der Druck ist fest und kalt. Fest und kalt mustern auch die Augen des amerikanischen Offiziers den deutschen Untersuchungsgefangenen.
„Haben Sie sich über Nacht erholt?“ fragt er.
„Yes, Sir.“
„Gut, dann machen wir weiter … Zigarette?“
„Danke.“ Zögernd greift Werner nach der Camel-Pakkung.
Der Oberst wirft ihm Streichhölzer über den Tisch.
„Ja“, beginnt Werner nachdenklich, „wissen Sie, daß ich immer zusammenfahre, wenn mir eine Zigarette angeboten wird, Sir? Glauben Sie mir, es gab eine Zeit, da waren Zigaretten gemeiner als Fußtritte.“
Colonel Evans nickt, steht auf, tritt an das Fenster.
„Ich habe Vertrauen zu Ihnen, Eckstadt“, erwidert er. „Sie dürfen nicht glauben, daß mir das leichtfällt … Wissen Sie, was damals an der Straßenkreuzung von Malmedy passiert ist?“
„Ich weiß es … heute“, versetzt Werner leise.
„Und wissen Sie, was diese Leute verdient haben?“
„Den Strick.“
Der Colonel nickt.
„Und ich werde mich verdammt beherrschen, sie vom Strick abzuschneiden.“ Der Oberst geht mit schnellen Schritten in dem trostlosen Vernehmungszimmer hin und her, bleibt stehen, schnippt die Asche auf den Boden, marschiert weiter. „Trotzdem weigere ich mich, zu glauben, daß alle Deutschen Mörder sind … Und Sie Eckstadt, sollten wissen, daß Amerika etwas anderes ist als ein Haufen dahergelaufener Sadisten. Ich weiß nicht, ob Sie Wert darauf legen“, fährt er fort, „aber ich werde Ihnen das beweisen. Ich bin nicht hier, um Sie zu retten oder einen anderen … Nein, ganz bestimmt nicht. Es geht mir um die Ehre meines Landes … Fahren Sie fort!“
Der Colonel setzt sich auf den Stuhl, lehnt sich zurück, schließt die Augen halb. Sein Gesicht wirkt wach und nachdenklich. Er fährt sich mit der Hand über den Mund, als wollte er seine Worte wegwischen, als habe er bereits zuviel gesagt …
Werner schweigt zunächst. Er starrt auf den Boden, streift einen Moment den Oberst mit einem raschen Seitenblick, räuspert sich.
„Damals schien plötzlich alles besser zu werden“, beginnt er. „Ich kam in eine Vier-Mann-Zelle. Und da war ein SS-Oberscharführer namens Heger, ein Mann, ein Kerl, selbst noch in dieser Lage … Wir haben zu ihm aufgesehen, bis …“
Unbewegt verfolgt der Oberst den Bericht. Seine Miene verändert sich nicht, selbst als ihm das Grauen unaufhaltbar den Rücken hochkriecht. Er weiß, daß es heute auf den Höhepunkt der Voruntersuchung zugeht … und daß das ebenfalls der Höhepunkt eines Verbrechens sein wird, das amerikanische Soldaten und Offiziere an wehrlosen deutschen Kriegsgefangenen verübt haben.
Werners Zellenkameraden waren zunächst ein 18jähriger SS-Mann und ein knapp 30jähriger Unterscharführer, zwei Freunde. Der Ältere, Hans Zenker, nannte den Jüngeren, Klaus Niessen, immer „Söhnchen“. Abwechselnd wurden sie zu Vernehmungen geholt. Der kleine Niessen hatte verkrustetes Blut unter der Nase, als er zurückkam.
„Was haben sie von dir gewollt, Söhnchen?“ fragte Zenker.
Der 18jährige erwiderte stockend:
„Straßenkreuzung … Malmedy.“
„Bei mir dasselbe“, antwortete Zenker.
Dasselbe …, dachte auch Werner Eckstadt.
Als nächster wurde Werner geholt. Die Taktik der Amerikaner änderte sich. Leutnant Prince war von einem neuen Vernehmungsoffizier abgelöst worden. Oberleutnant Mc-Cormick behandelte Werner distanziert, aber korrekt. Er sprach ebenfalls fließend Deutsch. Pedantisch konnte er stundenlang auf Nebensächlichkeiten herumreiten. Aber immer endete das Gespräch in der gleichen Sackgasse. Und jedesmal, wenn Werner seine Unschuld beteuerte, sagte der Oberleutnant:
„Einer muß ja dabeigewesen sein.“
Die Anklagevertretung hatte jetzt schon über 50 Mann aus den Kriegsgefangenenlagern aufgefischt, die der Malmedy-Verbrechen bezichtigt wurden, und 25 von ihnen waren mit Sicherheit gemeine, erbärmliche Mörder.
Nach der Vernehmung wurde Werner in das Krankenrevier geschafft und behandelt. Cornedbeef stand als Wache dabei und ekelte sich vor dem Brei aus Eiter an Eckstadts Oberarm.
Sie tauschten ihre Verhör-Erlebnisse in der Zelle nicht aus. Einmal, weil sie nicht sicher waren, ob die Amis nicht mithörten; zum anderen, weil die beiden Freunde Werner nicht ganz trauten. Sie folgten ganz einfach der alten SS-Lehre: wenn ein Kumpel einmal eine Wehrmachtsuniform anhat, dann kannst du nie wissen …
Alles änderte sich schlagartig, als Oberscharführer Heger ebenfalls die Zelle bezog. Er war groß und breitschulterig und hatte ein Clowns-Maul, das sich beim Lachen bis zu den Ohren dehnte. Er lachte oft. Es schien ihm bisher besser gegangen zu sein als den anderen drei. Vielleicht konnte er auch mehr aushalten. Jedenfalls sagte er immer wieder:
„Kinder, nehmt’s nicht so tragisch, verdammt noch mal.“
Dazu lachte er breit und gutmütig.
Die Amis ließen sich ein paar Tage lang überhaupt nicht sehen. Es herrschte Ruhe auf den Gängen.
„Jetzt lassen sie uns im eigenen Saft schmoren“, sagte Söhnchen. Als er ausgesprochen hatte, öffnete sich die Zellentüre.
Es war Cornedbeef.
Oberscharführer Heger fuhr von seiner Pritsche hoch.
„Achtung!“ brüllte er …
Sie standen alle drei stramm und legten die Hände an die Hosennaht. Es war ihnen schlecht vor Angst und Hunger.
Cornedbeef blinzelte bloß.
Oberscharführer Heger grinste ihm ins Gesicht.
„Verdammte Scheiße“, sagte er, „können wir ein paar Zigaretten haben, Sergeant? … Hier wird man ja verrückt.“ Er sprach in miserablem Englisch, dreist und hemmungslos.
Werner erwartete den Gummiknüppel. Aber der Sergeant reagierte seltsam. Er zuckte zusammen, feixte, fingerte an seiner Brusttasche herum und kramte ein angebrochenes Päckchen Chesterfield hervor, warf es Heger zu.
„Streichhölzer?“ fragte der Oberscharführer freundlich.
„Da, ihr Schweine“, erwiderte Cornedbeef gemütlich und fingerte auch noch Streichhölzer aus der Tasche. Erst beim Weggehen wurde sein Blick giftig.
Zenker, Niessen und Eckstadt waren sprachlos.
Heger lachte.
„Ihr Feiglinge, laßt euch doch von denen nicht ins Bockshorn jagen … man muß sie bloß richtig behandeln, dann spuren sie schon.“
Die drei fühlten sich blamiert und beschämt. Natürlich, so mußte man sich verhalten! Wie Heger! Man mußte ihnen unverschämt kommen. Der Oberscharführer war nicht mit Gold zu bezahlen. Er holte Spielkarten aus seiner Tasche, und sie saßen den ganzen Tag zusammen bei Skat und Siebzehnundvier. Heger übernahm die Führung in der Zelle. Sie hörten sich bereitwillig seine Geschichten an. Er mußte ein toller Kerl gewesen sein an der Front. Einmal öffnete er die Brusttasche seines Uniformrocks und ließ ein Ritterkreuz durch seine Finger gleiten.
„Das haben sie nicht gekriegt“, bemerkte er grinsend. Er verschloß den Orden wieder sorgfältig in seiner Brusttasche.
Sie wußten bald alles von ihm, auch, daß er im Nachbarbataillon von Zenker und Niessen den Ardenneneinsatz erlebt hatte. Von jetzt ab wurden in der Zelle die Erlebnisse ausgetauscht. Es war vorbei mit der Zurückhaltung. Man hatte die schlimmsten Zeiten überstanden, dachte man …
Da begannen die Verhöre wieder. Zenker wurde als erster abgeholt. Es dauerte zwei Stunden. Er sagte nach seiner Rückkehr bloß:
„Dicke Luft.“
Söhnchen kam als nächster dran. Dann Heger. Der Oberscharführer lachte.
„Na, macht’s gut, Kameraden!“ Es klang wie Selbstironie. Der Mann schien Nerven und Knochen aus Stahl zu haben.
’rein in die Zelle, ’raus aus der Zelle. So ging es im ständigen Rhythmus hin und her. Als man Söhnchen brachte, wurde Heger geholt. An der offenen Zellentüre gingen sie aneinander vorbei.
Da passierte es!
Der kleine Niessen fuhr mit einem tierischen Schrei dem Oberscharführer an die Gurgel. Er war schneeweiß im Gesicht. Der Haß gab ihm unglaubliche Kraft. Seine Nägel bohrten sich in das Fleisch des viel größeren, viel stärkeren SS-Oberscharführers.
Er schrie:
„Du Verräter! Du Lump! Du Sau! Du Scheißkerl!“
Hegers Augen traten aus den Höhlen. Er versuchte, den eisernen Griff an seinem Hals zu lockern … Da fuhren schon die Posten dazwischen, allen voran Cornedbeef mit geschwungenem Knüppel. Es sah aus, wie wenn eine Menge Menschen zwei balgende Hunde trennen wollte.
Es war schnell vorbei. Niessen lief das Blut über das Gesicht, als er mit Tritten in die Zelle befördert wurde. Von Heger war nichts mehr zu sehen.
„Er hat uns verpfiffen“, sagte Söhnchen keuchend. „Ein Spitzel.“
Am Abend kam Cornedbeef in die Zelle. Er musterte mit seinen schmalen Wasseraugen die drei Insassen verächtlich. Söhnchen drehte durch.
„Können wir ein paar Zigaretten haben?“ fragte er. Seine Stimme überschlug sich.
Cornedbeef reagierte träge. Er nahm seinen Knüppel in die Rechte und schlug so lange auf Niessen ein, bis er zusammengebrochen war.
Zenker und Eckstadt lehnten mit geschlossenen Augen kerzengerade an der Zellenwand und wagten nicht, hinzusehen. Werner biß die Zähne zusammen und verfluchte sich und die Schöpfung, die den Menschen feige, gemein und hinterhältig gemacht hatte.
Denn es ging weiter. Ohne Erbarmen, ohne Gefühl, ohne Gnade, ohne Menschlichkeit.
Am nächsten Tag wurde Werner zur Vernehmung geholt. Zu Oberleutnant McCormick, der heute seinen großen Tag zu haben schien. Er trat ein, grüßte und erstarrte.
Vor ihm stand Wieblich, der fast schon vergessene Richtschütze aus dem Tiger-Panzer des gefallenen SS-Obersturmführers Klausen …
„Wieblich“, flüsterte Werner.
Oberleutnant McCormick hörte es und lächelte zufrieden. Er setzte sich auf seinen Stuhl, legte die Beine auf den Schreibtisch und zündete sich eine Zigarette an.
Wieblich war blaß. Er trug eine SS-Uniform, die ihm zu weit geworden war. Seine Augen klebten am Boden. Langsam tastete sich sein Blick schräge von unten nach oben zu Werner durch.
„Det is ’n Wiedasehn, wat, alter Junge?“
Werner schluckte.
„Ick hab’ dir damals jleich jesacht, det jeht nich jut.“
Werner sah an Wieblich vorbei.
Der Oberleutnant verlagerte seine Beine von der linken Schreibtischseite auf die rechte. Er drückte die halbgerauchte Zigarette im Aschenbecher aus und zündete sich sofort eine neue an.
Endlich griff er ein.
„Der Mann war in Ihrem Panzer Richtkanonier?“ wandte er sich an Wieblich.
„Jawohl, Herr Oberleutnant“, erwiderte er stramm.
Eckstadt schoß das Blut in den Kopf.
Gleichmütig fuhr der Oberleutnant fort:
„Und Sie haben gesehen, wie Eckstadt auf amerikanische Gefangene geschossen hat?“
„Jesehen nich“, antwortete Wieblich, „ick war ja bloß Munitionsschütze. Da sehn se nischt im Panzer.“
McCormick sah Wieblich fragend an.
„Na, jehört hab’ ick’s halt. Hinterher hat er drüber jesprochen und sich über die Lippen geleckt.“
Langsam nahm der Oberleutnant seine Füße vom Tisch.
„Nun?“ fragte er Werner langgedehnt.
„Aber Wieblich!“ rief Werner. Es klang wie ein Schrei. „Wir haben doch keine Gefangenen erschossen! Ich war doch nie Richtkanonier! Das warst doch du!“
„Sieh dir man ja vor!“ Wieblich spielte künstliche Empörung. „Ick Richtkanonier! Nie jewesen!“
Werner schossen Tränen der Wut und Enttäuschung in die Augen. Dieses Schwein, dachte er. Alles drehte sich vor ihm.
Er wußte nicht, daß Wieblich mißhandelt worden war und unter dem Druck Verbrechen eingestanden hatte, die er gar nicht verübt haben konnte. Wieblich war ein Schwächling. Er hatte in Rußland eine ganze Kette von Morden begangen, mit denen er sich den Strick hundertmal verdiente. Aber hier war er, dank der Besonnenheit des Kompaniechefs Klausen, tatsächlich unschuldig. Um sich weitere Mißhandlungen zu ersparen, hatte er Eckstadt denunziert.
„Wieblich“, flüsterte Werner mit starren Augen. Mehr konnte er nicht sagen.
Auf einmal funktionierte sein Verstand wieder. Der Mann wußte ja, daß ich in amerikanischer Uniform hinter den feindlichen Linien mit dem Fallschirm abgesetzt wurde, dachte er. Mein Gott, das war gefährlicher als alles andere!
„Wollen Sie immer noch leugnen?“ fragte der Oberleutnant.
„Ich habe keine Gefangenen erschossen“, erwiderte Werner leise und bestimmt.
„Tut mir leid“, meinte der Offizier ruhig, „Sie setzen sich immer tiefer in die Nesseln.“
Cornedbeef kam herein, um ihn abzuholen. Sein Finger spielte mit der Schnur des Knüppels. Er wartete mit dem ersten Schlag, bis er den Raum verlassen hatte.
Wieblich rief ihnen nach:
„Tut mir leid … aber wat wahr is, muß wahr bleiben!“
Und dann wuchs die Angst ins Bodenlose. Sie zerhackte die Vergangenheit in kleine Stücke und fraß sie portionsweise auf. Man traute dem eigenen Wissen nicht mehr. Vielleicht hatten die Inquisitoren recht mit ihren von Prügeln begleiteten Behauptungen? Die Angst raubte das Bewußtsein, daß man mit den Malmedy-Verbrechen nichts zu tun hatte. Sie geisterte durch die Vernehmungen. Sie setzte sich in der Zelle fest. Sie machte Männer zu Schwächlingen und Schwächlinge zu Denunzianten. Angst saß in den Augen. Angst vibrierte in den Händen. Angst spiegelte sich auf der schweißnassen Stirne. Angst war allgegenwärtig … wenn man in die Gesichter der Zellengenossen sah, die von Tag zu Tag mehr verfielen, wenn man sie nachts stöhnen, schreien oder leise weinen hörte.
Werner hielt durch. Er ertrug die Schläge, die Schreie, das Stöhnen. Die Angst zerlegte, zersetzte ihn, aber er biß die Zähne aufeinander. Vielleicht gab ihm der Haß auf Hitler die Kraft dazu, vielleicht die Hoffnung auf eine gerechtere Zukunft. Tage hielt Werner noch durch, und diese Tage waren mehr, als ein Mensch aushalten kann.
Es geschah die Sache mit Niessen.
Vom stundenlangen Verhör kam er zurück. Gleichzeitig wurde Zenker, sein Freund, abgeholt. Sie gingen wortlos aneinander vorbei.
Der kleine Niessen, „Söhnchen“, war ganz still. Er starrte gegen die nackte Birne an der Decke, die nachts weiterbrannte. Er sah in das Licht, bis seine Augen tränten. Er hatte die Arme hinter dem Kopf verschränkt und schwieg.
Es dauerte und dauerte. Es war still. Totenstill. Niessen wurde nicht geholt und Zenker nicht gebracht.
Plötzlich richtete sich Niessen auf. Er trampelte mit den Beinen auf den Zellenboden und schlug sich mit den Fäusten unheimlich und langsam wieder und wieder gegen die Stirne. Dabei sah Werner zum ersten Mal, daß die Finger Niessens blutig waren. Es sah aus, als ob die Nägel abgerissen worden seien. Werner starrte auf Söhnchens Hände … und sagte nichts.
Er sah, wie der 18jährige mit geschlossenen Augen weinte.
Werner stand auf, trat an seine Pritsche heran.
„Zenker wird schon wiederkommen“, sagte er rauh. „Sie müssen ihn doch wiederbringen.“
Langsam hob Niessen den Kopf. Werner sah in ein fremdes Gesicht … Er war verheult, verzerrt, aus den Fugen geraten. Speichel stand in den Mundwinkeln. In den Augen tanzten irre Lichter.
„Hör auf!“ zischte Niessen. „Hör auf!“ brüllte er und warf sich auf seinem Strohsack wie im Krampf herum. Seine Schreie gingen in Geheul über. Es war nicht mehr menschlich. Es hörte sich an wie das Wimmern eines verlassenen Hundes. Es hatte keinen Anfang und kein Ende. Es war unbeschreiblich.
Nach langen Minuten erst entspannte sich sein Körper. Niessen streckte die Beine aus, starrte wieder in die Lampe. Er sah Werner nicht an, als er mit einer merkwürdig schwingenden und schwankenden Stimme sagte:
„Zenker wird nicht mehr wiederkommen. Es ist nicht mehr nötig …“ Söhnchen machte eine Pause.
Werners Kopf dröhnte. Er sah, wie Niessen die Lippen schon öffnete, bevor er noch sprechen konnte.
„Er war mein Freund“, quälte sich Söhnchen. „Er hat mir einmal das Leben gerettet … hörst du, kein anderer hätte es getan. Es war einfach ein Wahnsinn … er sprang aus einem Loch und holte mich direkt vor einem Panzer weg. Wir hätten alle zwei draufgehen müssen.“ Niessens Stimme wurde fester. „Und jetzt brauchen sie kein Geständnis mehr“, fuhr er fort. „Ich habe es für ihn abgegeben … Hörst du, ich habe ihn verpfiffen.“ Niessen wollte weitersprechen, aber er konnte nicht. Er röchelte und stöhnte. Er hämmerte wieder mit seinen Fäusten gegen die Stirne, bis Werner sie ihm nahm und festhielt.
„Es war so einfach“, keuchte Söhnchen. „Sie haben mit mir ein Geschäft gemacht … Sie wollten Namen wissen. Ich gab ihnen keine. Auch von diesen Schweinen nicht … zuerst. Ein paar von ihnen kenne ich nämlich. Aber dann fingen sie an, an mir herumzumachen.“ Niessen zeigte seine Hand vor.
„… Sie rissen mir die Nägel aus … nur zwei … als sie den dritten ziehen wollten, gab ich ihnen Namen … alle Namen von den Säuen, die ich kenne. Ich habe ihnen damals bei Malmedy zugesehen. Ich hab’ mich gekotzt. Aber was sollte ich machen?“
Niessen stöhnte …
„Dann wurden sie scheißfreundlich … sagten, ich sei noch so jung und ich hätte sicher nichts getan. Und wenn, dann sei es vergeben und vergessen … aber!“
In diesem Augenblick dachte Werner an seine Mutter, die Engländerin. Er sah sie vor sich, wie sie jeden Abend, als er noch ein Kind war, sich auf sein Bett setzte, seine Hände faltete und mit ihm auf englisch betete … und Werner dachte:
„Father in heaven …“ … Vater unser …
Tränen liefen ihm über das Gesicht.
„Aber“, fuhr Niessen fort.
Kein „aber“, dachte Werner verzweifelt, „Father in heaven, Father in heaven, Father in heaven …“
„Aber, sie sagten, ich solle jetzt beweisen, daß ich ein anständiger Kerl sei und zugeben, daß Zenker Gefangene umgelegt habe … Ich habe nichts zugegeben. Da zogen sie mir den dritten Nagel … Ich hielt durch.“ Niessen schwieg plötzlich. Er schwieg lange. Er schwieg verzweifelt.
Wieder bewegte er zuerst die Lippen. Wieder formten sie Sätze, die man nicht hören konnte. Und dann hatte die Stimme Kraft, entsetzliche Kraft, und schrie …
„Beim vierten Nagel hielt ich es nicht mehr aus … Meine eigene Mutter hätte ich angezeigt … es war so furchtbar“, röchelte Söhnchen. „… da habe ich alles zugegeben, was sie wissen wollten, ich hab’ gelogen, bloß damit sie nicht weitermachten. Alle Einzelheiten habe ich erfunden und immer wieder von Zenker geredet, weil sie ausgerechnet ihn ’reinlegen wollten …“
Amen! dachte Werner.
Wieder blieb es still in der Zelle.
Eine Stunde später flüsterte Niessen:
„Sag doch was …“
Werner richtete sich hart auf.
„Schlaf jetzt“, erwiderte er. „Du mußt schlafen!“
Er lehnte sich wieder zurück und setzte leise hinzu: „Du bist ein feiner Kerl, Niessen …“
Früh am Morgen wurde Werner zum Verhör herausgerissen. Ein unglaublicher Tumult herrschte in der Zelle. Cornedbeef brüllte wie ein Wahnsinniger:
„So ein Saustall! So eine Schweinerei!“
Mit Tritten trieb man Werner hoch. Er starrte auf Niessens Strohsack. Er begriff seine Augen nicht. Er stand da, ungläubig, entsetzt … Er dachte fiebrig: gibt es gar nicht. Ein Traum … alles Quatsch … Schau weg! Ein neuerTrick, den sie sich ausgedacht haben …
Der Strohsack war über und über mit Blut getränkt. Er war schon schwarz. Niessen lag, den Kopf zur Seite gedreht, mit wächsernem Gesicht und starren, gelblichen Augen auf seiner Pritsche, in der verkrampften, rechten Hand den kleinen Aluminium-Büchsenöffner, der ihnen zum Öffnen der Wurst- und Puddingdöschen der K-Ration belassen worden war.
Er hatte sich mit ihm die Pulsader geöffnet.
Werner sah es und begriff es nicht. Und dann arbeitete sein Verstand weiter, und er dachte, daß Söhnchen ein tapferer Bursche war. Denn mit einem so stumpfen Ding mußte es unheimlich weh getan haben.
Und Werner hatte nichts gehört. Gar nichts …
An dieser Stelle der Vernehmung desertiert die Selbstbeherrschung des Oberst Evans. Sein Gesicht ist verzerrt, seine Fäuste sind geballt. Er schreit Werner Eckstadt an:
„Hören Sie auf! Hören Sie auf! Ich kann das nicht mehr mitanhören!“
Der Oberst geht im Zimmer auf und ab.
„Entschuldigen Sie, Sir“, erwidert Werner leise. „Sie wollten alles wissen … das ist noch immer nicht alles.“
Der Oberst fährt herum. Eine Sekunde sieht es aus, als ob er auf Werner losgehen wollte. Aber dann hat er sich wieder in der Hand, setzt sich auf einen Stuhl, lehnt sich zurück. Seine Hände entspannen sich.
„Tut mir leid“, sagt er. Er steht wieder auf, geht an die Türe, ruft den Posten herein.
„Ich möchte den Gefangenen Niessen sprechen“, sagt er.
„Yes, Sir“, entgegnet der Posten.
Nach zehn Minuten meldet sich der Kommandant des Untersuchungsgefängnisses Dachau.
„Wen wollen Sie sprechen, Colonel?“
„Einen Gefangenen namens Niessen.“
„Den gibt es bei uns nicht.“
„Aber es gab ihn?“
„Ja. Er ist gestorben“, antwortete der Kommandant.
„An was?“
„Selbstmord, Colonel.“
Der Oberst nickt. Er betrachtet Werner zerstreut, zuckt die Schultern. Der Gefängniskommandant zieht sich zurück. Das Schweigen ist lange und verzweifelt. Minuten vergehen langsam wie Stunden. Evans sitzt auf seinem Stuhl und rührt sich nicht.
Da beginnt Werner wieder ganz leise:
„Da unterschrieb ich ein Geständnis, als es mir an die Nägel ging. Ich unterschrieb es, bevor ich unter der Qual der Folter unschuldige Kameraden belasten konnte. Verstehen Sie? An den ganzen Scheußlichkeiten, zu denen ich mich durch meine Unterschrift bekannte, ist nicht ein wahres Wort … Ich wußte von den Erschießungen nichts. Ich habe erst hier davon erfahren.“
Der Colonel gibt sich einen Ruck. Seine Lippen sind schmal und weiß. Sein Gesicht ist noch immer gerötet.
„Gut, Eckstadt, ich übernehme Ihren Fall … ich übernehme ihn mit allen Konsequenzen.“
Werner starrt ihn ungläubig an. In seinem Gesicht zuckt es. Er will etwas sagen, aber die Erregung preßt seinen Mund zusammen. Er will auf den Oberst zugehen, ihm die Hand geben. Aber er sitzt wie angewurzelt. Dankbarkeit schießt wie ein Krampf durch seinen Körper. Seine Augen sind groß und hell.
Der Oberst steht auf.
„Das wär’s“, sagt er. „Nun nehmen Sie sich zusammen, Mann. Ich bringe Sie heraus. Sie und die anderen … soweit sie unschuldig sind.“