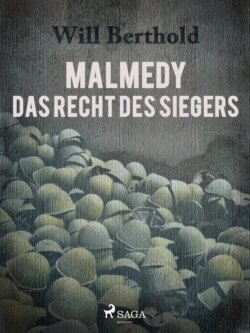Читать книгу Malmedy - Das Recht des Siegers - Will Berthold - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. kapitel
ОглавлениеSie fielen lautlos vom Himmel, Partisanen eines wahnwitzigen Befehls. Während sie vom Wind auseinandergetrieben wurden und plötzlich allein im feindlichen Hinterland standen, in der falschen Uniform, den Strick des Henkers fast schon fühlbar um den Hals, während sie sich mit ihrer Angst beschäftigten und ihre Instruktionen vergaßen, rumpelten die Motoren der Panzervorausabteilung der SS-Division Leibstandarte Adolf Hitler zum Angriff. Laub, Reisig, Tarnnetze, alles flog zur Seite. Seit drei Tagen hatten die 40 Tigerpanzer der „Gruppe Florian“ auf den Einsatzbefehl gewartet. Tag und Nacht standen sie im Feuer feindlicher Flugzeuge, stets waren sie vom Tod gesucht, bedroht, verfolgt.
Immer wieder war der Angriffsbefehl verschoben worden.
Wegen des Wetters. Der Generalfeldmarschall von Rundstedt brauchte niedrighängende Wolken, schlechte Fliegersicht, damit seine Panzer operieren konnten. Die Besatzungen hätten ihm dankbar sein sollen. Aber sie verwünschten ihn und seine Offensive, den Scheißkrieg und den stählernen Sarg, in dem sie bereits aufgebahrt waren … sie verwünschten den besten Kameraden und die eigenen Eltern, denen sie ein Leben verdankten, das schon keines mehr war, ehe es überhaupt begonnen hatte.
Obersturmführer Klausen, der Führer einer Panzerkompanie in der „Gruppe Florian“, fuhr seinen Panzer offen. Er lehnte im Turm und beobachtete, wie seine Leute hinter ihm einschwenkten. Er hatte das Manöver oft gesehen, aber jedesmal mit besseren Gefühlen als heute.
Die Landser hatten der Ardennenoffensive bereits einen Namen gegeben, noch bevor sie gestartet worden war. Unternehmen „Von der Hand in den Mund“ hieß sie. Die Panzer hatten nicht genug Sprit.
„Den müßt ihr euch von den Amis holen!“ hatte der Befehl allen Ernstes gelautet. „Ihr müßt so schnell sein, daß euch die Spritlager der Amis in die Hände fallen …“
„Karbid“, schrie der Obersturmführer seinem Fahrer zu. Das heißt in der Panzersprache: „Gib Gas!“
Und die Stahlkolosse rauschten los …
Soweit ist Colonel Evans mit dem Aktenstudium gekommen. Wieder läuft er im Zimmer hin und her. Er wird sich diesen Eckstadt vornehmen. Gut, warum soll nicht auch ein Anständiger unter den Malmedy-Angeklagten sein! Es wird keiner gehängt, solange der Oberst von seiner Unschuld überzeugt ist. Dafür wird er seinen ganzen Einfluß, seinen ganzen Mut, sein ganzes Gewicht einsetzen.
Er ruft den Staatsanwalt an.
„Wie Sie wissen, habe ich die Verteidigung übernommen“, sagt der Oberst.
„Ich hätte mir das an Ihrer Stelle noch einmal überlegt“, versetzt der Staatsanwalt knapp.
„Ich brauche Ihre Ratschläge nicht“, fährt ihn der Colonel an. „Ich möchte eine Sprechkarte haben.“
„Die kann ich Ihnen nicht geben.“
„Passen Sie auf“, erwidert der Colonel langgedehnt, „entweder ich habe in einer Viertelstunde in meinem Büro eine Sprechkarte für das Kriegsverbrechergefängnis in Schwäbisch-Hall oder Sie können etwas erleben, was Ihnen noch nie passiert ist!“
Der Oberst wirft den Hörer auf die Gabel zurück. Sein Gesicht ist gerötet. Wieder saust er hin und her. Er wird den Weg der vorstoßenden Panzer, der abgesprungenen Saboteure weiterverfolgen, bis er restlose Klarheit hat.
Hier stimmt etwas nicht.
Er fühlt, er ahnt, er weiß es.
Die Stadt ist grau wie der Himmel, grau wie die Gesichter ihrer Passanten, die der Alltag gehetzt, verbissen, schweigend auf die schmutzigen Straßen spuckt. Nur die bunten Gruppen schwatzender Schwarzhändler vor dem Deutschen Museum, am Isartorplatz und in der Möhlstraße beleben das Stadtbild. Hilflose Polizisten beobachten Zigarettenverkäufe … Warum sollten sie eingreifen? Vielleicht sind ihre eigenen Frauen gerade unterwegs, verscheuern eine Kommode gegen Butter oder Butter gegen eine Kommode …
Mit kräftigen, bulligen Soldaten besetzte Jeeps fahren langsam an den Gehsteigen entlang. Die GIs rufen in ihrem quakenden Landserenglisch den Mädchen Scherzworte zu, halten plötzlich den Wagen an und kontrollieren einen Passanten, dessen Nase ihnen mißfiel. Erst wenn der Abend kommt, endet für sie die Langeweile, in irgendeiner Beize, bei teurem Schnaps und billigen Mädchen.
Vera geht durch die Maximilianstraße, ignoriert die Blicke der Männer, die Angebote der Schwarzhändler und die Rufe der Militärpolizei. Der Wind rafft ihren dünnen Mantel. Ihr Gesicht ist gerötet. Sie geht lässig und selbstbewußt, langsam, die Augen im Niemandsland der Gleichgültigkeit. Sie trägt Nylonstrümpfe, die den letzten Monatsgehalt kosteten, und sie geht so zierlich und sicher auf ihren hohen Absätzen, als sei sie mit ihnen bereits zur Welt gekommen.
Am Max-Joseph-Platz fährt eine schwarze Limousine dicht an den Randstein heran. Ein Zivilist steigt aus und geht auf Vera zu.
„Sie sind Fräulein Eckstadt?“
Vera nickte gleichgültig.
„Kommen Sie mit!“
„Was wollen Sie?“
„Fragen Sie nicht … CIC, amerikanischer Geheimdienst.“
Das Mädchen zögert noch eine Sekunde. Mechanisch betrachtet sie das Auto, sieht die amerikanische Nummer. Man hat sich als Deutscher daran gewöhnt, Befehle auszuführen, auch wenn sie zunächst noch völlig unverständlich sind.
Zwei Männer sitzen noch im Wagen. Der Fahrer biegt in die Prinzregentenstraße ein, gibt Gas, rast die Windungen am Friedensengel hoch, überquert das Rondell, hält vor einem von Säulen umgebenen Haus.
„Kommen Sie“, sagt der Zivilist zum zweiten Male in anglisiertem Deutsch. Er hat ein zu kurzes Kinn und ein zu langes Sakko, spricht brüsk, ist ein Teil jener Unwichtigkeit, die im Jahre 1946 so wichtig war.
Er führt Vera in ein Büro, läßt sich auf einen Stuhl fallen, zündet sich eine Zigarette an und sagt gedehnt:
„Setzen Sie sich, Fräulein Eckstadt.“
„Was wollen Sie eigentlich von mir?“ fragt Vera nochmals. Ihre hellen, wachen Augen sind zu einem schmalen Spalt zusammengezogen. Ihr Blondhaar fällt sorgfältig geordnet in den Nacken und endet in einer hübschen Rolle. Sie hat die Beine übereinandergeschlagen, entnimmt ihrer Handtasche eine Zigarette, gibt sich selbst Feuer, sieht dabei zum Fenster hinaus.
„Do you speak English?“ fragt der Mann.
„Ja“, versetzt Vera, „genausogut wie Sie Deutsch.“
Ein uniformierter Leutnant steht lässig im Hintergrund, betrachtet Vera. Das Gespräch interessiert ihn nicht.
„Sie waren beim BDM?“
„Natürlich.“
„Und Ihr Bruder war bei der SS?“
„Ja“, erwidert sie, „und mein Vater bei der NSV … Wollen Sie mir nicht endlich sagen, wer Sie sind?“
„Ich heiße Bauer“, antwortet der Mann.
„Sie haben sich an Colonel Evans herangemacht“, fährt er fort, „und ihm Greuelmärchen erzählt. Ich will hier nicht wiederholen, was Sie alles behauptet haben. Sie wissen es ja selbst am besten.“
Bauer steht auf, geht am gleichgültigen Leutnant vorbei, läuft ein paar Schritte hin und her.
„Das ist Nazipropaganda“, sagt er dann heftig. „Ich warne Sie. Wir sind hier, um die Demokratie zu schützen. Wir dulden keine verlogenen Angriffe!“
„Ich habe nur die Wahrheit gesagt“, entgegnet Vera heftig, „und ich dachte, in der Demokratie kann man die Wahrheit sagen.“ Sie steht auf. Ihre Augen blitzen. Sie spricht schnell und kalt: „Oder wollen Sie mich einsperren? Wie meinen Bruder?“
„Seien Sie ruhig!“ entgegnet Bauer.
Der Leutnant zerquetscht unbeteiligt seinen Kaugummi, immer noch Vera anstarrend.
„Sie wissen jetzt, was Ihnen droht“, fährt Bauer fort, „überlegen Sie es sich genau, sonst verlassen Sie heute zum letzten Mal dieses Haus.“
Ein Gedanke schießt Vera plötzlich durch den Kopf. Sie betrachtet den Uniformierten lächelnd und sagt in englischer Sprache:
„Und was meinen Sie, Leutnant? Wollen Sie auch die Demokratie mit Gefängnissen verteidigen?“
Der Leutnant malmt bedächtig auf seinem Kaugummi herum, grinst, richtet sich auf.
„Ich finde, daß Sie ein sehr hübsches Girl sind“, sagt er dann.
„Wenigstens etwas“, entgegnet Vera.
Bauer setzt sich ärgerlich.
„Ich habe keine Vorurteile“, setzt der Leutnant hinzu, „wenn Sie Lust haben, gehen wir heute abend miteinander aus.“
Vera überlegt blitzschnell. Heute abend ist sie mit Leutnant Henry F. Morris, dem Assisten von Colonel Evans, verabredet. In Sachen ihres Bruders natürlich. Was sollte sie sich sonst aus dem Leutnant machen? Aber vielleicht kann dieser CIC-Leutnant weiterhelfen? Vielleicht kann sie ihn zum Sprechen bringen? Vielleicht kann sie diese schlaksige Gleichgültigkeit aus ihm heraustreiben … vielleicht kann sie Werner helfen?
„Lust habe ich keine“, erwidert sie lächelnd, „aber ich gehe trotzdem mit Ihnen aus.“
„Ich heiße Tebster“, sagt der Leutnant, geht auf sie zu und schüttelt ihr die Hand. Er läßt Bauer wie eine heiße Kartoffel fallen, nickt Vera zu. „Ich bringe Sie zurück“, setzt er hinzu.
Unter der Türe dreht er sich nach Bauer um.
„Mein Freund hier ist manchmal sehr eilfertig. Machen Sie sich nichts daraus.“
Vera nickt. Ganz kann sie ihren Triumph nicht hinunterschlucken.
„Auf Wiedersehen, Herr Bauer“, sagt sie ironisch.
Der Mann blickt sie nicht an, er schaut zum Fenster des CIC-Gebäudes hinaus.
An diesem Tag ist Colonel Evans in das Hauptquartier der amerikanischen Armee nach Heidelberg gefahren. Trotz massiver Drohungen erhielt er keine Sprechkarte für die Insassen des Gefängnisses in Schwäbisch-Hall. Der Ankläger, ein Oberleutnant, würde es nicht wagen, sie ihm so hartnäckig zu verweigern, wenn er nicht von der Armee gedeckt würde. Darum kümmert sich der Colonel nicht. Er ist entschlossen, den Stier bei den Hörnern anzugehen – wie bei einem Rodeo in seiner Heimatstadt Atlanta.
Heute morgen hat ihn die Versetzung nach Amerika erreicht. Er warf sie in den Papierkorb. Drei Gesuche zuvor waren abgelehnt worden. Und jetzt, ausgerechnet jetzt, da er in diesen Dreckhaufen von Akten griff, schenkte man ihm die Rückfahrkarte! Eine große, erfolgreiche Rechtsanwaltspraxis wartet auf ihn, eine Frau und zwei Kinder, die er liebt, ersehnen seine Ankunft …
Der Colonel geht durch die Versuchung hindurch, unbedacht, ungehemmt, unbeirrt. Sein Anstand und seine Courage haben ihm eine Falle gestellt, in die er blindlings hineinläuft … ein Mann, ein Mensch, ein Charakter. Er bedenkt nicht, daß er Deutschen hilft, die er eigentlich nicht leiden kann.
Einen ganzen Tag braucht er, um an den Zwei-Sterne-General Simson heranzukommen. Eine Mauer schweigender Höflichkeit schien langsam vor ihm zurückzuweichen. Er wurde vertröstet, zum Essen eingeladen, belobigt, abgelenkt. Aber so kann man mit Colonel Evans nicht umgehen. Er will zum General. Und er wird ihn treffen und wenn er eine Woche warten muß.
Am Abend schafft er es. Er wird in die schneeweiße Villa eingeladen. Eine Party natürlich. Der General begrüßt ihn höflich und wendet sich sofort seinen anderen Gästen zu. Der Colonel läßt den Whisky stehen. Er wartet.
Um 22 Uhr ist es so weit. Er faßt den General, geht mit ihm in einen Nebenraum.
„Sir“, beginnt er, „ich will hier keine Feste feiern, ich will arbeiten. Ich habe den Malmedy-Case übernommen, und was ich anfasse, führe ich zu Ende.“
Der General nickt.
„Ich brauche eine Sprechkarte. Ich muß sehen, was hier gespielt wird. Sie bringen mich nicht los, Sir … nicht einmal nach drüben, solange ich diese Leute nicht gesprochen habe.“
Der General betrachtet Evans aufmerksam. Simson ist groß und schlank, hat ein sympathisches Jungengesicht und trägt an seiner linken Brustseite drei Reihen Orden.
„Mir gefällt das alles nicht“, beginnt der General, „Evans, denken Sie nicht, daß ich Schweinereien decke. Ich wünsche keine Schweinereien. Weder so noch so.“
Er bietet dem Oberst eine Zigarre an, schneidet sie ihm ab, reicht ihm Feuer.
„Ich habe eine Frage“, fährt er dann fort, „Colonel, eine lächerliche Frage: Sind Sie ein guter Amerikaner?“
Der Oberst fährt hoch. Jede Verbindlichkeit ist aus seinem Gesicht gewichen. Es ist weiß, schmal, kalt.
„Haben Sie Zweifel, Sir?“ fährt er den General an.
„Ist schon gut“, antwortet Simson. „… Entschuldigen Sie.“ Jetzt wirkt der General müde und abgespannt. „Sie können Ihre Sprechkarte haben … Ich wünsche Ihnen alles Gute.“
Der Colonel verläßt die Party, ohne sich zu verabschieden. Morgen wird er in das Gefängnis fahren. Morgen wird er weitersehen. Ein Gefühl der Übelkeit kriecht ihm langsam von unten nach oben … Er sieht seine Frau, seine Kinder vor sich, er sieht das Flugzeug, das ihn nach Amerika zurückbrächte, er sieht Berge von Schlagzeilen, die über ihn herfallen, er sieht Vorwürfe, Drohungen …
Und wieder geht er durch das alles hindurch, blaß, kalt, unbeirrt. Ein Mann, ein Mensch, ein Charakter, bereit, für die Humanität zu kämpfen, jede Art von Faschismus zu schlagen, wo immer er ihm begegnet …
So geht der Fall des Gefreiten Werner Eckstadt weiter mit einem eintägigen Umweg über das Hauptquartier der amerikanischen Armee in Heidelberg …
Der Wind versprengte sie bereits in der Luft. Sie waren allein im Hinterland eines Feindes, dessen Uniformen sie trugen. Gespenstisch hoben sich ihre schneeweißen Fallschirme vom Dunkel der Nacht ab, glitten lautlos zu Boden. Am 17. Dezember 1944. Der Zeitplan rollte. In Hunderten von Stellungen, Löchern und Gräben, in Panzern und an Lafetten sahen die Männer auf die Uhr. Sie hörten es tikken. Die Höllenmaschine war in Gang gesetzt. Das Zifferblatt wurde zum Orakel. Bleich, phosphoreszierend meldeten die Zeiger, wieviel Zeit noch zum Leben übrigblieb. Hitler, der „größte Feldherr aller Zeiten“, verkürzte seinen Krieg dadurch, daß er die letzten Reserven in die Weihnachtsoffensive warf. Die Ardennenschlacht hatte begonnen …
Werner Eckstadt, vormals Gefreiter, jetzt wider Willen zum SS-Rottenführer befördert, war als einer der Letzten abgesprungen. Er dachte nicht an seinen Auftrag, an die Unsinnigkeit, an die Folgen … In seinem Magen und in seinen Gedärmen würgte die Angst. Als er unter seinem Schirm langsam hin und her pendelnd, unter sich die Nacht, über sich die Nacht, rings um sich die Nacht, sechs Meter pro Sekunde sank, glaubte er, direkt zur Hölle zu fahren.
Die Gruppe Eckstadt war aus tausend Meter Höhe abgesprungen. Die letzten Minuten davor waren unerträglich gewesen. Einer hatte gebetet, fünf hatten getrunken, der Rest fluchte oder schwieg, einer kotzte und einer sprang buchstäblich mit vollen Hosen. Sie dachten an die Hochspannungsleitungen, an den Starkstrom, der sie in einer Sekunde zu einem schwärzlichen Klumpen zusammenschmoren würde. Sie sahen Bäume vor sich, deren Äste sie aufspießen mußten. Und wenn das alles nicht eingetreten wäre, wenn sich der Fallschirm geöffnet hätte, dann mußte man mit Gewißheit inmitten der amerikanischen Stellungen landen. Und das Knistern der Fallschirmseide würde sich in Schüsse des Hinrichtungs-Pelotons verwandeln …
Es tat einen häßlichen, glucksenden Platsch. Als das eisige, faulige Wasser über Werner Eckstadts Kopf zusammenschlug, stellte er mechanisch fest: ich bin unten.
Das Wasser füllte den kleinen Speicherweiher eines Dorfes. Aus ihm wurde eine Elektroturbine betrieben. Das aber stellte Werner erst später fest. Er kämpfte verzweifelt, um aus dem eisigen Bad herauszukommen, heraus aus dem Schlick, der die Augen verklebte, heraus aus der brökkelnden, dünnen Eisschicht, die den Weiher überzog wie die Haut gekochter Milch.
Er paddelte, watete, stürzte blindlings irgendwohin. Er sah so gut wie nichts. Ich Rindvieh, dachte er, mache einen Lärm, daß die Amis zusammenlaufen müssen. Wie sollte er ihnen dann erklären, was ein amerikanischer Militärpolizist nachts in einem Dorfteich zu suchen hat? Er keuchte. Nichts war zu hören, nichst zu sehen. Kein Laut. Nur in den Ohren das Dröhnen des eigenen Herzens.
Die Kameraden hatte Werner Eckstadt vergessen, Haubach und Roettger, den kleinen Seyfried und auch den Obersturmführer. Keine Zeit zum Fluchen. Und diese irren Gedanken. Und diese Angst. Da hatten sie alles genau ausgetüftelt. Am grünen Tisch, bei der letzten Befehlsausgabe vor dem Absprung, hatte Rädchen auf Rädchen ineinandergepaßt. Monatelang wurde der wahnwitzige Auftrag geprobt … aber von einem simplen Dorfweiher wußten sie nichts, die Arschlöcher.
Werner hatte das Wasser und den Schlamm hinter sich, schlich durch das Dorf. Er müßte frieren, aber es wahr ihm siedendheiß. Am Ortsausgang stand an überhöhter Stelle eine einzelne Scheune. Er ging vorsichtig hinein, ließ sich auf das Stroh plumpsen. Als erstes rieb er sein Feuerzeug trocken. Die Zigarette brannte nicht. Er sah eine halbleere Tenne und zwei Karren mit aufgerichteten Deichseln.
Zuerst heraus aus den Klamotten, dachte Werner Eckstadt. Sollen sie ihren Dreckskrieg alleine weiterführen. Für ihn war er zu Ende, dachte, meinte, hoffte er wenigstens. Er grinste vor sich hin, während er sich das olivgrüne Zeugs vom Leib riß. Selbst die Unterhose hatte noch diese Farbe. Ob sie das auch als Uniform gelten ließen, die Amis? Jetzt erst merkte er, wie er fror. Seine Zähne klapperten. Trotzdem verspürte er ein solches Gefühl der Erleichterung, daß er am liebsten Rad geschlagen oder die Scheune angezündet hätte … Er war aus dem Todeskommando ausgetreten, bevor es richtig begonnen hatte, dachte er … Man mußte nur abwarten. Die Artillerie schoß jetzt aus allen Rohren. Der Himmel brannte, der Widerschein des Feuers drang durch die Ritzen in die Scheune.
Überrollen lassen, dachte Werner, und sich dann stellen, in Unterhosen. Die Eigenen würden schon Boden gewinnen. Diese Überzeugung hatte nichts mit Politik zu tun. Das ist ja das Dumme, dachte Werner, daß unsere Burschen als Soldaten immer Klasse sind, ob sie nun für eine beschissene Sache kämpfen oder für eine ordentliche.
Das Stroh machte warm. Er deckte sich nur oberflächlich zu und rechnete aus, wie lange die deutschen Panzer brauchen würden. In ein paar Stunden mußten sie da sein.
Er versank in eine Art Halbschlaf. Die Zeit verlor ihre Hülle. Die Wärme machte wohlig. Er räkelte sich. Ob die anderen auch eine Scheune gefunden hatten? Ob sie die Helden markierten … Oder ob sie ebenfalls die Flucht in den Verstand angetreten hatten?
Plötzlich kreischten die Angeln der Scheunentüre. Er konnte gerade noch seinen Kopf unter das Stroh zerren. Er spürte das blendende Licht. Er spürte den Schweiß auf seiner Haut. Wenn sie die achtlos herumliegenden Uniformstücke sahen! Wenn sie auf ihn treten würden! Wenn er husten müßte!
Es waren zwei Amerikaner. Sie unterhielten sich.
„Das hat uns genau gefehlt, mein Junge“, sagte der eine, „werden uns schon die Zeit vertreiben.“
Werner hörte, wie die Amis näher kamen, spürte den leichten Schritt ihrer gummibesohlten Schuhe. Die beiden GIs hatten offenbar Wache oder Streife und es war ihnen draußen zu kalt und zu windig. Der Strohhaufen raschelte. Werner spürte einen enormen Druck auf seinem rechten Bein. Die Amis hatten sich gesetzt.
„Mixer, einen Pernod“, brüllte einer von ihnen lustig.
Der andere lachte.
„Jack, was ist ein Pernod?“ fragte der andere.
„Greenhorn“, entgegnete Jack. „Ein Pernod ist ein Drink. Sieht gelb aus, wenn du ihn bestellst. Wird grün, wenn du Wasser ’reingießt.“
„Wieso?“
„Greenhorn“, fuhr Jack fort. „Warum wird ein Mädchen rot, wenn du sie ansprichst, und blaß, wenn du sie im Bett hast.“
Werners Bein wurde pelzig. Wie lange konnte er das noch aushalten? Eine winzige Bewegung und sie hatten ihn. Der Rest war dann sterben …
Ein wenig ließ der Druck jetzt nach. Der eine der beiden Amis mußte sich langgelegt haben.
„In Europa haben sie lauter verrücktes Zeug“, sagte der offenbar jüngere GI dann.
Jack grunzte.
„Das Beste sind die Weiber, Billy … Und wenn du deine fünf Sachen noch beinander hast, dann fährst du nicht nach Baltimore in Urlaub, sondern nach Paris.“
„Sie werden uns nicht fragen“, versetzte Billy melancholisch. „Auf unserer Fahrkarte steht Deutschland.“
„Da gibt’s auch Weiber …“
„Das sind Nazis“, knurrte Billy, „die werden dir was abschneiden. Hitler hat ihnen befohlen, daß der Krieg auch noch im Bett weitergeht.“
„Nonsens“, sagte Jack. „Weiber sind Weiber.“
Das Stroh knisterte wieder, weil sich der GI aufrichtete.
„Weißt du, warum die hier in Europa so toll sind? Weil ihre Männer schon seit fünf Jahren nichts mehr zu fressen bekommen haben. Na, ich kann dir sagen … ich hab’s erlebt. Das war unter dem Arc de Triomphe in Paris, da kam so eine Schnucke mit ein paar Veilchen oder sonst einem Schnittlauch … und sagte zu mir: ,Vielen Dank für die Befreiung.‘ Na, da hab’ ich sie gleich unterm Arm gefaßt und scharf angesehen. ,Miß‘, habe ich erwidert, ,die Befreiung kommt erst jetzt …‘ Mensch, die hat’s gleich kapiert.“
Ein Streichholz knirschte auf der Reibfläche.
„Das mit der Befreiung kannst du aber bei den deutschen Girls nicht sagen“, quengelte Billy.
„Denen werde ich was ganz anderes erzählen. Da gibt’s keine Flausen, verstehst du?“
Nicht nur Werners Beine waren wie betäubt. Die Worte der beiden GIs prasselten wie Hammerschläge auf ihn nieder. Die deutschen Mädchen, die er kannte, zogen plötzlich an ihm vorbei. Erika und die muntere Gisela und die spröde Ruth und die hochnäsige Karin. Und dann dachte er an Vera, seine Schwester, die in ein paar Wochen, in ein paar Monaten vielleicht diesen grobschlächtigen Yankees gegenüberstehen würde … Die kleine Vera, mit den hellen, lustigen Augen, mit der sorglosen Art, mit dem schnellen Witz, die immer wußte, was zu tun war.
„Idiot“, brüllte Jack, „du zündest ja die ganze Scheune an!“
Werner spürte, wie sie aufsprangen … Es ging blitzschnell. Ein Strohhaufen brannte. Das Feuer fraß sich rasch weiter. Die Soldaten trampelten wie verrückt im Stroh herum.
Da passierte es!
Werner bekam einen Tritt an das Schienbein, einen in den Unterleib. Und noch einen.
Sie sahen ihn. Sie starrten ihn aus großen Augen an.
„He“, sagte Jack, „das ist aber eine Überraschung.“
Werner stand langsam auf, verstört, benommen, gerädert.
Ihre Maschinenpistolen pendelten an den Riemen von der Schulter.
„Was ist mit dir los? Bist du tot? Bist du besoffen?“
Werner Eckstadt sah, daß Jack ein Sergeant war. Er schlang die Angst und die Übelkeit hinunter. Er versuchte zu lachen. Es klang falsch und blechern.
„Ich … ich bin von meiner Einheit abgekommen. Ich wollte den Tag abwarten und hab’ mich hier eben hingehauen.“
Er wunderte sich, wie selbstverständlich ihm die englischen Worte über die Zunge glitten.
„Welche Einheit?“ fragte der Sergeant.
Werner nannte ein amerikanisches Phantasie-Kommando, dessen Bezeichnung und Nummer ihm vor dem Fallschirmabsprung eingeschärft worden war. Gleichzeitig aber hatte man ihm gesagt:
„Das gilt aber nur für den Bluff. Wenn die Amis das nachprüfen, seid ihr geliefert. Überlegt nicht lange, legt sie lieber gleich um.“
„Never heard!“ sagte der Sergeant … „nie gehört.“
Werner Eckstadt schwieg. Und dabei mußte er doch reden. Die GIs sahen ihn tückisch an. Sie wirkten nicht wie Burschen, die lange mit sich fackeln ließen.
„Ha“, sagte der Sergeant, „weißt du, was du bist? Getürmt bist du! Los!“ Jack wandte sich mit einer Kopfbewegung an den baumlangen Billy, der Hände hatte, zu denen man eigentlich einen Waffenschein brauchte.
Billy griff langsam nach Eckstadt, schüttelte den vermeintlichen Deserteur ein paarmal hin und her, ließ ihn aus und schlug ihm mit der Faust in das Gesicht. Der Deutsche fiel um wie ein Sack. Wie durch Watte hörte er die Worte des Sergeanten.
„Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack, Boy. Das ist nur unter uns, du Schwein! Das sind nur die Abschiedsgrüße von der Front!“
Billy zog Werner hoch. Grinsend, überlegt und ruhig scheuerte er ihm die nächste.
Und Werner Eckstadt lag wieder im Stroh. Über seine Oberlippe rann Blut. Die beiden stießen ihn mit den Füßen an.
„Wisch das ab!“ befahl der Sergeant.
Werner reagierte folgsam.
„Wenn dich einer fragt, sagst du, du hast dich gestoßen … Was sollst du sagen?“
„Ich habe mich gestoßen“, wiederholte Werner mechanisch.
„So“, versetzte der Sergeant, „und jetzt liefern wir dich ab.“
Werner zögerte eine Sekunde. Aber unmittelbar danach bezog er einen Tritt, daß er quer durch die Scheune flog. Er stand auf, sackte aber gleich wieder zusammen.
Sie rieben ihn mit Schnee ab, stellten ihn wieder auf die Beine. Sie gingen zu dritt zum Dorf zurück. Der Sergeant wies mit der Hand die Richtung.
Aber plötzlich fiel sein Arm leblos herab. Dann warf er sich zu Boden. Ein paar Sekunden später krachte es. Ein orangefarbener Blitz zuckte über das freie Schneefeld. Der Knall war hell, scharf und gemein.
„Come on!“ schrie der Sergeant. Er hetzte im wildenZick-Zack-Sprung über den Schnee, Billy dicht hinter ihm.
Werner Eckstadt blieb wie angewurzelt stehen. Erst die surrenden Granatsplitter ordneten seine Gedanken. Die Scheune hinter ihm flog in die Luft, brannte lichterloh, und von der Straße her bewegten sich langsam, mit abscheulich brummendem Geräusch, schwarze Kästen auf ihn zu, Panzer, deutsche Panzer …
Er zählte sie. Am Dorfeingang standen drei, hinter dem Weiher zwei. Noch nie in seinem Leben hatte Werner Eckstadt die Silhouetten deutscher Tigerpanzer so schön, so schneidig, so imponierend empfunden.
Maschinengewehre rauschten auf. Sie schossen auf Billy und Jack. Billy überschlug sich und blieb liegen. Werner Eckstadt lachte, er lachte schallend. Über das Blut aus seinen Lippen rannen Tränen.
Dann hatten sie ihn im Visier. Er warf sich in einen Graben, wartete, bis sie näherkamen, stand dann wie versteinert auf, bevor sie ihn zermalmen konnten, hob die Hände und schrie wie wahnsinnig:
„Ich bin ein Deutscher. Aufhören! Aufhören! Ich bin ein Deutscher!“
Das Lachen war ihm vergangen. Wenn der Richtschütze jetzt durchdrückte? Nicht lange überlegen, hatte man ihnen vor dem Einsatz gesagt. Nicht erst fackeln, blitzschnell handeln! „Schießt sie zusammen! Denkt an den Sprit, nur das ist wichtig … Wenn ihr keinen Sprit kriegt, holt euch selbst der Teufel. Scheißt auf die Humanität. Ist ja alles Quatsch, die werfen ja auch ihre Dreckbomben auf Frauen und Kinder und sind nur dann fein, wenn sie Angst haben. Macht kein Federlesens!“
All das schoß Werner in dieser endlosen Minute, da die Panzer näherkamen, durch den Kopf. Fünfmal starb er und zum sechstenmal setzte er auf das Leben. Vielleicht wollten sie ihn ganz aus der Nähe erledigen … oder erzählten sie sich gerade einen Witz und warteten auf die Pointe, bevor sie abdrückten. Sie hatten ja Zeit. Sie saßen ja warm und sicher in ihren stählernen Vernichtungskästen …
Obersturmführer Klausen war an diesem frühen Morgen des 17. Dezember 1944 recht zufrieden. Die Ardennen-Offensive ließ sich günstiger an, als er befürchtet hatte. In diesen ersten Stunden wenigstens. Als sich die Nacht allmählich in eine trübe, milchige Dämmerung verwandelt hatte, waren Klausens Panzer scheppernd gegen den Feind gerückt. Acht Tiger und zwei Panzerspähwagen, so dicht aufgerückt, daß sie ihre Heckumrisse sehen konnten.
Auf der Vormarschstraße lag der Schnee glatt wie von einer Walze festgepreßt. Rechts und links der Straße stiegen die Hänge des Ardenner Waldes an. Die nackten, schwarzen Äste der kahlen Bäume verloren sich im Nebel.
Klausen hatte das Turmluk offen. Er rauchte. Er wartete darauf, daß die ersten Granaten aus dem Dunst heranjaulten, sich in die Straße wühlten und Dreck und Steine aufspritzen ließen. Er wartete mit dem leichten Sodbrennen auf dem Magengrund, das bei den Frontsoldaten das Herzklopfen ersetzt und in dem Augenblick schwindet, da es wirklich mulmig wird.
Aber es wurde nicht mulmig. Zunächst nicht. Der Ardennenwald schien die GIs aufgesogen zu haben.
Sie nahmen Kilometer um Kilometer, ohne auf echten Widerstand zu stoßen. Erst die deutsche Artillerie weckte die Amerikaner, sonst hätten sie die Offensive vollends verschlafen. Die GIs hatten diese verdammten Deutschen von der Atlantikküste bis nach Belgien gejagt und setzten gerade zum Sturm auf Deutschland an. Woher sollten sie wissen, daß diese elenden „Krauts“ noch einmal alles auf eine Karte setzen würden, und das genau vor Weihnachten, wo man einen Brief schreibt, einen Truthahn ißt und zur Abwechslung auch einmal einen Feldgottesdienst besucht.
Die Besatzung des Obersturmführers Klausen hockte auf ihren Plätzen und hielt den Mund. Eine halbe Stunde lang brachte sie das fertig. Nach den ersten zwanzig Kilometern wurde es dem Fahrer Saalbeck zu dumm. Er schrie in sein Sprechgerät:
„Fahren wir nach Paris, Obersturmführer?“
Klausen nahm die Augen nicht von der Straße.
„Wenn’s geht“, antwortete er.
Saalbeck lachte in das Mikrophon. Es klang wie das heisere Meckern eines verdrossenen Ziegenbocks. Dabei streiften seine schmutzig-grünen Augen die zitternde Nadel auf der Benzinuhr.
Sie hatten vielleicht noch 500 Liter in ihren Tanks. Sie waren nicht einmal ganz „betankt“ worden, wie es so schön hieß.
„Sprit holt ihr euch beim Feind!“
Hinter einer Biegung krachte es plötzlich. Das „Heeres-Anklopfgerät“, die Zwei-Zentimeter-Spritze des vorderen Panzerspähwagens, bellte. Bis die Tiger um die Ecke kamen, war alles schon vorbei. Acht amerikanische Soldaten standen mit schwarzgesengten Gesichtern herum und hielten die Hände hoch. Ein neunter und ein zehnter Ami lagen quer auf der Straße, als wollten sie in den gegenüberliegenden Graben robben. Dem vorderen von ihnen fehlte der Kopf …
Klausen kletterte aus seinem Panzer, betrachtete die beiden brennenden Jeeps.
„Sie Esel“, sagte er dann zu dem Fähnrich des Panzerspähwagens.
„Jawohl, Obersturmführer“, erwiderte der Mann stramm.
„Können Sie nicht vorsichtiger schießen? Da verbrennen mindestens achtzig Liter Benzin.“
Der Fähnrich machte ein dumm-stolzes Gesicht. Klausen kletterte ächzend in seinen Panzer zurück. Das olivgrüne Häuflein der angebratenen Amis übersah er. Dann fielen sie ihm wieder ein. Er stieg aus seinem Turmluk und wies mit dem Daumen über die Schulter nach hinten.
Die GIs hielten die Hände auf dem Kopf und trotteten zurück. Dort kam die eigentliche Vorhut, das Gros. Sollten die sehen, was sie mit den Amis machten. Erst, wenn er den feindlichen Widerstand nicht mehr brechen konnte, durfte er stehenbleiben … oder mußte es, weil er kein Benzin mehr hatte.
Der Richtschütze Wieblich sah die charakteristischen Bewegungen seines Kompaniechefs.
„Könn wa nich machen, Obersturmführer.“ Seine Ohrläppchen waren rot vor Ärger und Enttäuschung.
„Schnauze, Wieblich“, erwiderte Klausen trocken.
„Ick will Ihnen ja nur Ärjer ersparen, Obersturmführer“, antwortete Wieblich.
„Schnauze, Wieblich!“
Der Richtschütze stammte noch aus den besseren Tagen der SS. Er hatte mitgeholfen, seiner Einheit den Namen „Lötlampen-Division“ zu verschaffen. Des Führers Garde hatte sich in Rußland die Zeit damit vertrieben, mit Lötlampen Dörfer in Brand zu setzen und die Zivilbevölkerung auszuräuchern.
„Det war praktisch.“ Wieblich schwärmte noch oft davon. Die Wieblichs waren in der Minderheit. Aber die Minderheit war groß genug, um den Ruf eines ganzen Volkes zu vernichten.
Die Panzereinheit erreichte ein Dorf, passierte einen Weiher. Die Sicherungsposten fielen im Maschinengewehrfeuer, bevor sich noch begriffen, daß der Feind anrückte.
„Genau ins offne Maul“, stellte Wieblich zufrieden fest.
Sie waren bester Laune. Es klappte alles so nach Maß, daß sie eine der hinteren Panzerbesatzungen auf der verlassenen Dorfstraße zum Hühnerfang kommandierten.
Am Ortsende vor der Scheune tauchten wieder drei Amis auf.
Feuerstoß! Daneben.
Zwei der drei liefen querfeldein. Feuerstoß!
„Den hat’s erwischt!“ sagte der Richtschütze.
Der zweite entkam. Der dritte stand noch wie angewurzelt, verschwand in einem Graben. Wieblich merkte sich genau die Stelle. Saalbeck fuhr auf sie zu.
In diesem Moment erhob sich Werner Eckstadt, in Unterhosen, und hielt die Arme in die Höhe.
Wieblich schwenkte den Turm, zielte. Er ließ sich Zeit beim Maßnehmen;
„Laß ihn“, sagte der Panzerkommandant per Sprechfunk zu seinem Richtschützen. „Der hat durchgedreht. Der kommt ja auf Socken.“
Wieblich knurrte unwillig.
Aber dieses Knurren rettete Werner Eckstadt zunächst das Leben …
So oft hat Werner Eckstadt seiner Schwester Vera in einem kurzen Drei-Tage-Urlaub von den Ereignissen in der Nähe von Stavelot, südlich Malmedy, erzählt, daß sie jede Einzelheit kennt, daß sie schon nicht mehr nach Worten zu suchen braucht, wenn sie sie wiedergibt. Sie trägt ein rotes Kleid mit freien Schultern. Eine schwere, goldene Kette, ein Geschenk ihrer verstorbenen Mutter, glitzert an ihrem Hals. Der CIC-Leutnant Tebster hat sie in einen Soldaten-Club mitgenommen. Eine Flasche Vat 69 steht am Tisch. Der schlaksige Leutnant gießt beständig ein.
Die Musik spielt vorzüglich. Eine deutsche Tanzkapelle, die sich rasch auf Hot umgestellt hat. Das Licht ist angenehm gedämpft. Nicht so gedämpft sind die Stimmen einiger Damen, die auf ihre amerikanischen Begleiter einsprechen … Damen wenigstens, wenn man sehr höflich ist.
„Gut, daß Sie nicht so sind wie die da“, sagt Tebster.
„Schlimme Erfahrungen?“
„Es geht.“
„Was machen Sie bei der CIC?“
„Ich entnazifiziere.“
„Macht Ihnen das Spaß?“
„Ein Scheißgeschäft“, erwidert der Leutnant. „Ich bin nur da, weil meine Mutter Deutsche war, und ich deutsch spreche.“
Vera nickt. Das Licht spiegelt sich auf ihren blanken, weißen Schultern. Sie sieht bezaubernd aus, so, daß die Männer sie wohlgefällig und die Frauen sie mißgünstig betrachten.
„Wollen wir tanzen?“ fragt Tebster.
„Einen Moment, Leutnant. Eine Frage noch: Ihre Mutter war Deutsche?“
„Ja.“
„Meine war Engländerin“, erwidert sie.
„Deswegen können wir doch tanzen.“
„Noch einen Augenblick, Leutnant. Sie kennen die Geschichte mit meinem Bruder?“
„Ja, aber was soll das?“
„Ich will Sie erpressen“, entgegnet Vera. „Wenn Sie ihm helfen, tanzen wir. Wenn Sie ihm nicht helfen, gehe ich sofort nach Hause.“
„Sie sind ein Biest.“
Vera nickt. Plötzlich weint sie. Tebster starrt sie betroffen an. Langsam begreift er, was los ist. Langsam sieht er ein, warum sie sich so nett hergerichtet hat, warum sie mit ihm ausging. Er begreift die endlose Qual, die hinter dieser lächelnden Fassade stecken muß, die Verzweiflung, den Mut, das Opfer, lächelnd zu tanzen, während der Bruder mit einem Fuß bereits im Grabe steht.
Der schlaksige Leutnant steht auf. Den Kaugummi hat er längst weggelegt. Die Gleichgültigkeit auch. Etwas macht ihn weich, rührt ihn fast, den wetterfesten Burschen, der bei Brest mitten in eine Flakstellung gesprungen ist, sie eroberte und mit vier Kameraden drei Tage lang verteidigte, als einziger Überlebender zuletzt.
„Der Teufel soll mich holen“, sagte er, „ich bring Ihren Bruder ’raus.“
Er hilft ihr in den Mantel.
„Verlassen Sie sich darauf.“
Vera nickt.
„Ich wollte nicht weinen … Sie sind jetzt schon der zweite, der mir helfen will.“
„Doppelt genäht hält besser“, erwidert Tebster leichthin.
Und wenn ich zehn brauchte, denkt Vera, ich muß Werner retten.
Er ist unschuldig.
Er darf nicht sterben.
Ich allein bin sein einziger, winziger, letzter Ausweg.
Wenn ich es bin …
In der ersten Minute begreift der schlaksige Leutnant Henry F. Morris gar nichts. Er starrt auf die am Boden herumliegenden Schriftstücke, die aufgebrochenen Schränke, die umgestülpten Schubladen, die herausgerissenen Schreibtischfächer … die wahllos verstreuten Innereien seines Office. Der Assistent des Colonel Evans holt mechanisch eine Zigarette aus seinem Etui, setzt sich und überlegt.
Gestern abend war er mit Vera verabredet. Aber das blonde, hübsche Mädchen versetzte ihn. Er begriff es widerwillig, ging in seine Stammkneipe und ließ sich mit Whisky vollaufen. Sein Wagen sprang nicht an, und er mußte zu Fuß nach Hause gehen. Er verschlief den Wecker und stand mit zwei Stunden Verspätung auf. Er erhob sich auf Raten, er betrachtete durch das Fenster den verschlafenen Morgen. Der Tag war müde und grau wie das Gesicht einer alternden Frau. Und der schlanke, gutgeratene Leutnant aus Texas hatte Kopfschmerzen.
Und jetzt, in seinem Büro, erlebt Henry F. Morris erst die schlimmste Überraschung …
Allmählich begreift er, was vorgefallen ist. Einbrecher! Er bückt sich, sammelt die Schriftstücke, ordnet sie. Er schüttelt seine Benommenheit ab, vergißt die Kopfschmerzen und erfaßt blitzschnell, auf was es die nächtlichen Besucher abgesehen hatten.
Akten sind verschwunden.
Genauer gesagt: Dossiers über den Fall Malmedy.
Ganz genau gesagt: die Unterlagen über den deutschen Gefreiten Werner Eckstadt.
Vera, denkt der Leutnant. Das steckt also dahinter. Zuerst verabredet sie sich mit ihm, um sicherzugehen, daß er sich nicht im Büro aufhielt. Während er auf sie wartete, drang sie oder gedungene Leute in das Office ein. In ihrer Verzweiflung ist ihr alles zuzutrauen! Und sie hat keine Geduld, obwohl sie weiß, daß sich Colonel Evans des Falles angenommen hat … angenommen hatte wenigstens, denn wenn der Oberst erfährt, was hier vorgefallen ist, wird er keine Lust mehr haben, die Sache weiter zu verfolgen.
Verdrossen greift der Leutnant zum Hörer.
„Ich habe ein schlechtes Gewissen“, sagt Vera. „Ich konnte Sie gestern nicht mehr erreichen. Ich hatte eine dringende Verabredung. Bitte, seien Sie nicht böse.“
„Können Sie gleich hierherkommen?“
„Gibt es etwas Neues?“
„Kommen Sie, sobald es geht“, erwidert der Leutnant knapp.
Vera schafft es in einer Viertelstunde. Der eilige Marsch hat ihr Gesicht gerötet. Sie sieht frisch aus. Ihre Augen sind klar und unbefangen. Sie trägt eine lange Flauschjacke zum dunkelgrauen, hautengen Rock. Sie wirkt natürlich wie immer. Nicht eine Spur verlegen.
„Was war denn hier los?“ fragt sie verdutzt.
„Setzen Sie sich“, erwidert der Leutnant. „Passen Sie auf, Vera“, fährt er fort, „ich will nicht lange um die Sache herumreden. Heute nacht ist hier eingebrochen worden. Die Täter haben ausgerechnet die Akten Ihres Bruders mitgenommen.“ Der Leutnant geht mit großen Schritten im Zimmer hin und her, bleibt stehen, betrachtet Vera ausgiebig.
„Und nun habe ich eine Frage an Sie: Haben Sie … haben Sie mit der Geschichte etwas zu tun?“
„Nein. Bestimmt nicht“, antwortet Vera fest.
„Hören Sie zu, Vera. Ich könnte es vielleicht verstehen. Es wäre eine Dummheit gewesen. Aber die Sorge um Ihren Bruder … Ich muß es genau wissen. Verstehen Sie mich?“
„Ja“, entgegnet das Mädchen, „das verstehe ich. Und ich sage Ihnen ganz genau, ich habe nichts mit dieser Geschichte zu tun.“
„Wo waren Sie gestern?“
„In einem Soldatenclub.“
„Mit wem?“
Vera zögert.
„Mit wem waren Sie im Soldatenclub?“ fragt Leutnant Morris noch einmal.
„Mit einem Amerikaner … Mit Leutnant Tebster von der CIC.“
„Und deswegen haben Sie mich versetzt?“
„Ich beginne es zu bereuen“, erwidert Vera. Sie lächelt, verzieht den Mund ein bißchen dabei, als ob sie sich über sich selbst lustig machen wollte.
„Es hat nicht lang gedauert“, fährt sie fort. „Nun, machen Sie nicht auf böse, Henry. Es ging nur um meinen Bruder.“
„Es geht immer nur um Ihren Bruder“, erwidert Morris kalt. „Wie heißt Ihr neuer Freund?“
„Tebster.“
Der Leutnant nimmt den Hörer, läßt sich mit der CIC verbinden und erreicht beim dritten Versuch den Offizier.
Tebster verspricht, sofort zu kommen.
„Werden Sie mich das nächste Mal wieder versetzen?“
„Nein. Ich will es nicht endgültig mit Ihnen verderben“, entgegnet Vera.
Sie berichtet, wie sie mitten auf der Straße in einen Wagen „gebeten“ und zur CIC gefahren wurde, daß sie dann im Gebäude des amerikanischen Geheimdienstes Tebster kennenlernte und ihre Chance gleich wahrnahm.
„Ich habe auch eine Neuigkeit für Sie“, unterbricht sie Morris, „der Colonel ist heute nach Schwäbisch-Hall gefahren. Wenn er zurückkommt, hat er mit Ihrem Bruder bereits gesprochen.“
In diesem Augenblick reißt Leutnant Tebster ungestüm die Tür auf. Er begrüßt Vera, betrachtet sich die Unordnung, schüttelt den Kopf.
„Anfänger“, sagt er, „wenn die Burschen wieder aufgeräumt hätten, wären Sie vermutlich nicht gleich daraufgekommen, was fehlt. Stimmt’s?“
„Natürlich“, erwidert Morris.
„Haben Sie einen Verdacht?“
„Den habe ich.“ Er deutet auf Vera. „Hier, unsere nette, junge Freundin.“
„Nonsens“, entgegnet Tebster. „Oder haben Sie es getan?“ fragt er Vera.
„Nein.“
„Oder tun lassen?“
„Nein.“
Tebster zündet sich eine Zigarette an, läßt sich auf einen Stuhl fallen, schlägt die Beine übereinander.
„Vera lügt nicht“, sagt er zu Morris.
Morris nickt.
„Na, ist ja alles in bester Ordnung. Ich werde mal bei meiner Dienststelle etwas Wirbel machen. Mal sehen, wer hier Akten klaut.“
„Wer hat eigentlich Vera bei Ihnen angezeigt?“ fragt Morris.
Der Leutnant zuckt mit den Schultern.
„Anonym“, erwidert er dann. Über sein Gesicht streicht der Schatten des Ekels.
„Anonym auch für Sie?“
„Mal sehen“, antwortet der Leutnant.
Die beiden jungen Offiziere haben in diesem Augenblick den gleichen Gedanken: wenn nun Amerikaner hinter der Sache stünden? Wenn eine bestimmte amerikanische Dienststelle Wert darauf legte, ein bestimmtes Schriftstück verschwinden zu lassen … ausgerechnet jetzt, da der Malmedy-Prozeß in wenigen Tagen anlaufen wird?
„Was war denn eigentlich in den Akten?“ fragt Leutnant Tebster.
„Geständnisse … das Übliche.“
„Und sonst nichts?“
„Doch. Ein Brief des Angeklagten an seine Schwester, der uns eigentlich erst auf die ganze Sache gebracht hat. Vorwürfe gegen die Methoden der Untersuchung. Es war schon der zweite Brief, der aus der Zelle geschmuggelt worden war.“ Leutnant Morris richtet sich auf. „Keine schönen Vorwürfe“, sagt er, „wenn sie stimmen, kann der Ankläger etwas erleben.“
Tebster nickt zerstreut, steht auf.
„Gehen wir frühstücken?“ sagt er abrupt. „Kommen Sie mit, Vera?“
Sie antwortet mit einem Lächeln.
Sie gehen zu dritt. Vera in der Mitte, Vera zwischen zwei jungen, sympathischen Männern, die die gleiche Uniform tragen und die gleichen Gefühle für sie haben. Aber diese Gefühle bleiben im Schatten des Falles Malmedy stecken. Drei Menschen werden sich Tag und Nacht den Kopf zerbrechen, wie sie das Netz von Mord, Lüge, Betrug und Verbrechen aufrollen können.
Indessen aber wird ein junger, unschuldiger Mensch namens Werner Eckstadt auf den Henker warten …
„Ich kann Ihnen nicht viel sagen“, beginnt der Major, „ich bin erst seit einer Woche hier. Mein Vorgänger ist bereits in den Staaten.“
Evans nickt.
„Der Betrieb hier ist korrekt. Die Häftlinge erhalten anständiges Essen, werden zweimal täglich an die frische Luft geführt und dürfen lesen. Wir sind kein KZ.“
Wiederum nickt der Colonel.
„Die Strafanstalt ist mit 468 Insassen besetzt … Die Gefängnisverwaltung hat mit der Untersuchung nichts zu tun. Die einzelnen Untersuchungskommissionen rufen die Leute auf, sie werden in eigenen Vernehmungszimmern zusammengebracht.
„Und Sie haben nie Unregelmäßigkeiten festgestellt?“ unterbricht ihn der Oberst.
„Wissen Sie“, erwidert er, „ich bin ja auch in den USA in der Gefängnisverwaltung tätig. Eine Strafanstalt ist schließlich kein Sanatorium. Immer werden die Häftlinge behaupten, daß sie mißhandelt worden sind. Ich habe es mir abgewöhnt, diese … Aussagen wörtlich zu nehmen.“
„Ich bin Rechtsanwalt“, antwortet Evans, „Sie brauchen mir das nicht zu erklären … Es handelt sich auch nicht um gewöhnliche Mißhandlungen.“ Der Oberst steht auf, geht im Zimmer hin und her. „Wenn es stimmt, was man mir sagte“, fährt er fort, „dann wurden hier, in Ihrer Anstalt, die größten Scheußlichkeiten verübt, die sich je eine amerikanische Untersuchungskommission zuschulden kommen ließ.“
„Sprechen Sie mit den Leuten“, versetzt Wheeler betroffen.
„Gut“, erwidert der Colonel, „zunächst hätte ich gern den Häftling Eckstadt. Werner Eckstadt.“
Der Major drückt auf einen Klingelknopf auf seinem Schreibtisch. Ein Sergeant tritt ohne Eile ein. Wheeler hat den Namen auf einen Zettel geschrieben und übergibt ihn dem Unteroffizier.
„Diesen Mann will ich haben“, sagt er, „sobald wie möglich.“ Er wendet sich wieder dem Colonel zu: „Man soll sich mit diesen verdammten Krauts nicht einlassen. Die meisten lügen, und die nicht lügen, sagen nur die halbe Wahrheit … Oder haben Sie schon einmal einen getroffen, der zu seinem Verbrechen stand?“
„Nein“, entgegnet der Colonel ruhig. „Aber schließlich … alle Deutschen können keine Verbrecher gewesen sein.“
In diesem Augenblick kommt der Sergeant zurück.
„Tut mir leid“, sagt er, „Eckstadt ist gestern verlegt worden. Nach Dachau.“
Zufall? überlegt der Colonel. Er verabschiedet sich zerstreut. Seine Gedanken sind schneller als sein Wagen. In zwei Stunden kann er in Dachau sein.
Und er wird sich nicht vom Weg abbringen lassen.
An diesem Tage werden weitere Maschen des unsichtbaren Netzes, das die blonde Vera umgibt, zugezogen. Um neun Uhr ist sie beim Wohnungsamt vorgeladen. Sie fragt sich zu einem rundlichen Inspektor durch, der aussieht, als ob er seine Stellung unter Kaiser Wilhelm angetreten hätte und unter Adenauers Enkel sie noch ausüben würde. Er langt mechanisch nach einem Aktenstück, schlägt es auf und sagt, ohne Vera anzusehen:
„Sie sind also Fräulein Eckstadt?“
„Ja.“
„Sie müssen ausziehen.“
„Warum?“
„Die Wohnung ist beschlagnahmt.“
„Und weshalb ist sie beschlagnahmt?“
Der Mann zuckt die Achseln.
„Weshalb?“ fragt Vera noch einmal.
„Ihr Bruder ist schließlich Kriegsverbrecher“, erwidert der Beamte unwirsch.
„Erstens ist Werner noch nicht verurteilt“, fährt ihn das Mädchen unwirsch an, „und zweitens ist es meine Wohnung und nicht seine.“
„Es geht mich nichts an“, versetzt der Inspektor. „Es ist eine Anordnung … Sie müssen sie heute noch räumen.“
Der tägliche Dienst hat ihn längst abgestumpft, Die Vorgesetzten befehlen, und die Untergebenen führen aus. Das ist seine Welt, seine verdammt einfache Welt. Manchmal hat sie Zwischenfälle. Davon zeugen noch die Schlaufen auf seiner Bürojacke, an denen er, ordentlich wie er war, das Parteiabzeichen aufgehängt hatte. Das Blechding lag jetzt in der Isar, und der Beamte saß wieder auf seinem Amtsstuhl. Nach seiner Meinung mit Recht. Schließlich hatte er nur seinen Beitrag bezahlt. Die Leute, die die Anweisungen trafen, wechselten wie Parteiabzeichen, ihre Vollstrekker blieben … Dafür gibt es 400 pro Monat, nebst Pensionsberechtigung.
Vera geht vom Wohnungsamt zu ihrer Dienststelle. Auf ihrem Schreibtisch liegt ein Zettel, daß sie sich beim Personalbüro zu melden hat.
Der Captain bietet ihr Platz und eine Zigarette an.
„Es tut mir leid“, sagt er, „es tut mir wirklich leid …“
„Was tut Ihnen leid?“ fragt Vera.
„Ich habe hier die Order, daß ich Sie entlassen muß.“
Er zuckt mit den Achseln. „Es ist mir unangenehm. Ich habe Sie sehr geschätzt.“
„Und warum müssen Sie mich entlassen?“
„No comment“, erwidert der Captain, „kein Kommentar.“
Und so räumt Vera an diesem Tag Wohnung und Schreibtisch. Und sie muß an den Mann denken, der sie im Haus der CIC gewarnt hatte, sich weiterhin für ihren Bruder einzusetzen. Sie könnte ihre beiden Beschützer, Leutnant Tebster und Leutnant Morris, um Hilfe anrufen. Aber nicht ihr sollen sie helfen, sondern Werner, denkt Vera, und so nimmt sie die Schikanen hin. Sie sieht ihre beiden Freunde vor sich und lächelt. Harmlose, nette Burschen … olivgrüne Toggenburgs, die vielleicht nicht einmal wissen, wer der Ritter Toggenburg war.
Vera hat nicht viel einzupacken. Die Familie Eckstadt wurde in ganz unglaublicher Weise vom Krieg betroffen. Der Vater entkam dem Ersten Weltkrieg mit einer Gasvergiftung. Er zog von Krankenhaus zu Krankenhaus, bis er 1929 in Bad Kissingen starb. Die englische Mutter besuchte unmittelbar vor Kriegsausbruch ihre Verwandten in London. Hitlers Einmarsch in Polen sperrte ihre Rückfahrkarte nach Deutschland. Sie wurde kurzfristig interniert, dann entsannen sich die britischen Behörden darauf, daß sie eine gebürtige Engländerin vor sich hatten, und entließen sie aus dem Lager. Sie lebte in London. Zweimal gelang es ihr, über die Schweiz Briefe an ihre Kinder zu schicken. Einmal erhielt sie Antwort darauf. Es war ein erschütterndes Dokument.
Der Krieg beschied sich noch nicht damit, daß er den Vater getötet und die Mutter von den Kindern getrennt hatte. 1944 starb Veras Mutter an einer verirrten V 2. Kurz danach wurde Vera nach München dienstverpflichtet. Sie richtete sich eine kleine, bescheidene Wohnung ein und wartete auf Werner.
Endlich war der Krieg zu Ende.
Aber der Bruder kam nicht. Ein unberechenbarer Zufall machte ihn zum „Kriegsverbrecher“.
Und ich bin seine Mutter und sein Vater gleichzeitig, überlegt Vera. Und dabei habe ich mich immer an ihn angelehnt, an den großen, starken Bruder. Und jetzt ist er der Schwächere.
Veras Mut ist ungebrochen. Sie ist selbstsicher, gelöst, vernünftig und sauber … sauber wie ihr Gesicht. Weder der Krieg noch die dunkle Zeit, die ihm folgte, haben ihr etwas anhaben können. Sie ist unberührt und dabei weder ängstlich noch prüde. Sie kann mit Männern umgehen, ohne Männer zu kennen.
Das verdankt das hübsche, elternlose Mädchen unter anderem einem Lulatsch von einem Mann, Heinz, dem Panzerleutnant.
Sie liebte ihn. Sie liebte ihn von Anfang an. Er konnte mit den Augen lachen, ohne das Gesicht zu verziehen. Er hatte eine Art, zuzuhören und ohne zu reden, Antwort zu geben. Er konnte ihre Hände halten, ohne daß sie zitterten. Er konnte stundenlang neben ihr sitzen und sie ansehen und kein Wort sagen. Er war Student, hatte Pläne, hatte eine Zukunft. Nur in seinen Briefen sprach er davon.
Vera und Heinz schwiegen auch noch, als sie sich in den Armen lagen. 1944 war das. Und Heinz mußte am nächsten Morgen wieder zurück an die Front. Sie verbrachten die letzte Nacht gemeinsam. Sie saßen sich gegenüber, bis sie müde wurden. Auf einmal lagen sie nebeneinander auf Veras Bett. Auf dem Nachttisch tickte ein Wecker, der die Zeit, die ihnen blieb, in kleine Portionen zerhackte. Das Licht hatte Vera ausgelöscht. Der Mond schien so hell, daß jeden Augenblick die Alarmsirenen aufheulen mußten. Aber ein strategischer Zufall trug die Bomben in dieser Nacht in eine andere Stadt.
Sie küßten sich wie nie zuvor. Sie klammerten sich aneinander. Sie hielten ihre Hände so fest, daß sie schmerzten. Aber sie merkten es nicht. Weder die zwanzigjährige Vera noch der lange Heinz.
Und es wurde ihnen heiß. Es dröhnte in ihren Ohren. Es legte sich auf ihr Bewußtsein. Es kroch ihnen den Rücken hoch. Es ließ ihre Hände beben. Es ließ sie mit den Zähnen küssen. Und durch das Brausen hindurch, durch den Drang, durch den Sturm spürten sie, was sie sich bedeuteten.
„Vera“, flüsterte Heinz keuchend.
„Ich liebe dich“, erwiderte sie. „Ich habe noch nie geliebt. Du bist der erste … und du wirst auch der letzte sein.“
Er lächelte. In seinen Augen standen Tränen. Er drehte den schmalen Kopf in das Kissen, damit sie es nicht sehen konnte. Aber Vera bemerkte es trotzdem und war glücklich darüber.
Und ich gehöre ihm, dachte sie. Und es wurde ihr wohlig und warm. Das Glück war groß und ungebärdig. So schön ist das, dachte sie, und so sauber und so anständig und so selbstverständlich.
„Nein“, stöhnte Heinz, „es darf nicht sein! Es soll nicht sein!“ Er verkrampfte die Hände zu Fäusten, bis die Knöchel weiß wurden. Er biß sich auf die Lippen, daß die Spuren noch tagelang daran hafteten.
„Wir heben uns das auf“, flüsterte Heinz. „Verstehst du, Vera? Diese Welt ist so dreckig. Wir zwei … wir beide … wir machen das anders … ganz altmodisch.“
Sie streichelte sein Haar. Ihre Finger kannten sein Gesicht auswendig. Sie lächelte mit glänzenden Augen. Ein Radio spielte halblaut, er spuckte süße Melodien und bittere Meldungen in den Raum. Die übliche Mischung aus Schnulze und Heldentod.
Mein Gott, wie liebte sie ihn in diesem Augenblick. Nicht nur in diesem Moment. Aber die Zeit ließ sich nicht viel Zeit in dieser Nacht. Sie teilten ihr Glück in Minuten und Sekunden ein, in denen sie besprachen, wie es sich durch ihr ganzes, weiteres Leben ziehen sollte. Sie sagten sich Zärtlichkeiten und Gemeinplätze, und alles klang gut und schön und wahr und einmalig.
Vera brachte Heinz an den Zug. Sie war nicht die einzige Begleiterin eines Soldaten, aber sicher die glücklichste und die traurigste. Es gibt nichts Häßlicheres, nichts Gemeineres, nichts Trostloseres während eines Krieges als die Bahnhöfe, als das Nebeneinander von Abschied und Begrüßung. Hier steht eine überglückliche Mutter und umarmt ihren einzigen Sohn, und daneben sieht eine Frau ihrem Mann nach, dessen Kopf am Fenster immer kleiner wird, ein dunkler Punkt zuletzt. Und den sie nie mehr sehen wird, nie mehr, nie mehr …
„Komm bald wieder“, sagt Vera.
„Gewiß“, erwiderte er, „der Krieg ist ja bald aus.“ Ein Kloß würgte in seinem Hals.
„Wie lange dauert er noch?“ fragte sie.
„Nicht mehr lange.“
Der Stationsvorsteher pfiff gedankenlos. Beide zuckten zusammen. Und die Lokomotive heulte zurück. Es klang wie das Wimmern eines Hundes, dem man versehentlich auf den Schwanz tritt.
Dann zerriß die Panzermine den Leutnant.
Der „Panther“ legte sich auf die Seite und begrub vier Mann, darunter Heinz, den Kommandanten.
„Für Führer, Volk und Vaterland“, stand auf dem Waschzettel, den der Kreisleiter Vera in das Haus brachte, zusammen mit patriotischen Phrasen, unsteten Blicken und ungeduldigem Füßescharren.
Vera hält das Bild von Heinz in der Hand. Er sieht sie mit seinen offenen Augen an, mit Augen, die jetzt gebrochen sind, die nie mehr den Glanz und das Elend dieser Welt sehen können …
Was von der Liebe übrigblieb, vegetierte unter einer Fotografie in einer Wandvase, deren Blumen regelmäßig gewechselt werden.
Vera steht auf, wischt sich mit der Hand über die Stirn, als ob sie dadurch die Erinnerung bannen könnte. Sie denkt verbissen: es ist gut, daß ich Sorgen habe. Es ist gut, daß ich um Werners Leben kämpfen muß. Wenigstens denke ich dann nicht an Heinz. Vielleicht kann man doch einmal vergessen.
Vielleicht …
Ach so, ich muß ja noch Tebster und Morris meine neue Adresse geben.
Die Stimme des Leutnants Tebster klingt frisch und ausgeschlafen.
„Hello!“ ruft er krähend in die Muschel. „How do you do?“
Vera gibt dem CIC-Offizier ihre neue Anschrift. Sie ist jetzt Untermieterin in einer angeschlagenen Wohnung in der Innenstadt.
„Ich bin arbeitslos“, fügt Vera hinzu.
„Macht nichts“, erwidert Tebster. „… Ich beschaffe Ihnen einen neuen Job.“
Damals rollte die Ardennenoffensive weiter. Die Panzer rasselten mit ihren Ketten auf dem steinhart gefrorenen Boden der Straße, ihre Umrisse wuchsen ins Riesenhafte. Die Sondermeldungen jagten sich im Rundfunk. Oft zwei und drei am Tage. Müde, abgehetzte Menschen blieben stehen und horchten ungläubig auf die triumphierende Stimme aus dem Äther. Immer wieder hatte Goebbels vom Tage der Vergeltung gesprochen und von Wunderwaffen gefaselt. War die Stunde gekommen? Sollten die Alliierten aus Belgien, aus Frankreich hinausgejagt werden? Zeichnete sich ein zweites Dünkirchen ab? Die Fortschritte Rundstedts schienen in diesen ersten Tagen so überraschend, so unglaublich, so riesig, daß viele wieder daran zu glauben begannen.
Aber kaum waren die Fanfaren der letzten Sondermeldungen ausgeklungen, da kam die Wende … und die Offensive brach zusammen. Jetzt hatten die Kämpfe ihren Höhepunkt erreicht. Der Tod kassierte seine fetten Zinsen auf beiden Seiten. Die Panzer der deutschen Vorhut waren durchgebrochen. Das Gros Rundstedts schloß dicht zur Hauptkampflinie auf. Häuser, Sträucher, Bäume, Gräben, Hügel und Bäche wurden zur Front … und diese blutende, blitzende, donnernde, brennende Front verwandelte sich für Tausende junger Männer in zweierlei Uniformen zu Gräbern.
Und inmitten dieser Hölle stand Werner Eckstadt, schrie, bangte, zitterte und lief um sein Leben.
„Nicht schießen! Ich bin Deutscher. Nicht schießen! Wartet!“ Seine Stimme war heiser, seine Lungen schmerzten.
Der vordere Panzer stoppte. Werner Eckstadt gefror das Blut in den Adern. Panzer schießen nur, wenn sie halten! Er stolperte schreiend vorwärts, den Panzern entgegen, die Augen vom Entsetzen geweitet, den Mund voll Dreck und Schnee …
Das Turmluk des vorderen Tigers öffnete sich. Von dem auftauchenden Kopf sah Werner Eckstadt nur die FT-Haube. Ein Arm fuchtelte herum und winkte ihn heran.
Werner Eckstadt taumelte auf den Panzer zu.
„Ich bin Deutscher“, rief er noch einmal.
Klausen sah ihm entgegen. Er lachte kalt.
„Mann, Mann“, sagte er gemütlich von seinem Panzerturm herab, „Deutscher bist du? Das fällt euch auch bloß ein, wenn ihr Bauchweh habt. Bist wohl Deutsch-Ami, was?“
„Nein, Obersturmführer“, entgegnete Werner, der jetzt die Rangabzeichen erkannt hatte, „ich bin deutscher Soldat … SS-Rottenführer Eckstadt meldet sich versprengt.“
„Na?“ Klausen turnte langsam von seinem Turm herunter. In seiner Hand hielt er die entsicherte 08-Pistole.
Wieblich, der Richtkanonier, stieg hinter ihm aus.
„Na“, wiederholte Klausen, „jetzt denk dir mal eine gute Geschichte aus. Aber fix, mein Junge!“
Werner Eckstadt schüttelte den Kopf.
„Keine Geschichte, Obersturmführer. Ich gehöre zum ,Sonderkommando Sennelager‘. Wir sind heute nacht mit dem Fallschirm hinter der HKL abgesetzt worden. In amerikanischer Uniform. Geheimeinsatz. Sollten Verwirrung stiften …“
Obersturmführer Klausen pfiff leise durch die Zähne. Er sah Eckstadt scharf an. Irgendwo hatte er gehört, daß es so etwas gab.
„Und wie wollen Sie das beweisen?“ fragte er.
Bevor Werner noch etwas erwidern konnte, packte ihn Wieblich am Arm, streifte den Ärmel seines Unterhemdes hoch und hob den Arm in die Höhe. Der Richtschütze dachte praktisch wie immer. Wenn der Mann nicht log, mußte er den Blutgruppenstempel der SS, das Brandmal für Hitlers Leibeigene, haben.
„Det Ding hat er“, sagte Wieblich verdrießlich. Für ihn bestand der Krieg aus einfachen, klaren Dingen: Angreifen und Menschen totschlagen. Mit den Problemen dieser Offensive kam er nicht mehr mit. „Der hat sich sicher gleich dünne jemacht!“ ergänzte der Richtschütze seine Betrachtungen.
„Und wie kommen Sie denn in die Unterhosen?“ fragte der Obersturmführer.
„Hat ne Schnucke jefunden“, knurrte Wieblich.
„Und wo sind denn Ihre Kameraden?“ meinte der Obersturmführer lauernd.
Werner Eckstadt riß sich gewaltsam zusammen. Wie hatte er damals geflucht, als man die Blutgruppe in seinen Arm ritzte. Diese elende, gedankenlose, allmächtige Bürokratie mußte ihn jetzt retten!
„Obersturmführer, sind Sie schon einmal nachts mit dem Fallschirm abgesprungen? Ich bin in einen Teich gefallen. Die ganze Uniform war versaut. Ich wäre doch mit dem klitschnassen Zeug keine drei Schritte weit gekommen! In diesem Zustand kann man nicht Ami spielen. Ich wollte meine Klamotten erst mal trocken kriegen. Ich fand eine Scheune …“
Werner sprach hastig. Er redete sich den Kloß der Angst heraus, der ihm in der Kehle saß.
„Nu’ sabber’ nich so ville!“ entgegnete Wieblich.
Der Obersturmführer lächelte.
„Na, ist schon gut. Melden muß ich Sie natürlich. Aber jetzt steigen Sie erst mal ein. Ihr kalter Arsch wird sich bei uns schnell aufwärmen.“
Als Werner Eckstadt in den Panzer kletterte, merkte er erst, wie seine Knie schlackerten.
Im Augenblick war er aus allem heraus. Aber er sollte den Tiger noch verfluchen …
Die anderen, die mit Werner Eckstadt abgesprungen waren, hatte der Wind abgetrieben. Nur Obersturmführer Friedberg und Unterscharführer Roettger blieben zusammen. Sie landeten an einem Waldrand. Den Obersturmführer erwischte beim Aufkommen noch eine der letzten Tannen und schürfte ihm die Haut im Gesicht auf.
Sie vergruben ihre Fallschirme, schwiegen und lauschten in die Nacht. Sie warteten auf Haubach, auf Seyfried und auf Eckstadt. Nach einer halben Stunde sagte der Obersturmführer:
„Na, denn nicht …“
Roettger hatte verflucht die Nase voll.
„Was machen wir jetzt?“ fragte er leise. Er hoffte, daß der Obersturmführer sagte: „Jetzt verpissen wir uns.“
Aber Friedberg entgegnete gar nichts, sondern begann zu tippen. Erst die Waldschneise hinunter, dann einen Feldweg entlang, bis sie auf eine Straße stießen.
„Haben Sie eine Ahnung, wo wir sind?“ fragte der Uscha.
Friedberg schüttelte den Kopf.
„Wird sich schon herausstellen“, knurrte er dann.
Plötzlich begann die Straße leicht zu beben. Man konnte das dumpfe Brummen von Motoren hören, die ganz in der Nähe laufen mußten.
Roettger sprang in den Straßengraben.
„Mensch!“ sagte der Obersturmführer laut, „Mensch, wir sind doch Amis, was brauchen wir uns in den Straßengraben zu legen.“
Es war eine amerikanische Nachschubkolonne. Der Obersturmführer ließ sie lässig passieren. Er stand breitbeinig am Straßenrand und dokumentierte so, daß die amerikanische Militärpolizei allgegenwärtig ist. Er hatte ja die dunkelblaue MP-Binde am Oberarm.
Ein Jeep scherte plötzlich aus der Kolonne aus. Mit abgeblendeten Lichtschlitzen. Ein Captain beugte sich aus dem Wagen und fragte, ob er auf dem richtigen Weg zur zweiten amerikanischen Luftlandedivision sei.
„That’s right, Sir“, antwortete Friedberg.
Der Captain wollte weiterfahren, aber Friedberg, der falsche MP-Posten, verlangte noch mit eisernem Gesicht die Papiere, die er im Schein seiner Stablampe prüfte.
„Sie haben Nerven!“ sagte Roettger, als alles vorbei war.
„Wir werden noch welche brauchen“, meinte der Obersturmführer.
Sie gingen weiter die Straße entlang. Die kalte Luft des nachtdunklen Morgens vibrierte vom Röhren der Motoren, Panzerfahrzeuge, Lkws, Jeeps und Zugmaschinen. Amerika transportierte seine Macht, und zwei verkleidete, deutsche SS-Männer tippelten die Straße entlang, um diese Macht zu brechen.
Friedberg und Roettger sahen die Straßenkreuzung schon von weitem. Die Kolonnen schienen sich dort zu verzahnen und gleichzeitig in alle Richtungen auseinanderzulaufen. Im tanzenden Licht der schmalen Scheinwerferbündel verzerrten sich die Schatten der Fahrzeuge ins Groteske.
Sie waren auf hundert Meter heran, da stieß der Obersturmführer den Uscha in die Rippen.
„Militärpolizei“, sagte er gepreßt.
Neben der Kreuzung war ein Baum, unter dem Baum stand ein Jeep. Der Wind verwehte das Quäken seines Funkgeräts. Roettger folgte dem ausgestreckten Arm Friedbergs und bemerkte mitten auf der Kreuzung die beiden Militärpolizisten, die den Verkehr regelten.
„Da gibt’s nur eins“, sagte der Obersturmführer, „nicht schießen. Nur schlagen …“
Er nahm seine Pistole mit dem Lauf in die Hand. Roettger tat dasselbe, obwohl er am liebsten damit dem Obersturmführer eins übergebraten hätte. Aber der Befehl war stärker als die Vernunft.
Sie schlichen sich von hinten an den Baum heran. Wenn ein Lichtstrahl von der Kreuzung über das Feld huschte, warfen sie sich in Deckung. Auf zehn Meter sahen sie den Jeep. Zwei Amis saßen darin. Sie lehnten mit dem Oberkörper zurück und ließen ihre Beine über die Bordwand baumeln. Wie ein Schatten huschten Friedberg und Roettger auf sie zu, stürzten sich gleichzeitig auf sie. Einer der Amis konnte sich hochrappeln. Da hatte er auch schon den Pistolenknauf des Obersturmführers im Mund und gurgelte mit Blut und Zähnen. In seiner sinnlosen Angst drosch Roettger so lange auf den MP-Mann ein, bis dessen Kopf weich war wie eine gesplitterte Eierschale.
„Hör auf!“ zischte Friedberg, „siehst du nicht, daß der genug hat.“ Auch er hatte seinen Mann erledigt.
Sie zogen die Beine der GIs in den Wagen. Sicherheitshalber stach der Obersturmführer jedem der beiden mit dem Messer in die Brust, damit es hinterher kein Mißverständnis geben würde …
Die Kreuzung war jetzt wie leergefegt. Einer der beiden Posten langweilte sich und ging auf seinen Wagen zu … in dem Roettger und Friedberg neben zwei toten Amis kauerten.
„Meinetwegen machen wir sie auch auf Raten fertig“, sagte der Obersturmführer.
Es ging blitzschnell. Der Mann konnte keinen Laut mehr ausstoßen. Er verwechselte in dem dämmerigen Licht seine Mörder mit seinen Kameraden.
Auch der letzte der vierköpfigen MP-Streife starb lautlos. Friedberg und Roettger hatten nun einen Wagen erbeutet. Nur das Funkgerät des Jeeps machte ihnen Sorgen, weil es pausenlos in Betrieb war. Sie konnten nicht antworten, denn die Amerikaner funkten verschlüsselt.
„Mal sehen, wieviel Zeit die uns lassen“, bemerkte der Obersturmführer sarkastisch.
„Sie wollen sich doch hier nicht auf die Straßenkreuzung stellen?“ fragte Roettger, dem die Angst den Rücken heraufkroch. Er konnte die Übelkeit nicht mehr länger unterdrücken. Er lehnte sich mit der rechten Hand gegen den Baumstamm und übergab sich. Der Obersturmführer lächelte.
„Fertig? – Was dachten Sie denn, wir sind doch hier nicht zum Indianerspielen.“
Sie stellten sich auf die Straßenkreuzung wie echte MP-Posten. Wieder rollten die Fahrzeuge im breiten Strom heran. Gerade konnte der Obersturmführer noch die Wegweisertafeln abmontieren.
Kolonne auf Kolonne stoppte an der Straßenkreuzung. Die Amerikaner brüllten und fluchten. Friedberg schickte sie in alle Richtungen, immer entgegengesetzt der HKL. Mit Nachschubeinheiten konnte man alles machen, die kannten sich nie im Gelände aus. Die meisten wies Friedberg in Richtung Namur.
Jetzt traten die ersten Stockungen ein. Fahrzeuge verstopften die Straße. Kolonnen kamen sich entgegen, prallten aufeinander, das Chaos wuchs von Minute zu Minute.
Roettger folgte mechanisch den Handbewegungen seines Obersturmführers. Er wußte, daß es nicht mehr lange dauern konnte, bis die Amis die Quelle des Durcheinanders entdeckten. Und immer noch quäkte das Funkgerät des Jeeps …
Roettger wollte abhauen, aber er wagte es nicht. Der Mann neben ihm war wie besessen. Sein Gesicht glänzte. Er schien keine Nerven und kein Gefühl zu haben. Er schien an der Sache noch Spaß zu finden, am Abschlachten, am Irreführen, an der eigenen Angst, am Durcheinander. Der ist doch verrückt, dachte sich Roettger und stand immer noch angewurzelt.
In diesem Augenblick geschah es.
Friedberg war auf das Trittbrett eines riesigen Trucks getreten und hatte dem Fahrer etwas zugebrüllt.
„He, Joe!“ schrie der Ami mit krebsrotem Gesicht, „bist du verrückt geworden?“
Dann sah er, daß es nicht Joe war, erkannte die Zusammenhänge blitzschnell. Vielleicht war er schon mit Argwohn an die Kreuzung gekommen. Jedenfalls, bevor Friedberg noch zuschlagen konnte, hatte er die Pistole in der Hand, zielte oberflächlich, drückte ab.
Friedberg spürte die Explosion im Gesicht. Er taumelte, wollte die eigene Waffe herausreißen, da blitzte es wieder. Die Schüsse hörte er nicht mehr, er fühlte nur, wie ihm die Gedärme zerrissen wurden. Etwas blies ihm die Backen auf. Er konnte das Blut nicht mehr ausspucken. Bevor es Nacht um ihn wurde, für immer, sah er Roettger in weiten Sprüngen über das Feld flitzen. Er kam nicht weit. Er blieb in einer konzentrischen Garbe liegen. Dann sah Obersturmführer Friedberg noch lauter Militärpolizisten um sich herum, und ihre blauen Armbinden wurden immer bunter, immer größer.
Die Ablösung, dachte er noch, die Ablösung …
Mit Haubold und dem kleinen, strohblonden Seyfried spielte das Schicksal nicht so dramatisch. Seyfried war viel zu ängstlich, um sich zu verkrümeln. Er hätte mit klappernden Zähnen alles mitgemacht. Aber als er zu Boden gekommen war, blieb er allein. Er versuchte aus der Erinnerung an die monatelange Schulung etwas herauszukramen, was jetzt von Nutzen sein könnte. Aber es fiel ihm nichts ein. Alle seine Gedanken mündeten in der Angst.
„Es ist alles Scheiße!“ sagte er halblaut und erschrak vor seiner eigenen Stimme.
Dann fing er an zu rennen. Immer nach Osten. Aber er kam an Straßen, auf denen Amis fuhren und brüllten. Da rannte er wie ein scheuender Gaul wieder zurück. Er erschrak vor Fußspuren, die er im Schnee fand … bis er entdeckte, daß es seine eigenen waren. Er hatte sich im Kreis bewegt.
Seyfried heulte. Er ballte die Fäuste. Er stolperte, fiel und brach sich das Handgelenk. Mit der unverletzten Hand fühlte er einen Draht. Es war das Kabel eines Feldtelefons. Es muß irgendwohin führen, dachte er. Von jetzt ab war ihm alles egal …
Er nahm das Kabel hoch und lief an ihm entlang. Alle hundert Meter brüllte er auf amerikanisch:
„Hello!“
Erst nach einer Viertelstunde bekam er die Antwort. Aus dem Unterholz traten ihm vier Amerikaner mit vorgehaltenen Maschinenpistolen entgegen. Er sah Geschütze unter Tarnnetzen. Seyfried war mitten in eine amerikanische Artilleriestellung geraten.
„Where are you from?“ fragten ihn die Amis … „Wo kommst du her?“
Eine Sekunde überlegte Seyfried, ob er sich doch noch auf das verzweifelte Spiel einlassen sollte. Aber er hatte nicht mehr die Nerven.
Er gestand alles.
Sie brachten ihn zu ihrem Bataillonskommandeur. Der Major reichte ihn an die Division weiter. Von baumlangen Polizisten geführt, wurde Seyfried von Stellung zu Stellung nach hinten gebracht. Seine Geschichte verbreitete sich blitzschnell. Er lief durch die spalierstehenden Amis wie ein Tanzbär am Kirchweihfest durch die aufgeregte Dorfjugend.
Noch einmal hörte man sich die Geschichte des SS-Sturmmannes Seyfried an, ohne eine Miene zu verziehen.
„Ich hatte es satt … es ist doch alles sinnlos“, erklärte Seyfried immer wieder.
„Und wie viele von unseren Leuten haben Sie umgebracht, bevor Sie einsahen, daß alles sinnlos ist?“ fragte der verhörende Captain.
„Keinen Menschen“, beteuerte der blonde Seyfried.
„Es ist ohnedies egal“, erwiderte der Captain. „Sie stehen nicht unter der Haager Konvention. Das mußten Sie ja wissen, als Sie unsere Uniform anzogen.“
In einem kalten Keller irgendwo in Belgien erfuhr Seyfried am Heiligen Abend von einem mitleidigen Posten, daß die Ardennenoffensive längst zusammengebrochen war.
Es ist alles so sinnlos, dachte Seyfried noch einmal. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde er erschossen. Die amerikanische Division verlegte ihre Stellung sowieso nach vorne, und es bestand kein Grund, ihn noch weiter mit herumzuschleppen.
Haubold hatte es am besten von allen Fallschirmspringern, die zusammen mit Werner Eckstadt abgesetzt worden waren. Er hatte in der Nacht zum 17. Dezember einen wunderbaren Landeplatz gefunden. Ein freies Feld. Aber der Wind war zu stark, und Haubold glitt beim Aufprall aus. Er kam nicht mehr dazu, seinen Fallschirm zu überlaufen. Die aufgeblasene Seide zog ihn in einem Höllentempo quer über das ganze Feld. Haubold hatte den Kopf nach unten, die Beine in der Höhe. Sein Schädel schlug gegen Steine und Wurzeln.
Ein Koppelzaun trennte ihm den Kopf wie mit dem Rasiermesser vom Rumpf.
Belgische Bauern fanden ihn und beerdigten ihn mit allen Ehren als einen der Befreier, auf die sie seit Jahren gewartet hatten. Ais sie später der amerikanischen Armee das Grab nannten, konnten sie den Fall nicht mehr genau rekonstruieren.
Und so wurde Haubold in die Liste der unbekannten amerikanischen Soldaten aufgenommen. Und amerikanische Mütter weinen um ihn an den Ehrenmälern, die es dafür gibt …
Werner Eckstadt hockte in dem Panzer auf dem Platz, den ihm Obersturmführer Klausen zugewiesen hatte. Sein Sitz war miserabel. Die heißen Kartuschen mußten ihm unweigerlich ins Kreuz fliegen, falls der Panzer schoß. Außerdem mußte er sich klein machen. Vom ständigen Bücken verkrampfte sich sein Rücken.
Zum Glück fuhren sie nicht über Felder, sondern auf einer Straße. Das merkte Werner an der Erschütterung. Kein Mann der Panzerbesatzung wußte, daß es genau die gleiche Straße war, auf der Obersturmführer Friedberg und Unterscharführer Roettger in der Uniform des Feindes vor Stunden entlanggetippelt waren.
„Wenn’s jetzt nicht bald was gibt, Obersturmführer“, sagte der Fahrer Saalbeck, „dann sehen wir sauber aus.“ Er meinte Sprit für den Panzer, denn die Nadel des Brennstoffanzeigers zitterte knapp bei der Hundertlitermarke.
„Wird schon“, erwiderte der Obersturmführer.
Eine. Sekunde später befahl er:
„Turm auf elf Uhr!“
Saalbeck sah es im gleichen Augenblick. Knapp links voraus, in etwa 200 Meter Entfernung eine Straßenkreuzung. Es war die Stelle, an der die Leichen von Friedberg und Roettger lagen …
Auf der Kreuzung drängte sich der amerikanische Nachschub genauso noch wie vor Stunden. Obersturmführer Klausen hatte das Kehlkopfmikrofon vor dem Mund. Er wies die hinter seinem Tiger fahrenden Panzer seiner Einheit ein. Er ließ sie seitlich ausschwenken zu einer breiten Feuerfront. Er nahm die Augen nicht von der Zieleinrichtung. Klausen wollte selbst schießen und überließ Wieblich nur das Turm-MG. Die Gummimuschel klebte an den Augenbrauen des Obersturmführers.
Er sah, wie es drüben eine Stockung gab. Männer sprangen von den Fahrzeugen. Eine leichte Flak bellte. Maschinengewehre meckerten.
„Ach du jriene Neune!“ sagte Wieblich, „euch wern mer wat blasen!“
„Sprenggranate!“ befahl Klausen. „Aufschlagzünder.“
Die Patrone klackte in den Verschluß der 8,8 Panzerkanone.
Dann sagte der Obersturmführer nichts mehr. Er ließ die Straßenkreuzung auf der Spitze seines Zieldreiecks tanzen. Sein Handballen schwebte über dem roten Knopf.
Der Tiger brüllte auf, hob sich leicht.
„Rack … rrrack“, flog der Verschluß im Panzer zurück und vor. Die Kartusche polterte. Eckstadts Ohren sangen.
Der Schnee vor dem Tiger färbte sich schwarz. Schuß auf Schuß jagte hinaus. Neben ihm krachte es, rechts, dann links. Die orangenen Blitze standen über dem Schnee wie Marmelade auf Götterspeise.
Die Hölle gab ein Gastspiel …