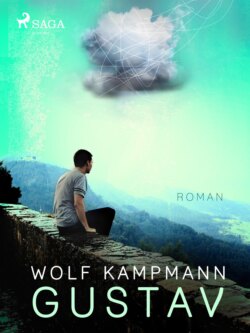Читать книгу Gustav - Wolf Kampmann - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.
ОглавлениеGustavs Vater Walter war ein Mann vom alten Schlag, wie es so schön heißt. Er war schlank, bewegte sich langsam, aber entschlossen und bewahrte in jeder Lebenssituation Haltung. Nichts schien ihn aus der Ruhe zu bringen. Ins behäbige Dresden mit seiner bürgerlichen Gemütlichkeit passte der nüchterne Hanseat wie Knäckebrot zu Eierschecke. Ursprünglich kam er aus Kiel, viel mehr wusste Gustav aber nicht über die Jugend seines Vaters. Dass er mal ein Kind gewesen sein könnte, ging über seine Vorstellungskraft hinaus. Nein, sein Vater musste schon immer ein Erwachsener gewesen sein.
Freunde hatte auch Walter Bülow keine, und wenn doch, dann kannte Gustav sie nicht. Der Vater schien sich auch nicht nach Gesellschaft zu sehnen. Zu gern hätte Gustav ihm offenbart, wie gut er ihn verstand. Doch das hätte der Vater nie zugelassen. Manchmal traf er sich mit Geschäftsfreunden, aber er brachte sie niemals mit nach Hause. Der größte Teil seiner Freizeit spielte sich verlässlich im Kreis der Familie ab. Seine Eltern sprachen in Gegenwart der Kinder nicht viel miteinander und doch schienen sie auf wundersame Weise eng verbunden.
Vor allem redete der ältere Bülow nicht gern über sich. Das Wenige, das Gustav über ihn wusste, hatte er von der Mutter. Die Prähistorie seiner eigenen Existenz erschien ihm ohnehin wie ein Mythos aus grauer Vorzeit. Kaum zu glauben, dass es mal eine Zeit gegeben hatte, in der die wie durch ein göttliches Gesetz verbundenen Eltern sich nicht gekannt hatten.
Walter Bülow und Gustavs Mutter Clara, geborene Brandt, hatten sich, soweit Gustav rekonstruieren konnte, einige Jahre vor dem Weltkrieg kennengelernt. Sie waren sich im Park begegnet. Clara war Walter sofort aufgefallen. Fast unmerklich hatte er ihr zugenickt, und sie hatte mit einem verräterischen Blick aus ihren wunderschönen grauen Augen geantwortet. Am nächsten Sonntag kehrte er zur selben Zeit am frühen Nachmittag in den Park zurück, das Frollein, wie er sie damals vor sich selbst nannte, war wieder da. Er fand sie zauberhaft und meinte, sie hätte trotz des kühlen Wetters ein besonders reizvolles rötlich schimmerndes Kleid angezogen – nur für ihn, da war sich Walter sicher. Was hätte er darum gegeben, sich ihr so dicht zu nähern, um das zweifellos betörende Rascheln ihrer Falten und Säume zu hören. Doch eine derartige Indiskretion verbot sich von selbst. Auch diesmal sollte es nur zum einmaligen kurzen Blickwechsel kommen.
Von nun an trafen sie sich jeden Sonntag zur selben Stunde. Nie sprachen sie ein Wort miteinander. Walter achtete stets peinlich darauf, dass sein kurzes Haar perfekt saß und sein weißer Sonntagsanzug keine Falte zu viel aufwies. Er steckte sich je nach Saison eine Blume ins Knopfloch und wartete aufgeregt, ob seine Angebetete wieder im Park erscheinen würde. Pünktlich um drei Uhr nachmittags tauchte sie auf und gab vor, ihn nicht zu bemerken. Selbstredend überspielte auch er sein Interesse, so gut es ging. Bis es zum ersehnten Blickwechsel kam und beide glücklich wieder auseinandergehen konnten.
Es war ein unverabredetes Spiel: Wer hielt es länger aus, den anderen zu ignorieren. Sie waren zwei Menschen, die, magnetisch voneinander angezogen, jeden Sonntag demselben Ritual folgend zur gleichen Zeit an derselben Stelle aufeinander lauerten. Walter hatte niemanden, dem er sich hätte anvertrauen können, denn schon damals legte er keinen Wert auf die Gesellschaft von Freunden. Womöglich hätte er Clara niemals angesprochen, wäre nicht der Krieg dazwischengekommen, der damals noch nicht Weltkrieg hieß.
Für Walter war es keine Selbstverständlichkeit, seine Pflicht gegenüber dem Vaterland zu erfüllen. Von der allgemeinen Kriegsbegeisterung blieb er relativ unbeeindruckt, er hatte weder einer Burschenschaft noch einem damals wie Pilze aus dem Boden schießenden Verein angehört. Walter Bülow brannte in keiner Weise darauf, dem Feind zu zeigen, was es bedeutete, sich mit dem Kaiser anzulegen. Pathos und übertriebene Leidenschaft waren seine Sache nicht. Doch er wusste, dass man ihn auf jeden Fall einziehen würde. Als Freiwilliger rechnete er sich gewisse Privilegien aus, die ihm die berüchtigten Drangsalierungen im deutschen Militär ersparen würden.
Eigentlich wollte er zu Kaiserlichen Marine, denn für Schiffe hatte er sich schon immer begeistert, doch dort wurde ihm eröffnet, man nehme keine Schwimmer – und Walter schoss durchs Wasser wie ein Delfin. Jeder aber, der schwimmen konnte, war ein potenzieller Deserteur, der sich in die Fluten retten würde, sowie es darum ginge, das Schiff mit seinem Leben zu verteidigen. So ging Walter zur Infanterie, die erstaunlicher Weise sehr wohl Freiwillige nahm, die laufen konnten. Eine Woche, bevor er seinem Stellungsbefehl Folge leisten musste, nahm er allen Mut zusammen und sprach Clara im Park an: »Frollein, würden Sie mich ein Stück begleiten?«
Walter war erstaunt, wie wenig es ihm ausmachte. Es fühlte sich gut und richtig an. Und Clara beschenkte ihn mit dem dankbarsten Augenaufschlag, den der kühle Charmeur je gesehen hatte. Arm in Arm gingen sie in eine Konditorei und Walter fragte unumwunden, ob er Frollein Clara – deren Namen er jetzt kannte – am nächsten Tag wiedersehen dürfe. Diesmal blickte sie beschämt nach unten, und er hätte zu gern gewusst, ob sie errötete. Aber seine Manieren verboten es ihm, genau hinzusehen.
Am letzten Tag vor seiner Einberufung verlobten sich Walter und Clara. Sie wagten es nicht einmal, einen Kuss auszutauschen. Keiner von beiden ahnte, dass sie sich sechs lange Jahre nicht wiedersehen würden. Walter schrieb hin und wieder Briefe von der Front. Prahlerei von Kriegsabenteuern lag ihm fern. Nüchtern und in knappen Worten erzählte er vom Krieg, als wäre es eine Sache der Buchhaltung. Die Anrede lautete immer: »Liebes Fräulein Clara«, das Wort »du« schien Walter nicht zu kennen, und am Ende jedes Briefes standen die Worte »Ergebenst, Walter Bülow«.
Clara ersehnte die Briefe, doch wenn sie ehrlich zu sich selbst war, langweilte sie das Kriegsgeschreibsel ihres Walters, wie sie ihn jetzt nannte. Trotzdem hielt sie es für ihre Pflicht, sie nach dem flüchtigen Lesen wie kostbare Schätze in einer Perlmutt-Schatulle abzulegen, die sie eigens dafür angeschafft hatte. Manchmal erklärte er ihr in vorsichtigen Worten, dass er an sie denke, sich nach ihr sehne und sich auf ihr Wiedersehen freue. Doch, ähnlich gesonnen wie ihr Verlobter, empfand Clara das eher als peinlich. Sie war praktisch veranlagt. Warum das Herz an jemanden verschwenden, der vielleicht nie aus dem Krieg zurückkommt. Aber sie hielt ihm die Treue, nicht aus innerer Verbundenheit oder gar Verliebtheit, sondern aus Pflichtgefühl vor Gott. Immerhin waren sie verlobt.
Zwei Jahre, nachdem Walter in den Krieg gezogen war, kam ein dickerer Umschlag als sonst. Clara öffnete ihn behutsam und fand neben dem beschriebenen Briefbogen einen Gegenstand, der in fleckiges Packpapier eingewickelt war. Sie wickelte das verklebte Päckchen behutsam aus, schrie aber jäh auf, als ihr der darin verborgene Gegenstand auf die Handfläche kullerte. Es war ein verformtes Stück Metall, an dem Knochensplitter und getrocknete Fleischreste klebten. Clara beförderte diese ihrer Ansicht nach beispiellose Geschmacklosigkeit auf der Stelle empört in den Müll und sprach mit niemandem ein Wort darüber. Wie konnte ein Mann von Kultur und Benehmen sich in so kurzer Zeit in einen solchen Barbaren verwandeln? Wütend wünschte sie sich, sie hätte Walter niemals kennengelernt. Doch verlobt ist verlobt.
Als hätte Walter Claras Wunsch an der fernen Front erraten, blieben von jenem Tag an weitere Briefe von ihm aus. Bülow war von einem Granatsplitter schwer verwundet worden und in englische Gefangenschaft geraten. Er nutzte die Zeit im Lager, um sich der englischen Sprache zu bemächtigen. Sein Organisationstalent und seine bedachte Art brachten ihm zudem die unter den gegebenen Umständen ebenso vorteilhafte wie angenehme Funktion eines Sekretärs in der Schreibstube ein. Walter lernte, sich in den einstigen Feind hineinzudenken und ihm Respekt entgegenzubringen. Und er wurde seinerseits respektiert. All die Ressentiments, die ihn auf dem Weg an die Front begleitet hatten, lösten sich im Handumdrehen auf. Menschen, so konstatierte Walter Bülow hanseatisch nüchtern sich selbst gegenüber, waren überall Menschen, solange sie sich menschlich verhielten.
Alles in allem hatte er unter der Kriegsgefangenschaft weit weniger zu leiden als die meisten seiner Kameraden, die er im Winter 1918 massenweise an der Grippe sterben sah. An die Heimat dachte er in dieser Zeit selten. Clara ahnte von alledem nichts. Sie vertraute auf Gott und darauf, dass Walter nichts zugestoßen wäre, zweifelte aber nachts klammheimlich daran, dass er noch lebte. Ob sie das eine oder das andere hoffen sollte, konnte sie sich in diskreten Momenten selbst nicht beantworten. Dafür schämte sie sich.
Ende 1920 stand Walter dann plötzlich wieder vor ihrer Tür. Ohne jede Ankündigung. Clara hatte zahllose Schauergeschichten von hoffnungslos verlotterten, ausgemergelten Heimkehrern in zerlumpten Uniformen gehört, die sich nicht mehr ans normale Leben im Frieden gewöhnen konnten, ihre Frauen oder Verlobten verprügelten und in den häuslichen vier Wänden ihren Krieg weiterkämpften. Oder von anderen, die zwar friedlich waren, dafür aber Beine oder Augenlicht verloren hatten. Vor einer solchen Rückkehr eines geistig oder körperlich Verstümmelten hatte sie immer Angst gehabt.
In den Straßen von Kiel sah sie einige dieser bejammernswerten Gestalten herumlungern. Ob es für diese armen Gottesgeschöpfe nicht besser gewesen wäre, wenn der Krieg sie einfach verschluckt hätte, statt sie wieder in den deutschen Alltag zu spucken? Doch nicht nur die Tatsache, dass Walter überhaupt heimgekehrt war, überraschte sie. Nein, er hatte sich tatsächlich die Zeit genommen, sein Äußeres in einen tadellosen Zustand zu bringen.
Im perfekt sitzenden weißen Anzug stand er in der Tür, einen Strauß Rosen in der Hand, ein leichtes Lächeln auf den Lippen, so als sei er von einer ganz normalen Reise mit der Eisenbahn zurückgekommen. Er sah reifer, um nicht zu sagen besser aus. Der Krieg hatte aus dem schlaksigen Jüngling einen Mann gemacht. Was er an der Front und in der Gefangenschaft erlebt hatte, behielt er zum größten Teil für sich.
Clara war stolz auf ihren Walter. Vor dem Krieg hätte sie nie gedacht, dass sie den kantigen Galan so lieben könnte. Wenige Wochen nach seiner Rückkehr heirateten sie, drei Jahre darauf kam Ingeburg zur Welt. Die Namensfindung für das Mädchen sorgte anfänglich für ein kurzes Zerwürfnis zwischen den jungen Eheleuten.
»Es muss doch Ingeborg heißen«, wandte Walter für seine Verhältnisse ungewöhnlich verständnisvoll ein, als er den Namenswunsch seiner Frau vernahm. Dabei betonte er mit leichtem Nachdruck die letzte Silbe des Namens. Doch Clara bestand auf Ingeburg. Das Mädchen sollte stark sein, denn die Zeiten könnten hart werden. Walter spürte, dass er dieses eine Mal nachgeben musste. Er würde sie einfach Inge nennen.
Die kleine Familie zog zunächst nach Dessau. Walter war ein gefragter Ingenieur, der leicht Arbeit erhielt. Sein dreiköpfiger Haushalt brauchte nicht viel, Walter und Clara führten ein bescheidenes Leben. Er kümmerte sich um die Arbeit, sie um Haushalt und Kind. Er brachte das Geld nach Hause und keiner von beiden stellte jemals Fragen. Streit war zwischen den Eheleuten Bülow ebenso unbekannt wie sexuelle Leidenschaft, eher kam es vor, dass sie mehrere Tage kein Wort wechselten. Jahrzehnte später bekannte Clara nicht ohne Stolz, dass ihr Mann sie niemals nackt gesehen habe. Walter stieg in kurzer Zeit zum Prokuristen einer Firma auf, die Zulieferteile für Motoren herstellte, und konnte ein wenig Kapital ansparen, das später als Grundlage für sein eigenes Unternehmen dienen sollte.
In Dessau hielt es die Bülows nur wenige Jahre. Die Grundlage für seine wirtschaftliche Unabhängigkeit legte er eine Eisenbahnstunde elbaufwärts in Dresden. Dort übernahm er eine Firma, die sich auf das Gießen von Metallbuchstaben spezialisiert hatte.
Die Gießerei Bülow erarbeitete sich schnell einen guten Ruf, das Geschäft florierte. In der Gefangenschaft hatte Walter Bülow Demut gelernt. Er war dankbar für den Wohlstand und die Sicherheit, die er seiner Familie bieten konnte. Es gelüstete ihn nicht nach dem großbürgerlichen Prunk, dem sich andere Firmeneigentümer in einer Situation hingaben, die mit seiner vergleichbar war. Mit sicherem Gespür für die richtigen Entscheidungen brachte er sein Unternehmen durch die Jahre der wirtschaftlichen Misere. Buchstaben, Türschilder, Firmentafeln und alle Arten von Schriftzügen wurden selbst in Krisenzeiten gebraucht.
Seine Mitarbeiter achteten ihn, obwohl er auch im Betrieb distanziert und wortkarg war. Aber er blieb immer korrekt und menschlich. Ungerechtigkeiten seitens seiner Vorleute duldete er nicht. Jeder Arbeiter war ein Teil der Firma und damit unverzichtbar. Mehr als einmal mokierte sich Clara über den familiären Ton, den sich ihr sonst so gestrenger Gatte von seinen Mitarbeitern bis zum Pförtner gefallen ließ. Doch gerade dieser überaus fortschrittliche Gemeinschaftsgeist gehörte zum Erfolgsrezept der Gießerei Bülow.
1928 genossen die Bülows ausreichend Sicherheit, um über ein zweites Kind nachdenken zu können, und im September 1929 kam der kleine Gustav zur Welt. Diesmal gab es mit dem Namen kein Problem. Walter wollte ihn nach seinem Vater Gustav Louis nennen, Clara hielt es für geboten, sich diesmal in Zurückhaltung zu üben, und so wurde der neugeborene Junge auf den Namen Gustav Louis getauft.
Gustav wuchs in dem angenehmen Gefühl heran, zu einer Familie zu gehören, der auf breiter Ebene Respekt entgegengebracht wurde. Trotz ihres relativen Wohlstands lebten die Bülows in der bescheidenen Dreizimmer-Parterre-Wohnung eines modernen Mietshauses zwischen weitläufigen Gärtnereien. Zu den übrigen Mitbewohnern wurden allerdings keine sozialen Kontakte gepflegt. Auch Gustav hielt sich von den anderen Kindern fern. Später, so betonte der Vater, sollte der Filius einmal die Gießerei übernehmen. Gefragt, ob er das wolle, wurde der designierte Nachfolger nicht. Es stand so unverrückbar fest wie die Gravur in einem von Bülows Metallschildern. Gustav dachte bei sich, bis ich groß bin, vergeht noch viel Zeit, lass den Vater reden.
Inge wiederum wäre nur zu gern Walters Nachfolgerin im väterlichen Betrieb geworden und machte diesbezüglich den Eltern gegenüber keinen Hehl. Doch für die waren das nur reine Hirngespinste eines übermotivierten Mädchens, das seinen Platz im häuslichen Leben schon noch finden würde. Denn so liberal Walter Bülow im Geschäft war, so streng achtete er daheim auf die Einhaltung der gesellschaftlichen Konventionen.
Wovon Gustav damals noch keine Ahnung hatte, war der Lauf der Zeit selbst, der sich um die Geschicke seines Elternhauses oder des Einzelnen überhaupt nicht scherte. Dass im Januar 1933 ein gewisser Adolf Hitler die Macht in Deutschland an sich gerissen hatte, kümmerte ihn nicht weiter, denn er war noch klein und die Eltern hielten Politik von ihren Kindern fern. Das allgegenwärtige Konterfei des Führers war für den kleinen Gustav genauso ein selbstverständlicher Anblick wie das Doppelporträt der Eltern auf der Kredenz in der Stube. Für ihn selbst hatte sich ja nichts geändert.
Wenn ihnen auf den Straßen Dresdens die Männer mit den braunen Uniformen begegneten, war der Vater auffällig wortkarg. Gustav mochte die Uniformen und vor allem die roten Armbinden mit dem Hakenkreuz, das er so gern malte. Dem Vater missfielen diese Zeichnungen seines Juniors, doch die Mutter zischte ihm stets etwas zu, das Gustav nicht verstehen konnte.
Einmal jedoch, als er den Eltern fröhlich verkündete, er wolle zum Fasching als SA-Mann gehen, verlor sein alter Herr die Fassung. Ungewöhnlich laut machte er ihm deutlich, das komme nicht in Frage. »Du kannst als Indianer, Trapper oder von mir aus als Schornsteinfeger gehen, aber nicht als SA-Clown. Hast du mich verstanden?«
Mit diesen Worten verschwand der Vater in seinem Zimmer und schloss leise die Tür. Gustav wäre es lieber gewesen, er hätte sie geschmissen, aber das war eben nicht die Art des Bülow-Häuptlings, wie Gustav ihn gern respektvoll nannte. Wenig später kam das Familienoberhaupt wieder aus seiner Festung heraus, ging in die Hocke, ergriff seinen Sohn an beiden Oberarmen, kam seinem Gesicht ungewöhnlich nah, um ihm tief in die Augen zu blicken, und ermahnte ihn leise, aber eindringlich: »Das mit dem Clown erzählst du bitte niemandem. Hast du mich verstanden? Keinem Menschen. Auf gar keinen Fall.«
Gustav hätte es nicht gewagt, der Autorität des Vaters zuwider zu handeln. Aber er verstand keineswegs, was an dieser Bemerkung so schlimm gewesen sein sollte. SA-Clown, das klang doch lustig.
Über den Vorfall wurde nie wieder gesprochen. So war das im Hause Bülow üblich. Die Mutter nähte Klein-Gustav die gewünschte Uniform und der ging zum Fasching als stolzer SA-Mann. Er genoss es, wie die Leute ihm auf der Straße wohlwollend zulächelten. Heil Hitler, Gusti!