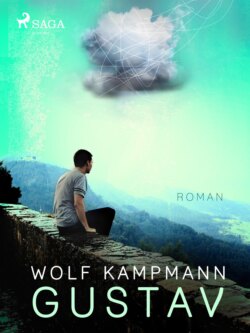Читать книгу Gustav - Wolf Kampmann - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Das Untier
ОглавлениеEs war so dunkel, dass man nicht mehr die Hand vor den Augen erkennen konnte. Das ist nicht nur so ein Spruch, ich habe es wirklich ausprobiert. Erst mit gespreizten und dann mit geschlossenen Fingern. Gesehen habe ich nichts. Es muss so gegen Mitternacht gewesen sein. Mond und Sterne waren hinter dichten Wolken verschwunden, es war totenstill. Außer dem Rauschen der Polenz und hin und wieder dem Schrei eines Käuzchens war nichts zu hören.
Habt ihr schon mal den Schrei eines Käuzchens gehört? Das klingt seltsam. Schrill, aber zugleich abgehackt und erstickt. Irgendwie gruselig. Gar nicht wie eine Eule, sondern als würde jemand versuchen, dich aus deiner Sicherheit zu locken. Kein Irrlicht, eher eine Art Irrklang. Ich habe mich an all die Gruselgeschichten erinnert, in denen ein Käuzchen mit seinem Schrei auf dem Friedhof die Toten aufweckt.
Mein Vater hat mir mal die Geschichte von einem Betrunkenen erzählt, der gedacht hatte, er hätte den Ruf einer schönen Jungfrau vernommen. In Wirklichkeit folgte er dem Schrei eines Käuzchens und merkte in seinem Suff nicht, wie er ein offenes Friedhofstor durchschritt. Hypnotisiert von der lockenden Schönen, die er sich in den verführerischsten Bildern ausmalte, gelangte er immer weiter auf den Friedhof, bis er in ein offenes Grab stolperte, das am Vorabend ausgehoben worden war. Er fiel so tief und war so betrunken, dass er sofort das Bewusstsein verlor.
Als die Totengräber am nächsten Morgen bei einer Beerdigung den Sarg hinabließen, merkten sie nicht, dass sich schon jemand da unten zur Ruhe gebettet hatte. Sie schaufelten das Grab einfach zu. Dabei war ihnen, als hätten sie ein leises Klopfen gehört. Offenbar war der Säufer aufgewacht, als der Sarg auf ihm gelandet war, und versuchte sich jetzt durch Klopfen bemerkbar zu machen. Vergeblich. Seine Angehörigen ließen jahrelang nach dem nächtlichen Spaziergänger suchen, doch irgendwann gaben sie auf. Erst als nach Jahrzehnten die Grabstelle aufgehoben und der Rest des Sarges entfernt wurde, fand man darunter ein zweites Skelett, das die linke Hand zur Faust geballt hatte.
Diese und ähnliche Geschichten schossen mir durch den Kopf, als ich es plötzlich unmittelbar hinter mir laut knacken hörte. »Wer da?«, rief ich. Schließlich ging es ja darum, das Lager zu bewachen. Stille. Wie gesagt, sehen konnte ich nichts. Das hatte natürlich den unschätzbaren Vorteil, dass auch ich nicht gesehen werden konnte. Vorsichtshalber ging ich trotzdem hinter einem Baum an der Polenz in Deckung. Die rechte Hand hatte ich am Messer. Man weiß ja nie. Das Knacken ertönte abermals und danach raschelte es. Irgendjemand schlich ums Lager. Sollte ich den Führer wecken, der mir doch die Verantwortung für die ungestörte Nachtruhe der Kameraden in die Hand gelegt hatte? Nein, ich musste mich erst vergewissern, ob wirklich keine Gefahr drohte.
Ich verließ mein Versteck und schlich vorsichtig mit gezücktem Dolch in die Richtung, aus der ich das Geräusch vernommen hatte. Auf mein Gehör kann ich mich ja zum Glück verlassen. Dabei musste ich höllisch aufpassen, denn in der Dunkelheit konnte ich weder Stock noch Stein sehen und hätte leicht stolpern und mich verraten können.
Eine Weile war nichts zu hören. Keine Stimme, kein Knacken, kein Rascheln. Nichts. Vielleicht doch nur ein Tier? Gerade wollte ich mich entspannen, da hörte ich es wieder ganz deutlich, diesmal ein Stück weiter oben aus dem Wald. Hoffentlich ist das kein kommunistischer Partisan, der hier sein Unwesen treibt. Und wenn doch, ist es an mir, ihn auszuschalten. Ich biss die Zähne zusammen und lief in gebückter Haltung an die Waldgrenze. Jetzt konnte ich es ganz deutlich hören, ein tiefes Rufen, dazu Schritte und ein Rascheln wie von Hosenbeinen, die aneinander reiben, wenn jemand rennt.
Mir war echt beklommen zumute. Das konnte alles sein, aber ich war fest entschlossen, die Verfolgung aufzunehmen. Ich musste den steinigen Hang hinauf und dabei immer noch jedes Geräusch vermeiden. Solange ich lautlos blieb, war ich meinem unsichtbaren Gegner gegenüber im Vorteil.
Bald gelangte ich an den Rand der Felsen. Mit den Händen ertastete ich einen Kamin, drückte mich mit dem Rücken gegen die eine Wand und schob mich mit den Beinen an der gegenüberliegenden empor. Um die Finger freizubekommen, nahm ich das Messer zwischen die Zähne. Der kalte Stahl ließ mich erschauern. Würde ich damit zustechen müssen, womöglich einen Menschen töten? Ja, ich gebe es zu, ich hatte Angst.
Zurück konnte ich nicht. Ich schob mich weiter hoch, folgte dem Geräusch. Nach einer Weile mündete der Kamin als Felsspalte auf einem kleinen Plateau, über dem schräg ein abgestorbener Baum lag. Nach dem dunklen Schacht konnte ich dort oben wenigstens vage Umrisse erkennen. Von meinem Gegner war nach wie vor nichts zu sehen, dafür nahm ich einen beißenden Geruch wahr, der mich an den Zoo in Dresden erinnerte. Richtig, es roch nach totem Fleisch. War ich in einen Hinterhalt gelockt worden? Mein Herz schlug bis zur Schädeldecke. Gleich würde es zur offenen Auseinandersetzung kommen, das spürte ich ganz deutlich. Ich versuchte alle Richtungen gleichzeitig im Blick zu behalten, ohne dass ich wirklich viel sehen konnte.
Kennt ihr das Gefühl von Gefahr? Man kann sie nicht hören, man kann sie nicht sehen, man kann sie nicht riechen. Und trotzdem ist sie greifbar. Sie liegt in der Luft wie eine elektrische Ladung, die nach Erdung sucht.
Ich bedauerte meine Entscheidung, dem Knacken gefolgt zu sein. Was hätte ich darum gegeben, mich jetzt in der Nähe meiner Kameraden zu wissen, statt auf mich allein gestellt hier oben zu sein. Mich beschlich die Ahnung, dass mein unsichtbarer Feind mich längst im Visier hatte. Nur hatte ich keinen Schimmer, von wo aus er mich erwartete und vielleicht gleich angreifen würde. Zu alldem musste ich auch noch aufpassen, dass ich in der Dunkelheit nicht in den Abgrund stürzte. Halt fand ich auf dem glibberigen Sandstein nicht. Unter meinen Füßen fühlte es sich an, als hätte gerade jemand einen Eimer Seifenlauge ausgekippt.
Und dann passierte, was ich unbedingt vermeiden wollte. Ich trat auf einen trockenen Ast. Der zerbrach mit einem derart lauten Knall, als hätte sich ein Schuss gelöst. Anfangs dachte ich sogar, auf mich wäre geschossen worden, ich hechtete zur Seite. Im nächsten Augenblick sah ich, wie etwas Großes auf mich zuschoss. Mir blieb das Herz stehen, als ich gewahr wurde, dass es keine Arme hatte, sondern Flügel. Zwei riesengroße Augen rasten auf mich zu, die irgendwelches Licht reflektierten. Ich vernahm einen Schrei, von dem mir nicht ganz klar war, ob er von meinem Angreifer kam oder ich ihn selbst ausgestoßen hatte.
Erst als das Wesen mit ausgestreckten Krallen nach mir greifen wollte, erkannte ich, dass es sich um einen Uhu handelte. Offensichtlich war ich ihm gefolgt und zu dicht an sein Nest oben in den Felsen geraten. Er wiederum vermutete in mir wahrscheinlich eine Gefahr für seine Jungen. Ich sprang zur Seite. Aber dort, wo ich den Boden vermutete, landete ich zu meinem Entsetzen nicht auf den Füßen, sondern spürte, wie ich in die Tiefe stürzte. Das war’s, dachte ich. Es heißt ja immer, im letzten Augenblick vor dem Tod zieht das ganze Leben an einem vorbei. Wenn ihr mich fragt, ich kann mich beim besten Willen nicht mehr erinnern, was ich in dieser Situation gedacht habe. Ich spürte nur einen stechenden Schmerz im Gesicht. Offenbar hatten mich die Klauen des Vogels noch erwischt.
In der freien Abwärtsbewegung ruderte ich mit den Armen durch die Luft, inständig hoffend, dass meine Hände irgendeinen Halt finden könnten. Und siehe da, meine Linke verfing sich im Geäst eines dünnen Bäumchens, das ein Stück weit waagerecht aus dem Felsgestein ragte. Für den Moment war ich gerettet. Aber wie sollte ich hier runterkommen. Ich hatte keine Vorstellung, wie hoch ich über dem Grund hing. Alles, was meine Sinne mir zutrugen, war das beharrliche Plätschern unter mir. Ich musste mich also unmittelbar über der Polenz befinden. Zu groß konnte der Höhenunterschied nicht sein, denn das Rauschen des Wassers klang recht nah.
Ich musste es riskieren. Loslassen. Mich auf meinen Schutzengel verlassen. Unten ankommen würde ich auf jeden Fall, die Frage war nur, in welchem Zustand. Ganz langsam lösten sich meine Finger vom Holz. Die Auseinandersetzung mit dem Uhu war zwar überstanden, aber Angst hatte ich trotzdem noch. Den größten Teil der Strecke hatte ich anscheinend schon zurückgelegt, bevor ich Halt in dem Baum gefunden hatte. Unbeschadet plumpste ich in die Polenz. Ich landete zwar auf meinen Füßen, aber die Wucht des Aufpralls riss mich ins Wasser, von dem ich mehr schluckte, als mir lieb war. Ich brauchte einige Sekunden, bis ich wieder auf die Beine kam. Das eiskalte Wasser schnitt mir in die Wunden wie ein Rasiermesser, aber ich sage euch, ich war einfach nur glücklich, dass ich alles überstanden hatte.
Im Lager war alles ruhig, niemand hatte irgendwas bemerkt. Aus einem der Zelte kam ein unregelmäßiges Schnarchen, das wahrscheinlich jede Wildsau in die Flucht geschlagen hätte. Ich entledigte mich meiner Sachen, hüllte mich in eine trockene Decke und musste für den Rest der Nacht keine Angst mehr haben, dass ich einschlafen könnte.