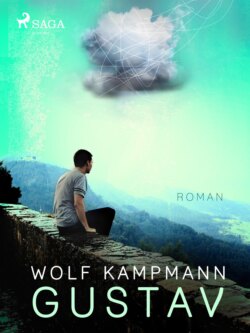Читать книгу Gustav - Wolf Kampmann - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.
ОглавлениеDie Augen schmerzten, die Schläfen pochten, der organisierte Lärm in seiner Umgebung hallte im Innern seines Schädels wider wie das Echo in der weitläufigen Felsenhöhle im Zschoner Grund. Er wusste, warum er hier war, aber er wusste nicht, wie ihm geschah. Hunderte von Fackeln loderten dem pechschwarzen Himmel entgegen, Funken huschten wie bewegliche Sterne durch die hell erleuchtete Dunkelheit. Gustav fürchtete sich vor Feuer, aber diese Angst durfte er sich hier keinesfalls anmerken lassen. Ab heute würde er Hitlerjunge sein.
Seit Jahren hatte er diesem Feiertag entgegengeträumt. Hitlerjunge, wenn auch vorerst nur im Jungvolk, eine Uniform tragen, die er nicht am Faschingsabend wieder ausziehen musste, wenn die Füße in den Schuhen festgefroren waren. Nein, diese Uniform, bestehend aus braunem Hemd, schwarzer kurzer Hose, schwarzem Halstuch und dem Fahrtenmesser am Gürtel würde er tragen können, so oft er wollte. Das Wort Pimpf gefiel ihm nicht. Das klang wie Käferchen, das für immer zum Kleinbleiben verurteilt war. Pimpf erinnerte ihn an Pups. Er wollte nicht niedlich und schon gar kein stinkendes Lüftchen sein, er wollte kämpfen. Noch steckte sein braunes Hemd akkurat, aber harmlos in der Hose, ohne von einem Riemen gehalten zu werden. Für dieses Zeichen der Tapferkeit und körperlichen Härte würde er sich erst im sportlichen Wettkampf bewähren müssen. Aber das hatte noch Zeit.
Es war der 19. April 1940, der Tag vor dem Führergeburtstag. Aus der Ferne ertönte eine Stimme. Gustav steckte in seinen eigenen Gedanken, die wie durch einen Wall geschützt waren. Schlagworte wie Führer, Kampfschar, Treue, Einsatz, Blutzeuge oder Leben drangen an sein Ohr. Sie bedeuteten ihm nichts und doch galten sie ihm grundsätzlich alles. Er war bereit, für den Führer das Leben zu geben. Mehr noch, er hoffte, diese Bereitschaft eines Tages unter Beweis stellen zu können, wenn sein Opfer gebraucht würde.
Seit einigen Wochen lag Deutschland im Krieg. Was man so Krieg nennt, wenn die eigenen Truppen drückend überlegen sind. Wer wollte sich der deutschen Wehrmacht schon in den Weg stellen? Die Polen etwa, deren Ulanenmützen noch aus dem 19. Jahrhundert übrig geblieben waren? Wollen die ernsthaft mit ihrer Kavallerie gegen unsere Panzer anreiten? Oder diese dämlichen Dänen, für deren komplette Demütigung man gerade erst einen einzigen Tag gebraucht hatte, ohne dass diese viel Widerstand an den Tag gelegt hätten? Dieser Krieg war ein Spaziergang, Deutschland brauchte wahrlich andere Gegner.
In früheren Zeiten stapelten sich im Krieg noch die Leichen in den Straßen, es stank nach Pulverdampf, Häuser brannten, Frauen schrien. Sein Vater hatte ihm von der Völkerschlacht bei Leipzig erzählt. Er wusste alles über Napoleon. Aber das war über hundert Jahre her. Damals gab es wirklich noch Ulanen. Die Ära der Kriegskunst war ein für allemal vorbei. Heute wurden Feldzüge mit wissenschaftlicher Präzision geführt. Die Front war fern der Heimat. Von der Wirklichkeit des Krieges zeugte nur die Wochenschau, wenn auf schmetternder Marschmusik vom schnellen Vormarsch der deutschen Soldaten die Rede war, die von polnischen Kindern dankbar begrüßt wurden.
Irgendwann würde es auch ihn an die Front verschlagen. Bei diesem Gedanken überkam ihn Gänsehaut. Um ein Haar wäre ihm die Fackel aus der Hand gefallen. Sein Nebenmann warf ihm einen vernichtenden Blick zu, als wäre er mehr Jungvolkjunge als Gustav. Der verscheuchte die Traumbilder, nahm wieder Haltung an und versuchte dem Geschehen zu folgen.
In den Gesichtern seiner Kameraden erkannte er Stolz. Wie schafften die das alle, so ernst auszusehen? Ihr Kinn machte sich im Schein der Fackeln doppelt so stark aus wie sonst, ihre Konturen hoben sich scharf vom Schwarz der Nacht ab. Gustav versuchte seinen Unterkiefer nach vorn zu schieben und einen entschlossenen Blick aufzusetzen. Diese Jungs hier waren nicht mehr die Mitschüler, die ihn auf dem Schulhof gehänselt hatten, sondern bildeten mit ihm gemeinsam die zuverlässige Reserve des Führers, nicht nur zu allem entschlossen, sondern von nun an durch den Fahneneid fest verbunden. Ab heute würden sie nicht mehr seine Feinde sein.
Was Gustav an diesem Tag empfand, hatte er so noch nie unter Menschen gefühlt. Er hatte die ausgelassenen Stunden mit Vogelscheuche geliebt, aber das hier war etwas anderes. Weder der zottelige Schäfer noch sein gelehriger Hund Wolf würden verstehen, was es heißt, sein Leben in den Dienst des Volkes zu stellen. Heute liebte es Gustav, ein Mensch zu sein.
Fanfarenklänge rissen ihn aus seinen Gedanken. »Vorwärts! Vorwärts! Schmettern die hellen Fanfaren«, ertönte es aus tausend Kehlen um ihn herum. Er hatte den Text hundertfach gesungen, doch jetzt versagte seine Stimme. Er fror und hatte Mühe, einen Hustenanfall zurückzuhalten. Aber bloß keine Schwäche zeigen. Dann folgte der Eid. Der blecherne Ton aus den Lautsprechern war kaum zu verstehen, doch in der Schule hatten sie die Formel so lange geübt, bis auch der Schwächste im Gedichtaufsagen sie draufhatte. »Jungvolkjungen sind hart, schweigsam und treu. Jungvolkjungen sind Kameraden. Der Jungvolkjungen Höchstes ist die Ehre.« Alle konnten diese heiligen Worte. Selbst Walter, der ausgerechnet den Namen von Gustavs Vater trug, hatte sie gelernt.
Walter galt als Halbjude, sein Status war ungeklärt. Seine Duldung in der Volksgemeinschaft hing an einem seidenen Faden. Er hätte alles darum gegeben, wenn auch er die braune Uniform hätte überstreifen dürfen. Im Unterricht war er stets der Eifrigste, wenn es darum ging, die Vita des Führers aufzusagen oder seine Treue zum deutschen Volk zu bekunden. Anfangs hatte sich für Walter wenig geändert. Er war stark, lebenslustig und beliebt.
Langsam und zunächst unmerklich änderte sich jedoch die Situation. Man begann, hinter seinem Rücken zu tuscheln, seine Schulsachen zu verstecken, Tinte über seinen Heften auszukippen, und obwohl die Lehrer wussten, dass die anderen Jungs der Klasse dahinter steckten, musste doch immer Walter vor das Pult treten und duldsam seine öffentliche Bestrafung erleiden. Mit seiner Beliebtheit schienen auch seine Selbstsicherheit und seine Kraft zu schwinden.
Gustav fand das ungerecht. Er wusste schließlich aus eigener Erfahrung, was es hieß, den Spott und die Ablehnung der anderen ertragen zu müssen. Wenn sie in der großen Pause in Zweierreihe im weiten Kreis um die große Linde in der Mitte des Schulhofs laufen mussten, hatten sich die beiden Geschmähten oft zusammengefunden und sich vorsichtig angefreundet.
Inge redete zwar auf ihren Bruder ein, dass es dem Führer kaum gefallen würde, wenn er sich mit einem Judenbengel einließe, aber Gustav beschloss, ihr einfach nichts mehr von Walter zu erzählen, genauso, wie er es bereits seit Langem mit Vogelscheuche hielt.
Auch Walter kam aus gutem Hause, doch seine Kleidung verlor an Form und der Inhalt seiner Brotbüchse wurde immer spärlicher. Gustav spielte seiner Mutter vor, sein Hunger würde immer größer werden. Clara Bülow hörte das gern, denn die spindeldürre Erscheinung ihres einzigen Sohnes machte ihr Sorgen. Doch Gustav gab Walter vom zusätzlichen Brot ab. Heimlich, denn es war verboten, mit den Juden zu teilen. Die beiden Jungs achteten darauf, dass niemand ihren Handel Brot gegen Freundschaft beobachtete. Mit der Zeit wurden sie jedoch unvorsichtig und der Aufseher erwischte sie in der großen Pause, als Walter in Gustavs Brotdose griff.
Beide Jungen mussten gemeinsam vor die Klasse treten. Walter hielt den Kopf stolz erhoben und rührte sich nicht. Gustav hingegen wagte es nicht, seine sitzenden Kameraden anzusehen. Der Lehrer schnaubte vor Wut. Ob der Judenlümmel nicht wüsste, was es für eine deutsche Mutter bedeute, für ihre Familie zu sorgen. Ob es seinem Stamm nicht reiche, die deutsche Volksgesundheit zu unterwandern, und er nun auch noch den Deutschen das Brot stehlen müsse.
Gustav schämte sich, wusste aber nicht, wofür und vor wem. Nachdem Walter seine Abreibung erhalten hatte, war er dran. Der Lehrer müsse seiner Mutter berichten und es könne schwerwiegende Folgen haben, dass Gustav sich den Regeln der Schule und des Anstands widersetze und Juden durchfüttere. »Hast du denn gar keine Ehre im Leib, Bülow? Solche Elemente wie dich können wir im Jungvolk nicht gebrauchen.«
Diese unmissverständliche Drohung traf Gustav wie ein Hammerschlag. Nun wusste er, auf welcher Seite er zu stehen hatte. »Das war nur … das war nur ein … Walter hat mir gedroht, er würde …« Weiter kam er nicht, doch das reichte aus, um ihn zu rehabilitieren.
»Bülow, setzen!«, erklang es streng, aber mit einer Spur Nachsicht.
Gustav schleppte sich mit letzter Kraft zu seiner Bank. Er spürte, wie die Blicke der anderen an ihm hafteten, doch was er sonst als Demütigung empfunden hätte, interessierte ihn heute nicht. Er wusste, dass die Tortur für ihn vorbei war und sich die achtzehn Augenpaare der Klasse gleich wieder nach vorn richten würden, wo jetzt nur noch ein Delinquent stand.
Ein Schwall von Beschimpfungen ergoss sich unter lautstarkem Hohn der Klasse über Gustavs einzigen Freund, der nun keiner mehr sein durfte. Die gerade noch Verbündeten sprachen nie wieder ein Wort miteinander, und Gustav dachte nicht gern an jenen Tag zurück. Warum musste er ausgerechnet jetzt daran denken? Gustav versuchte diese Erinnerungen zu verscheuchen, doch es wollte ihm nicht gelingen. Der Eid lenkte ihn ab.
Irgendwo in der Menge, die das Ereignis am Rande verfolgte, wusste Gustav die Mutter und Ingeburg. Die große Schwester hatte ihm schon von Adolf Hitler erzählt, als Gustav die fotografische Omnipräsenz des seltsamen Mannes mit dem Bleistiftstummel-Bärtchen einfach nur als gottgegeben hinnahm. Sein Vater sprach nicht über Hitler, die Mutter tat es dem Vater gleich. Inge aber hatte ihm erzählt, sie sei in Adolf Hitler verliebt.
Vor und nach der Nennung dieses angebeteten Namens machte sie stets eine winzige, aber umso bedeutsamere Pause, als müsse sie diese vier untrennbaren Silben A-dolf-hit-ler auf ein kleines sprachliches Podest stellen. Gustav hatte sich dann vorgestellt, wie die Schwester dem Mann, den er von tausend gerahmten Fotografien kannte, in den Armen liegen würde. Wie mochte sie wohl als seine Braut aussehen? Doch das war lange her, inzwischen wusste er selbst, was es bedeutete, den Größten aller Deutschen zu lieben. Heute endlich würde Inge stolz auf ihn sein. Er konnte sie nicht sehen, denn er war ganz auf die Choreografie des Aufmarschs konzentriert, aber er wusste, dass sie ihn sehen konnte.
Der Vater war nicht gekommen. Er hatte am Morgen über Migräne geklagt, doch Gustav ahnte, dass das gelogen war. Inge und der Vater hatten oft Auseinandersetzungen wegen Hitler, der Partei und der nationalsozialistischen Idee. Gustav liebte und fürchtete seinen Vater, doch er verstand nicht, warum er einfach nicht den neuen Geist akzeptieren wollte.
»Wenn es nach mir ginge, würdest du diesem Idiotenhaufen nicht beitreten. Lern endlich, für dich selbst zu denken«, hatte der alte Bülow seinen Sohn ermahnt, doch der winkte innerlich ab. Diesmal hatte der Vater zum Glück nichts zu sagen, denn Pflicht ist Pflicht und Gesetz ist Gesetz.
Am Abend, als Gustav glücklich heimkehrte und Mutter und Inge noch eine halbe Stunde mit ihm feierten, ließ sich Walter Bülow nicht blicken. Gustav fragte nicht nach ihm, auch Mutter und Schwester taten so, als hätte es nie einen Vater gegeben. Als Gustav kurze Zeit später im Bett auf den Schlaf wartete, war er sich plötzlich nicht mehr sicher, ob er die Eidesformel überhaupt mitgesprochen hatte. Mit einem Mal schoss er vom Kissen hoch und hatte das Gefühl, von einem hinterhältigen Apachen mit Pfeilen durchbohrt und skalpiert zu werden. Was, wenn er gar kein richtiger Jungvolkjunge wäre, weil er sich nicht laut und vernehmlich zur Kameradschaft in der Hitlerjugend bekannt hatte. Hastig sprach er die Worte, die er so oft im Unterricht geübt hatte.
Der auf den großen Freitag folgende Montag war eine bittere Enttäuschung. Gustav kleidete sich in seine Uniform und konnte es kaum erwarten, als ein Tropfen in einem Meer von Braun auf dem Schulhof zu treiben. Der Vater ließ sich nur kurz am Frühstückstisch sehen, sprach kein Wort und verschwand grußlos.
Bei seinem Eintreffen in der Schule staunte Gustav nicht schlecht, dass außer ihm niemand die Gala vom Fahneneid angelegt hatte. Überhaupt, wo war er, der Geist, der alle noch drei Tage zuvor wie Kruppstahl zusammengeschweißt hatte. Der Klassenraum sah aus wie immer, in den Gesichtern war nichts zu lesen und der Unterricht wurde durchgezogen, als ob nichts passiert wäre. Nur Walter war verschwunden. War Gustav der Einzige, dem das auffiel? Bei der Anwesenheitsliste wurde der Name des ungeliebten Mitschülers einfach weggelassen. Keinen schien das zu kümmern. Gustav kämpfte gegen ein flaues Gefühl im Magen an. Doch mit der Zeit vergaß er Walter.
Mittwochnachmittags und samstags war Dienst. So wenig Gustav die Schule mit all ihren unerfreulichen Begleiterscheinungen mochte, so sehr liebte er die Dienste. Mittwochs gab es meist Schulungen. Bei den Geschichten von germanischen Göttern konnte er wegträumen. Er spann diese Geschichten weiter, begann mit Hingabe die Götterromane von Felix Dahn zu lesen und errang sich mit seinem Wissen um die germanische Sagenwelt Achtung bei seinen politischen Erziehern. Auch die Sanitätsausbildung gefiel ihm. Er konnte auf ein paar praktische Tipps zurückgreifen, die er von Vogelscheuche gelernt hatte.
Manchmal musste das Jungvolk auch losziehen, um kriegswichtige Rohstoffe wie Papier, Altkleidung, Schrott und Flaschen zu sammeln. Gustav verstand zwar nicht, was ein Stapel gebündelten Papiers am Lauf des Krieges ändern sollte, doch er war mit Eifer dabei, denn nichts lag ihm mehr, als sich durch seinen Beitrag zum Endsieg auszuzeichnen. Mehr als jeder andere musste er beweisen, dass er ein würdiger Hitlerjunge war, sonst hätte vielleicht noch jemand herausgefunden, dass er einst den Eid nicht satzungsgemäß geleistet hatte.
Viel mehr lag ihm aber der Dienst am Samstag. Da ging es nämlich um Wehrsportübungen. Aktive Vorbereitung auf den Kriegsdienst, hieß es. Gustav hatte zwar Angst vor dem Krieg, aber noch war er ja jung und bis er zum Manne gereift wäre, würde wohl auch diese Angst verflogen sein. Beim Wehrsport war er weder kräftiger noch geschickter als seine Mitschüler. Beim Handgranatenweitwurf zum Beispiel holte er eines Tages so kräftig aus, dass ihm der Wurfgegenstand unbeabsichtigt nach hinten entglitt. Als ihm der Ausbilder drei Meter negativer Weite attestierte, brach die Klasse in schallendes Gelächter aus. Seinerseits lachend, versuchte Gustav zu überspielen, wie sehr ihn dieses Missgeschick wurmte. Doch er konnte auf andere Weise seine Stärken ausspielen. Draußen im Feld kam es nämlich nicht nur auf Stärke und Gewandtheit an, sondern man musste sich auch in der Natur bewegen können.
Gustav erwarb sich schnell den Ruf eines Überlebenskünstlers. Niemand hatte seine fünf Sinne so beisammen wie er. Er konnte die Bäume am Geruch unterscheiden, brauchte keinen Kompass, um die Himmelsrichtung zu erkennen. Bei absoluter Finsternis fand er jeden Weg, und wenn er wollte, wurde er von einem Augenblick auf den anderen unsichtbar.
Jeden zweiten Samstag fuhr seine Gruppe ins Elbsandsteingebirge, das neben der Zschone sein zweites Hinterzimmer war. Hier kannte er sich aus und konnte seine Naturkenntnisse noch besser anwenden. In weitem Rahmen wurden Geländespiele organisiert. Gustav verstand es nicht nur, jede Spur zu lesen, er konnte sich auch durch die Natur bewegen, ohne selbst Spuren zu hinterlassen.
Wurde er beim Schulsport oder bei den nachmittäglichen Spielen auf dem Hof stets als Letzter in eine Gruppe gewählt, war es hier genau umgekehrt. Mit Gustav war der Sieg so gut wie sicher.
Zwischen den Sandsteinfelsen musste sich seine Gruppe gegen Jungenschaften aus anderen Dresdner Stadtteilen bewähren. Die Jungs wurden auf Feindkontakt im offenen Gelände vorbereitet und von ihren Führern regelrecht aufeinander losgehetzt. Dabei ging es manchmal so hart zur Sache, dass die Bezeichnung Spiel fehl am Platze schien. Gebrochene Knochen und blutende Nasen waren an der Tagesordnung. Wer selbst bei schweren Blessuren Tränen zeigte, wurde als Memme gehänselt. Gustav jedoch führte seine Kameraden mit solcher Sicherheit durch die unwegsamsten Gegenden, dass sie selten ins Hintertreffen gerieten.
Seine scharfen Augen trugen ihm den Spitznamen Falkenauge ein. Wo andere nur Gestrüpp sahen, fand er immer noch einen Weg, wo andere einen unüberquerbaren Fluss vermuteten, entdeckte er unmittelbar unter der gekräuselten Wasseroberfläche eine Furt aus Steinen, die sicher und halbwegs trocken zum anderen Ufer führte. Er konnte klettern wie kein Zweiter und passte seine Extremitäten derart geschickt den Formen der Natur an, dass er sich auf einen Ast setzen konnte, ohne von seinem Feind gesehen zu werden.
An den Nachmittagen im Gelände machte sich Gustav viele Freunde. Seltsamerweise währten diese Freundschaften immer nur, solange sie draußen waren. Die nur unwesentlich älteren Jungenschaftsführer, die den Rest der Klasse hetzten, bis jedem »die Lunge zur Fresse raushing« – so die Formulierung eines Ausbilders –, verschonten ihn. Ja, sie fragten ihn sogar um Rat, wenn es zum Beispiel zu regnen anfing oder Wind aufkam. Gustav wucherte mit seinem Wissen um die Natur und lag meistens richtig.
In der Schule jedoch wurde der König der Samstagnachmittage weiterhin von den Lehrern vorgeführt. Dieselben Jungs, die ihm am Wochenende noch Achtung gezollt hatten, lachten ihn plötzlich wieder aus. Was konnte Gustav nur tun, um den Respekt der Wehrsportübungen mit ins Klassenzimmer zu tragen? Nicht selten hatte er das Gefühl, zwei Leben zu leben.
Zu Hause spitzte sich die Situation zu. Inge war nachmittags immer seltener zu Hause und der Vater wurde zusehends verschlossener. Er sprach kaum noch und blieb manchmal für mehrere Tage weg. Die Eltern stritten sich oft und heftig. Vor ihrem Sohn versuchten sie den Schein zu wahren, aber Gustav spürte, dass etwas nicht stimmte.
Wenn er mit Vater und Mutter im nahen Leutewitzer Park spazieren ging, erzählte er stolz von seinen Abenteuern an den Dienstnachmittagen. Die Mutter fragte interessiert nach, der Vater hing ostentativ anderen Gedanken nach. Wenn Gustav aber leidenschaftlich den rechten Arm anwinkelte und sein akkurates »Heil Hitler« brüllte, sowie sie einem Offizier der Wehrmacht, einem SS-Mann oder auch nur einem vierzehnjährigen Gruppenführer begegneten, war der Alte wieder voll da. »Muss das denn sein?« Es sei seine Pflicht, zu salutieren, entgegnete Gustav entrüstet. »Kann ja sein, aber doch nicht so, verdammte Scheiße.« Der Vater wurde dünnhäutiger, verlor schneller die Fassung, als Gustav es gewohnt war.
Eines Tages im Frühjahr 42 kam Gustav nach Hause und spürte sofort, dass etwas Schwerwiegendes vorgefallen sein musste. Die Mutter saß weinend in der Küche und brachte kein Wort hervor. Der Vater stand reglos in der Stube und blickte zum Fenster hinaus. Inge lehnte am Ofen und überschüttete das Familienoberhaupt mit Vorwürfen, als hätte sie jetzt das Regiment übernommen. »Es musste ja so kommen. Mit deinem undeutschen Verhalten bist du dem Führer in den Rücken gefallen. Das ist Hochverrat, und das mitten im Krieg. Du, der du für diesen tatterigen Kaiser im Weltkrieg den Kopf hingehalten hast. Sei froh, dass sie dir nur die Fabrik weggenommen haben.« Sie klatschte sich die flache Hand mit solcher Wucht auf die Stirn, dass unter dem kurzen Pony eine rote Stelle zurückblieb. Der Vater atmete hörbar tief ein, schaltete aber sonst auf Durchzug.
Gustav traute seinen Ohren kaum. Vater hatte dem Führer den Gehorsam verweigert? Es stellte sich heraus, dass sich Walter Bülow geweigert hatte, in seiner Gießerei Rüstungsgüter herzustellen. Erst hatte man es ihm freundlich angetragen, ihn dann aber per Befehl dazu aufgefordert. Bülow änderte seine Ablehnung nicht. Er werde sich mit seiner Fabrik nicht an der Kriegsmaschinerie beteiligen. Die Antwort der Behörden ließ nicht lange auf sich warten. Als er an diesem Morgen in die Firma kam, war sie bereits von SS-Leuten besetzt. Bülow durfte nicht einmal sein Büro betreten. Ihm wurde nur wortlos ein mit dem Reichsadler unterstempeltes Dokument ausgehändigt, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass seine Gießerei als kriegswichtige Einrichtung ab sofort unmittelbar dem Rüstungsministerium unterstellt sei. Mit anderen Worten, er war enteignet worden.
Vor Gustavs Augen blinkte ein und dasselbe Wort immer wieder auf wie die Leuchtreklame vor der Verdunkelung. Schande! Wie sollte er morgen seinen Kameraden und Lehrern gegenübertreten? Wie konnte er sich mit dem Verräter noch im Park oder anderswo sehen lassen?
Die Angst war unbegründet. Seltsamerweise schien in der Schule niemand zu wissen, was vorgefallen war. Der Vater brachte ihn auch nicht weiter in Verlegenheit, weil er, um die Familie zu ernähren, die Geschäftsführung einer Druckerei im fernen Füssen übernahm. Er kam nur noch alle zwei Wochen für den Sonntag nach Dresden. Da die Feldlager inzwischen von Samstagmittag bis Sonntagnachmittag ausgedehnt worden waren, bekam Gustav den Vater kaum noch zu Gesicht. Wenn er zu sich selbst ehrlich war, war ihm das auch ganz lieb so. Er ertrug nicht die immer noch autoritäre Verachtung seines Erzeugers allem gegenüber, was ihm wichtig und heilig war. Und er mochte sich nicht die Frage beantworten, wem er mehr Treue und Gehorsam schuldete, dem Führer oder dem Vater.
Draußen im Lager musste er sich solche Gedanken nicht machen. Da waren nur die Natur, die Kameraden, der Traum vom Endsieg und er. So verflog die Zeit, und nicht nur Gustav verlor das Gefühl dafür, dass der Krieg immer näher rückte. Sterben wurde selbstverständlicher, genauso wie die täglichen Einschränkungen, die Abstriche beim Essen, das Frieren im Winter. Auch der Krieg selbst lief längst nicht so glatt wie damals, als er in die HJ aufgenommen worden war.
Die Briten und Amis kamen mit ihren Flugzeugen über den Ärmelkanal, deutsche Städte wurden bombardiert, einige seiner Kameraden hatten ihre Väter oder Brüder an der Front verloren. Auch die Lehrerschar war deutlich dezimiert. Männer unter 50 gab es nicht mehr, dafür wurden Greise aus dem Ruhestand zurückgeholt, die gar nicht erst zu kaschieren suchten, dass sie den ihnen Anvertrauten hoffnungslos unterlegen waren. Die Jungs saßen hinter den Bänken einfach nur noch die Zeit ab und warteten auf ihre Einberufung, einige euphorisch, andere voller Angst. Unter der Bevölkerung machte sich Verbitterung breit. Durch die Straßen liefen Menschen mit Trauerbinden, es wurde viel geflüstert, geschwiegen und geweint.
In der Sächsischen Schweiz war von alledem kaum etwas zu spüren. Dort war die Welt selbst im Sommer 1944 noch in Ordnung. Die Sonne ging auf, die Sonne ging unter, die Felsen rochen nach Jahrtausende alter Fäulnis, Vögel sangen, Eidechsen huschten, die Flüsschen plätscherten im Sonnenschein, der Fingerhut blühte, das Springkraut sprang und die Spinnen webten ihre Netze. Die Ostfront war weit und die alliierten Bomber reichten nicht bis Dresden. Am Oberlauf der Elbe war der Krieg immer noch ein Spiel. Zwischen den vertrauten Sandsteinfelsen fand Gustav nicht nur Zuflucht vor dem immer drückenderen Alltag, dort konnte er auch vor den anderen seine Überlegenheit beweisen.
Anfang Juli sollte im malerischen Polenztal für das Wochenende ein Zeltlager errichtet werden, um einmal mehr die Feldtauglichkeit der Heranwachsenden zu erproben. Gustav fand sich mit den anderen Jungs seiner Klasse wie gewohnt am Samstagmittag auf dem Stellplatz am Hauptbahnhof ein. Es war ein drückender, regnerischer Tag in diesem ungewöhnlich heißen Sommer.
Gustav hatte Kopfschmerzen und darüber hinaus ein ungutes Gefühl. Sein Missmut sollte schnell Bestätigung finden. Kameradschaftsführer Karl, bei dem er Privilegien als Pfadfinder genossen hatte, erschien nicht. Es hieß, er sei zur Wehrmacht eingezogen worden. Statt seiner war ein neuer Anführer auf dem Platz, der zwar laufend das Wort Kameradschaft im Mund führte, aber ansonsten nur rumbrüllte.
Mit dem Zug ging es bis Bad Schandau, dann zu Fuß weiter durchs offene Gelände bis ins Polenztal. Der neue Chef hatte es nicht eilig, sich Freunde zu machen. Im Gegenteil, er ließ die Jungs ohne Rast bis zum vorgesehenen Lagerplatz marschieren und sofort nach der Ankunft die Zelte aufbauen. Wer sich für einen Augenblick ausruhte oder nur den Schweiß aus der Stirn wischte, wurde auf der Stelle angeranzt. Lahmärsche, Drückeberger, Muttersöhnchen, jüdische Weicheier und ähnliche Schmähungen fielen am laufenden Band.
Gustav, der sich aufgrund seiner herausgehobenen Stellung an die Rolle des Mittlers gewöhnt hatte, nahm allen Mut zusammen und baute sich vor dem Neuen auf: »Kamerad, meinst du nicht, dass wir mal ’n paar Minuten Pause gebrauchen könnten?«
Der Angesprochene hielt die Luft an und verfärbte sich dunkelrot. Gustav hoffte, er würde tot umfallen, aber das tat er nicht. Nachdem er die Fassung zurückerlangt hatte, baute er sich breitbeinig vor Gustav auf, stemmte die Fäuste in die Hüften und fragte statt einer Antwort zurück: »Wie ist der Name?«
»Bülow, Gustav.«
»Schon mal was von Haltung gehört in diesem Sauhaufen? Stillgestanden! Fünf Minuten Pause für alle. Außer Bülow. Und weil dir, Bülow, offenbar so sehr am Wohl deiner Kameraden gelegen ist, übernimmst du heute die Nachtwache vom Zapfenstreich bis zum Wecken. Und gnade dir Gott, wenn ich noch ein Wort höre …«
Gustav spürte, wie ihm die Knie weich wurden und sich ein leichtes Kribbeln in der Blasengegend bemerkbar machte. Um ihn wurde es mucksmäuschenstill. Keiner seiner Kameraden rührte sich, selbst die Vögel schienen für ein paar Augenblicke ihren Gesang einzustellen. Er nahm alle Kraft zusammen, um nicht in Tränen auszubrechen. So gedemütigt hatte er sich noch nie gefühlt, nicht einmal von seiner großen Schwester, die keine Gelegenheit ausließ, ihn zu erniedrigen. Für den Rest des Nachmittags und Abends fühlte er sich wie ein Aussätziger. Niemand sprach mit ihm oder setzte sich auch nur in seine Nähe. Hatte sich so vielleicht Jahre zuvor sein jüdischer Mitschüler Walter gefühlt, als er ihn im Stich gelassen hatte?
Um zehn war Zapfenstreich. Alle verschwanden in ihren Zelten und das Feuer wurde gelöscht. Der Verdunkelungsbefehl galt schließlich auch im Wald. Der Feind lauerte überall und es war nicht ausgeschlossen, dass hier, in der Unübersichtlichkeit der Bergwelt, kommunistische Späher unterwegs waren.
»Ich weiß unseren Nachtschlaf in sicheren Händen«, höhnte sein Peiniger, bevor er das Zelt von innen verschloss.
Es war bedrückend still. Gustav beobachtete die Sterne und hoffte auf eine Sternschnuppe. Würde er eine sehen, würde er dem Führer Glück für den Endsieg wünschen. Sollte ihm noch eine zweite beschieden sein, würde der neue Kameradschaftsführer morgen auch in den Krieg abkommandiert werden. Am liebsten hätte er sich auf den Rücken gelegt, aber er hatte Angst einzuschlafen. Auf einem Stein sitzend, versenkte er sich in die Sternbilder. Die Milchstraße, der Große und der Kleine Wagen, der Schwan, alle waren ganz deutlich zu sehen. Irgendwo dort oben wollte er jetzt in einer ganz anderen Welt sein. Langsam schoben sich Wolken vor die Sterne, als gelte auch fürs Firmament Verdunkelungspflicht. Gustav probierte aus, was bei dieser Finsternis an der Redensart dran wäre, dass man die Hand nicht mehr vor den Augen sehen könne. Tatsächlich konnte er nichts sehen, wenn er sie nicht unmittelbar vor die Augen hielt.
Wie spät mochte es jetzt sein? Gustav hatte keine Ahnung, wie lange er noch so harren musste. Orientierung gab ihm nur das gleichmäßige Rauschen der Polenz. Er beschloss, am Ufer auf und ab zu laufen, möglichst eine große Strecke, damit die Stunden bis zum Wecken schneller vergingen. Würde es ihm gelingen, sich nur mit dem Gehör am Ufer entlang zu bewegen? Er schloss die Augen und verlegte seine ganze Aufmerksamkeit in die Schuhspitzen und Ohren. Angespannt bis zum Äußersten setzte er einen Fuß vor den anderen.
Schon nach wenigen Schritten stieß er mit dem rechten Fuß gegen eine Wurzel, wich kurz entschlossen nach rechts aus, trat jedoch ins Leere. Hastig griffen seine Finger nach dem nahen Baum, doch dort, wo er ihn vermutet hatte, war nichts als das Nichts. Gustav fiel. Jeder Moment dehnte sich unendlich aus. Obwohl es stockdunkel war, hatte der Strauchelnde den Eindruck, er könne sich selbst ganz deutlich beim Fallen zusehen. Für eine halbe Unendlichkeit war keine einzige Stelle seines Körpers mehr mit der Erde verbunden, dann landete er mit dem Rücken zuerst in der eiskalten Polenz.
So flach der Fluss auch war, Gustav schluckte literweise Wasser und wäre um ein Haar ertrunken. Nur mit Mühe konnte er sich wieder in die Senkrechte bringen. Schnell raus aus dem Wasser, offensichtlich hatte niemand sein Missgeschick bemerkt. Ans Ufer kletternd, verlor er auf dem schlüpfrigen Untergrund ein zweites Mal den Halt und plumpste nun bäuchlings ins Wasser, wobei er sich an einem Strauch das Gesicht zerkratzte. Ohnehin pitschnass, ging er ein Stück flussabwärts, bis das Ufer ein wenig flacher war. So ein Mist, wie sollte er das vor den Kameraden verborgen halten? Aber im Erfinden von Geschichten war er schon immer gut gewesen …