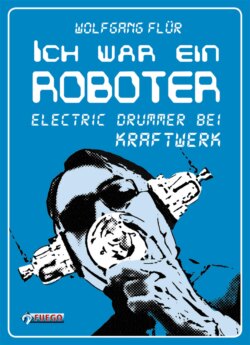Читать книгу Ich war ein Roboter - Wolfgang Flür - Страница 16
Оглавление10
ZU SCHNELL AM BROADWAY - AMERIKA ENDLOS
Düsseldorf, April 1975 +++ Kollege Karl hatte viel Arbeit mit seinem Musikstudium und oft wenig Zeit fürs Proben. Das war aber weiter nicht schlimm, weil Autobahn die letzte Platte war, die noch für den Philips-Vertrag abgegeben werden musste. Jetzt hieß es erst einmal abwarten, wie die Medien und unser Publikum das neue Werk annehmen würden.
In der Zwischenzeit genossen wir unser Leben in vollen Zügen. Mit Emil wanderte ich oft in die umliegende Natur. Ich hatte einen roten Opel Kadett, und so konnten wir leicht an den Niederrhein fahren. Emil zeigte mir seine Geburtsstadt, den Wallfahrtsort Kevelaer und dessen flache ländliche Umgebung. Es gab eine wunderbare Verbindung zwischen ihm und mir. Beide liebten wir Ausflüge in die Natur. Wir hatten mittlerweile einige gemeinsame Freunde und Freundinnen aus anderen Kreisen. Emil war damals noch Kunstlehrer am Düsseldorfer Rethel-Gymnasium. Oft hatte er in der Berger Allee Besuch von seinen Schülern. Dort traf man sich dann in unserer gemeinsamen Küche bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen. Wir hatten eine echte Lebensgemeinschaft - auch wenn ich ihm des Öfteren Mädchen ausspannte, die er was weiß ich woher holte und die ich dann zu mir nach nebenan lockte und ›verarbeitete‹. Emil war nie nachtragend, war immer ein souveräner und großzügiger Mensch, wie ich noch nie einen anderen kennengelernt hatte.
Man kann sich vorstellen, dass bei uns immer viel los war - vor allem, nachdem jetzt auch Karl bei uns wohnte. Langeweile kannten wir nicht. Partys gab‘s so oft wie möglich, Frauen Abstauben war obligatorisch; Küche aufräumen bedeutete jedesmal Kampf, die monatliche Telefonrechnung auf jeden Fall Krieg. Es war eine herrliche Zeit und ich fühlte mich wohl in meiner jungen Haut und meiner neuen Rolle.
Eines Tages riefen Ralf und Florian an und luden uns zum Gespräch in ein auswärtiges Café ein. Sie taten sehr geheimnisvoll und wollten am Telefon keinen Grund dafür nennen. Mit Ralfs grauem VW fuhren wir hinaus aufs Land. Es war im Frühjahr 1975 schön warm und wir konnten schon im Freien sitzen.
Ralf räusperte sich in seiner speziellen Manier und sagte: »Was haltet ihr von Amerika, Jungs?« Wir hatten keine Ahnung, was er damit meinte. Ralf berichtete weiter: »Unsere Platte ist in den USA in den Charts und bewegt sich schnell nach oben. Sie hat gerade einen hohen Platz erreicht und wir haben ein tolles Angebot für eine Tournee durch die gesamten Staaten erhalten.«
Das haute uns vielleicht um. Ein Taumel, ein Wahnsinn! Wir nach Amerika? Es war nicht zu fassen! Was hatten wir gemacht? Wie konnte das so schnell passieren? Völlig aus dem Häuschen überlegten wir, wie wir uns im Land des kreischenden Gitarrenrock präsentieren könnten. Natürlich wollten wir mit. Die Ideen und Spinnereien flogen nur so hin und her und setzten sich auf der gesamten Heimfahrt fort. Es war einfach zu spannend. Die Tournee war schon für den April angesetzt. Zunächst sollten laut dem amerikanischen Manager Ira Blacker von ›Mouse Ltd.‹ zweiundzwanzig Konzerte stattfinden. Wir bereiteten uns also auf einen ganzen Monat USA vor. Doch es sollte reichlich anders kommen...
Unser Flug von Düsseldorf nach New York war gebucht. Wir waren alle sehr durcheinander und kauften uns noch kurz vorher die nötigsten Reiseutensilien und neue Koffer. Am Tag der Abreise kamen Florian, Ralf und seine Schwester Anke am Vormittag zu uns in die Berger Allee. Es wurde viel gequatscht und jeder fragte jeden, ob wir auch nichts vergessen hatten. Unsere wenigen Instrumente, die wir damals besaßen, hatten wir schon vorausgeschickt. Nun ging es nur noch um die Anzüge, die wir uns besorgt hatten, und darum, ob auch jeder seinen Paß bei sich habe mit dem aktuellen Stempel für ein Touristenvisums, das damals für die USA nötig war.
Ralfs Schwester sollte einige von uns mit dem VW ihres Bruders zum Flughafen fahren; die anderen wollten mit dem Taxi folgen. Als dieses draußen wartete, rannte ich noch schnell auf die Straße, weil ich meinen roten Kadett auf einen sicheren Parkplatz ohne Parkuhr stellen wollte. Es war höchste Zeit, loszufahren, und wir waren wegen unseres ersten gemeinsamen Überseefluges ganz schön aufgeregt. Nach dem Einparken meines Autos schmiss ich die Fahrertür fest zu und spürte im selben Moment einen hammerartigen Schlag auf meinen linken Daumen. Es war so heftig, dass ich fast in die Knie ging. Blass vor Schmerz sah ich, was passiert war: Mein Daumen steckte noch in der Tür. Genau gesagt, zwischen der Karosserie und dem Rahmen der zugeschlagenen Tür. Ich wollte es einfach nicht glauben, was ich da sah. Wie flach musste mein Finger sein, dass er dort noch dazwischen passte? Ich schrie laut auf vor Schmerz, so dass Emil und Florian sorgenvoll angerannt kamen und die Tür wieder aufrissen. Da stand ich nun mitten auf der Berger Allee, und mein Daumen wurde dunkelrot und schwoll heftig an. Eigentlich hätte ich sofort zu einem Arzt gemusst, aber dazu war keine Zeit mehr. Die Jungs hakten mich einfach unter und schleppten mich zum Taxi. Den Tränen nahe schmiss ich mich in den Fond, und es ging ab zum Flughafen. Ich war völlig beherrscht vom pochenden Schmerz, nahm alles um mich herum kaum noch wahr und trottete einfach hinter meinen Kollegen her, die mir mein Gepäck abgenommen hatten.
Es dauerte noch unendlich lange, bis wir im Jumbo der Pan Am Platz nehmen konnten. Sofort kümmerte sich Emil um mich und sprach mit der Stewardess. Sie hatte die grandiose Idee für meine schmerzliche Lage: Eiswasser! Ja, das war es. Die Flugbegleiterin brachte mir aus der Bordküche ein Glas mit kaltem Wasser, welches sie zusätzlich noch mit Eiswürfeln aufgefüllt hatte. Ich hielt also meinen Daumen da hinein und es dauerte nur Sekunden, bis sich der Schmerz verzog. Er wurde allerdings durch einen neuen, wenn auch weniger schlimmen ersetzt. Die eisige Kälte tat nämlich auch schnell weh. Ich hatte nun die Wahl und es wurde ein Wechselbad der Pein. Quälende neun Flugstunden lang musste ich meinen lädierten Daumen immer wieder in Eiswasser tauchen und rechtzeitig wieder herausnehmen, damit es keine Erfrierungen gab. Ich hatte also alle Daumen voll zu tun und an Schlaf war kaum zu denken. Die Kollegen waren rührend um mich besorgt und trösteten mich. Emil half mir beim Essen, ein anderer holte neue Eiswürfel aus der Bordküche, wenn die alten geschmolzen waren. So dramatisch hatte ich mir den Beginn unserer Amerika-Tournee wirklich nicht vorgestellt.
Irgendwann war der Flug dann doch vorbei, und die Maschine landete spätnachmittags Ortszeit in New York. Wir brachten die umständliche Einreiseprozedur gehorsam hinter uns - und zwar als Touristen. Für den eigentlichen Zweck unserer Reise hätten wir nicht so schnell eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Mr. Ira Blacker, ein fetter Manager, nahm uns in der Halle des Kennedy Airports in Empfang und fuhr uns mit einer schwarzen langen Limousine und ebenfalls langem, schwarzem Chauffeur in die Stadt. Alles, was ich auf der Fahrt in die City wahrnehmen konnte, war groß und ebenfalls sehr lang. Und hoch. Es war schon dämmrig draußen, und die Highways waren dicht gefüllt mit vor Chrom strotzenden Straßenkreuzern mit langen, potenzerigierten Kühlerhauben dieser 70er Jahre. Entsprechend lang dauerte die Fahrt in die City. Ohne mein Glas mit Eiswasser wurde das schmerzhafte Pochen in meinem Daumen wieder schlimm. Ich quälte mich schließlich seit gut zwölf Stunden damit herum. Blacker versprach, er werde sich sofort um einen Arzt kümmern, sobald wir im Hotel wären. Das ›Goreham‹ in der 55. Straße war für Karl, Emil und mich gebucht. Ralf und Florian wohnten ganz in der Nähe im feineren ›Mayflower‹ am Central Park West. Nachdem Karl und ich unser komfortables Zimmer gemütlich gemacht hatte, nahmen wir erst einmal unsere neue Umgebung in Augenschein. Der Liftboy, der unsere Koffer nach oben gebracht und uns das Zimmer aufgeschlossen hatte, schaltete sogleich überall das Licht und die Gebläse ein, die ich sofort hinter ihm wieder ausschaltete. Es war ja kalt um diese Jahreszeit, und für den Serviceman gehörte es wohl zu seiner Pflicht, alles einzuschalten, was den Komfort des Zimmers demonstrieren konnte. Ich blickte aus dem geöffneten Schiebefenster in die Tiefe der Straßenschlucht. Wir befanden uns immerhin im 27. Stockwerk. Da konnte man die Menschen und Autos unten nur als kleine, bewegliche Punkte erkennen. Eine Klangwolke aus Straßenlärm und Polizeisirenen, die ich bisher nur aus amerikanischen Krimis kannte, drang in unseren Raum. Hier war all dies real und ich empfand es wirklich ziemlich amerikanisch. Der Blick über New York am Abend und über die umliegenden Gebäude mit ihren altmodischen hölzernen Wassertanks und riesigen Neonreklamen auf den Dächern gefiel mir gut, obwohl ich das alles gar nicht so schrecklich modern fand. Es war nur so aufregend anders als bei uns, und die Stadt sprudelte trotz der abendlichen Stunde vor Energie und Licht. Der Boy wollte uns einfach nicht verlassen. Er stand da mit erwartungsvollem Blick im Zimmer herum, bis wir ihm ein paar Dollar Trinkgeld gaben. Für uns sah ein grüner Schein wie der andere aus, weshalb wir ihm vermutlich eine ziemlich fürstliche Summe überreichten. Jedenfalls bedankte sich der junge Mann überschwenglich und las uns vortrefflicherweise in den kommenden Tagen jeden Wunsch von den Augen ab.
Bald darauf klopften auch schon unsere Kollegen bei uns an. Angesichts der vielen Riegel und Schlösser der Türe unserer Suite, erahnte ich, dass es wohl nicht die sicherste Gegend war, in der man uns untergebracht hatte. Ralf stellte uns Henry Israel vor, einen Mitarbeiter von Ira Blacker, der in den nächsten Wochen unser Tourmanager sein sollte. Der gutaussehende Mann mit schwarzem Dreitagebart und funkelnd schwarzen Augen, fuhr sofort mit mir zu einem Hospital, wo es nächtlichen Notdienst gab, um meinen Daumen versorgen zu lassen. Im Krankenhaus angekommen, fiel mir sofort die Unordnung dort auf. Es war ziemlich anders als in einer deutschen Klinik. Vielleicht war es aber auch nur eine simple Notstation für ausgeflippte Fälle. Ich muss gestehen, dass ich nicht viel Vertrauen zu den Leuten dort hatte. Ein Arzt bat mich und Henry Israel nach kurzer Wartezeit in sein Behandlungszimmer. Er sah sich meinen maträtierten Daumen genau an und wunderte sich, dass ich dessen Verwundung so lange hatte aushalten können. Ich schilderte ihm meine Ungeschicklichkeit mit meinem Auto in Deutschland und die Behandlung mit Eis während des Fluges und er war sichtlich erfreut über den cleveren Rat der Stewardess. ›Ein schlimmer Bluterguß unter dem Daumennagel‹, so lautete seine Diagnose, nachdem er durch eine Röntgenaufnahme festgestellt hatte, dass kein Bruch vorlag. Der Schmerz kam vom Druck des angestauten Blutes, das sich wegen des begrenzenden Daumennagels nicht ausbreiten konnte. Der Arzt nahm eine gewöhnliche Büroklammer, bog sie auseinander und erhitzte ein Ende über einem Bunsenbrenner bis zur Rotglut. Dann schmolz er mit dem heißen Drahtende ein kleines Loch in meinen Daumennagel. Das gestaute Blut lief sofort heraus, worauf der Druck in meinem Finger augenblicklich nachließ. Ich hätte den Mediziner umarmen können. Wie clever, wie schmerzlos, wie schnell hatte der Mann mir geholfen! Ich dachte noch, wenn ich nur gewusst hätte, wie, hätte ich das in der Flugzeugtoilette vielleicht sogar selbst machen können. Jedenfalls war ich gewaltig erleichtert. Ein kleiner Verband noch um den Sorgenträger, und mit dem Taxi und Mr. Israel ging es wieder zurück ins ›Goreham‹. Jetzt endlich konnte auch ich unseren Aufenthalt genießen und mich auf die ausgedehnte Reise freuen.
Am nächsten Vormittag sahen wir zusammen amerikanisches Fernsehen. Eine Life-Übertragung aus Rom. Der Papst hatte gerade sein ›Urbi et Orbi‹ verkündet, denn es war ja Ostern, da entdeckte ich auf einem anderen Kanal eine halbstündige US-Soup - völliger Blödsinn - wie es sie in Deutschland noch nicht gab. Eine der beliebtesten, wie mir später gesagt wurde, war in Amerika eine Dritte-Reich-Serie mit der vollkommenen Verarschung der Nazi-Soldateska. Ich fand das erst mal miese, weil mir unsere beschissene politische Vergangenheit zu Hause denn doch zu ernst war, als dass man hier seine Späßchen darüber machen sollte. Aber auf diesen zackig lauten ›sälbsverrrrstänndlich - jawollll - auf, nieder, auf, nieder - strammmmsteh‘n - zu Befähl Herr Majorrr‹-Befehlstondrill, mit dem die Amerikaner uns Deutsche verbinden, bin ich doch ganz schön abgefahren, das muss ich gestehen. Ich brauchte halt meine Zeit, um den verarschenden Witz daran zu empfinden - als Deutscher eben. Und dann ständig Commercials, also Werbespots als Unterbrechung. Auch das gabs bei uns erst viele Jahre später.
Am nächsten Vormittag wurden wir abgeholt und fuhren zum gemeinsamen Frühstück ins ›Rumpelmayr‹, einem der renommiertesten Cafés in New York, direkt am Central Park gelegen. Dort bekam man den besten Cheesecake, den kremigsten Bienenstich und den frischesten Macedoniasalat, den ich je gegessen hatte. Ich mochte dieses Café sehr und habe, wenn wir später in der Stadt waren, keine Gelegenheit ausgelassen, um dort zu frühstücken. Mir fiel auf, dass sie sogar die Orangen- und Grapefruitstücke im Obstsalat enthäutet und entkernt hatten. Echt komfortabel für den Genießer!
Zwei Tage hatten wir, um uns an die neue Zeit und das noch kalte Klima zu gewöhnen. So probten wir nachmittags ein wenig in einem angemieteten Rehearsalstudio (Proberaum), wo Ralf von einem Fernsehteam interviewt wurde, das Wind von unserer Anwesenheit bekommen hatte. Noch ‘ne andere Band probte da, Greenslade, die ständig von Ralf abgewimmelt wurden, wenn sie ihn mal sprechen wollten. Ich fand das ganz schön arrogant. Mein Englisch war damals noch ziemlich schlecht, und deshalb wagte ich nicht, sie zu fragen, was sie wollten, aber wahrscheinlich war es nur ein Autogramm. Greenslade wurde jedenfalls für die erste Zeit unser ›Opening Act‹, unser ›Support‹. Bei uns heißt das schlicht Vorgruppe.
Am einem weiteren Nachmittag ließen wir uns vom berühmten New Yorker Starfotografen Maurice Seymour ablichten. Dieses Schwarzweißfoto wurde drei Jahre später unser Plattencover für die deutsche Ausgabe von Trans Europa Express. Bei einem Empfang in Florians Musikverlag ›Famous Music‹, in einem der vielen Wolkenkratzer in Brooklyn, gab es eine kleine Party. Man beäugte uns wie Außerirdische. Am großen Konferenztisch saß eine Mitarbeiterin, die mir sofort auffiel. Eine äußerst aparte junge Frau, die indianisch wirkte mit ihren schwarzen langen Haaren, dem scharf geschnittenem Gesicht, den mandelförmigen Augen und der getönten Haut. Sie sandte intensive Blicke in meine Richtung. Anscheinend war ich ihr sympathisch. Später wurde sie mir als Anne vorgestellt, die rechte Hand des Chefs. Anne plante für den nächsten Tag ein Picknick im Freien, das ich mit der alten Super-8-Kamera von Bell & Howell filmte, die mir mein Vater auf die Reise mitgegeben hatte. Ein paar Decken, ein paar Tüten mit Sandwiches, Kuchen, Kaffee und Donuts waren schnell organisiert, und wir spielten Frisbee im noch kahlen, aber sonnigen Central Park. Wir machten nur Blödsinn an diesem kalten Apriltag und Anne gefiel mir immer besser. Ich hatte noch nie eine so hübsche Frau gesehen. Ihre Schönheit machte mich vollkommen verrückt und unsicher, und das schritt rapide voran. Bald dachte ich nur noch an sie. Sie hatte mir immer wieder Blicke zugeworfen, die absolut unmissverständlich waren. Auf eine Gelegenheit für mehr musste ich aber noch warten.
Eines der ersten Konzerte fand am 3. April 1975 in Rochester, im Norden des Bundesstaates New York statt. Es verlief völlig unspektakulär und fast unbeachtet von der Presse. Das war auch so geplant, da wir uns erst einmal einspielen mussten und uns keine Fehler vor Kameras oder gierigen Reportern leisten wollten. Eine ungemütliche kalte Halle erwartete uns in der Kleinstadt. Das Publikum konnte kaum etwas mit uns anfangen. Dass man dort unsere Musik schon im Radio gehört hatte, würde ich eher bezweifeln. Ich kann mich auch an keinen Höhepunkt erinnern, außer, dass während unseres Auftritts ein eisiger Blizzard übers Land gefegt war, und wir anschließend ziemlich bestürzt in eine stille weiße Winterlandschaft starrten. Ein Kälteeinbruch dieser Kategorie war für uns ebenso fremd wie den Jugendlichen von Rochester unser unterkühlter Elektronensturm. Der kleine Flugplatz des Städtchens musste geschlossen werden, und wir traten die Rückreise am nächsten Tag mit einem gemieteten Kombi an. Es war eine ziemlich abenteuerliche Fahrt über dick zugeschneite Highways, die sich zu einer gewagten Rutschpartie zurück nach New York entwickelte.
Dort war es dann wieder schneefrei, wenn auch sehr kalt. Gut, dass wir alle unsere dicken Wintermäntel und Wolljacken mitgenommen hatten. Nie werde ich das Bild von Ralf vergessen, der mich mit seinem schwarzen Wollcoat mit Pelzkragen eher an einen Großindustriellen oder Banker erinnerte. Er hatte auch ständig einen ledernen Diplomatenkoffer mit goldenem Zahlenschloß bei sich und wirkte mit seiner altmodischen Hornbrille eher konservativ, nicht gerade wie ein Popstar. Florian dagegen hüllte sich in einen langen beigefarbenen Kamelhaarmantel, der, ganz im Stil der 70er Jahre, mit breiten Revers auch durchaus von einem Mafiaboss hätte sein können. Jedenfalls trugen die Gangster in Martin-Scorsese-Filmen immer solche modisch geschnittenen und eng taillierten Mäntel. Mit einer schmalen, gefährlich aussehenden Sonnenbrille aus dünnem Goldmetall verdeckte Florian seine Augen.
Ich selbst war damals noch ziemlich farbig drauf. Eine dreiviertellange knallbunte Wolljacke mit großen Karos und Knöpfen, wie sie die Holzfäller in Canada tragen, hatte ich mir vor der Abreise zugelegt. Auch trug ich meine Haare noch länger als meine Kollegen und ich umwickelte meinen Hals mit einem weichen, leuchtend roten Wollschal. Karl wärmte sich - immer noch ganz studentisch - mit seinem dunkelbraunen Dufflecoat. Jeans und ehemals weiße Turnschuhe bildeten geradezu eine Künstlerphilosophie für ihn.
Die nächsten Tage blieben wir noch einmal in New York und vertrieben uns die Zeit mit Schaufensterbummeln und nachmittäglichen Proben. Ralf hatte ein sonderbares Gerät aufgetrieben - das ›Vaco Orchestron‹. Ganz neu auf dem Markt, war es eine modernere Version des ätherischen Mellotron. Man konnte mittels dünner Cellophanscheiben, auf die Lichttonlinien gedruckt waren, original aufgenommene Instrumente und menschliche Chöre wiedergeben. Die transparenten Scheiben waren so groß wie Schallplatten und ebenfalls mit einem Loch in der Mitte versehen, die Linien verliefen nicht wie Rillen bei Schallplatten spiralförmig von außen nach innen, sondern bildeten in sich geschlossene Ringe. Jeder Ring erzeugte eine einzige Stimme und Tonhöhe. Da alle Linien parallel und gleichzeitig von einer Fotozellenreihe abgetastet wurden, konnte man sie mittels einer üblichen Tastatur polyphon abspielen. Der Klang war einfach toll. Das markante Gerät klappte ganz vorzüglich, und es war eine attraktive klangliche Bereicherung für unsere Musik. Bereits auf der Tournee setzte Ralf es schon in unseren Songs ein. Vor allem die Chöre und Streicher hatten etwas Faszinierendes. Sie klangen ein bißchen leiernd und melancholisch. Es lag am instabilen Antrieb über Gummibänder; Gleichlaufschwankungen waren die Folge. Aber das schadete dem Charme dieser Klänge überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, gerade das leichte Leiern war charakteristisch für das Vaco-Orchestron, ein unförmig schwerer Holzkasten in Wohnzimmerdesign. Später wurde es durch ein zweimanualiges und mit zwei Laufwerken ausgestatteten Modell ersetzt, auf dem man verschiedene Instrumente oder Chöre gleichzeitig spielen konnte.
Eines Abends kamen Ralf und Florian, die tagsüber ständig irgendwelche geschäftlichen Termine ohne uns andere wahrnahmen, wieder einmal in unser Hotel. Wir waren, wie meistens abends, zum Essen verabredet und fuhren mit unserem Manager zusammen in der sehr langen Limousine, immer noch gefahren vom sehr langen schwarzen Chauffeur, in ein elegantes Restaurant. Ralf und Florian zeigten uns neue Armbanduhren, die sie am Nachmittag in einem teuren Schmuckgeschäft am Broadway von ihrem Musikverlag als Bonus für die erfolgreiche Platte geschenkt bekommen hatten, von der mittlerweile um die 450 000 Einheiten verkauft worden waren. Die Chronometer, so berichtete Ralf stolz, hatten sie sich selbst aussuchen dürfen. Er hatte sich für eine elegante Weltzeit-Armbanduhr entschieden, die ganz aus Gold gefertigt war. Die Kontinente der Erde waren in verschiedenen Farbtönen des Edelmetalls gearbeitet. Das Ziffernblatt stellte den Globus dar, welcher von vertikalen Linien in die Weltzeitzonen unterteilt wurde. Ein winzig kleines Flugzeug, das in Sekundenschritten um die Erde tickte, bildete die Spitze des langen Sekundenzeigers. Ein wunderschönes und bestimmt sehr teures Kunsthandwerk hatte sich Ralf da ausgewählt. Florian dagegen hatte eine schwere Rolex-Armbanduhr ausgewählt. Ein protziges Stück Platinmetall in Techniklook mit einer fetten Aufziehkrone und dicken Knöpfen für die Kurzzeitmessung. Die Wahl beider Uhren sprach für die Künstler selbst. Ralf und Florian waren so unterschiedlich in ihrem persönlichen Geschmack wie in ihren musikalischen Talenten. Diese Tatsache bildete aber gerade ihre kreative Besonderheit. Mich selbst berührte es jedoch seltsam, wie sehr sie sich von uns anderen absonderten, und dass sie uns nun auch noch ihre wertvollen Geschenke vorführten.
Ihr Verhalten hatte mich nicht zum ersten Mal nachdenklich gestimmt. Der Umgang mit uns Freunden war Ralf und Florian nicht immer leicht gefallen. Wie wir uns fühlten, darüber dachten die beiden wohl kaum nach. Das war aber keine böse Absicht von ihnen, sondern fehlende Empathie - die mangelhafte Wahrnehmung der Gefühle ihrer Kollegen, wie ich es mir später erklärte. Es hatte natürlich auch mit unseren unterschiedlichen familiären Herkünften zu tun.
Auf jeden Fall war alles derart aufregend neu und positiv in New York, dass ich solche Randerlebnisse und unangenehmen Gefühle schnell wieder verdrängte. Nach zwei ›Warm-Up-Gigs‹ fand am 5. April das erste große Konzert statt. Wir sollten im Beacon Theatre am Broadway auftreten. Als wir nachmittags dort ankamen - von unseren Hotels aus bequem zu Fuß zu erreichen - staunten wir nicht schlecht. Das Beacon war ein gut erhaltenes Art Deco Theater, das schon lange unter Denkmalschutz stand. Mit mehreren Balkonen übereinander hatte es bestimmt an die zweitausend Sitzplätze. Alle Ornamente war goldfarben und die Polstersitze hatte man mit purpurnem Samt bezogen. Es erinnerte mich schon ein bißchen an das ebenfalls plüschig-rote Olympia in Paris, wo wir bereits im Vorjahr schon einen kleinen Auftritt absolviert hatten. Aber hier war alles viel größer, viel luxuriöser. So war eben Amerika ... An der Außenfassade machte eine riesige Neonlichtreklame mit unserem Namen und denen unserer beiden Vorgruppen - Greenslade und Michael Quatro - das Straßenpublikum auf das ungewöhnliche Musikereignis dieses Abends aufmerksam.
Unser Equipment hatten wir zusammen mit den Bühnenhelfern schnell aufgebaut. Viel war es ja nicht, wir hatten nur die beiden Synthesizer, eine Farfisa-Orgel, unsere beiden Elektro-Drums, Karls Vibraphon und Florians Elektro-Flöte dabei. Und eben das neue Vaco-Orchestron. Auch ineinander stapelbare Lautsprecherboxen, die ich Jahre zuvor selbst gebaut hatte, wurden auf die Bühne hinter uns gestellt, damit wir uns selbst hören konnten. Diese Boxen hatten eine außergewöhnliche Eigenschaft. Nach einem von Florian besorgten deutschen Bauplan hatte ich sie aus Furnierholzplatten und Biegesperrholz gebaut. Es waren sogenannte Baßrutschen. Ein Tieftonlautsprecher strahlte im oberen Teil der Box seine Schallwellen nach vorn ab. Die nach hinten abgestrahlten Frequenzen wurden nicht wie bei einer üblichen Baßbox mit Dämm-Material ›gesumpft‹, sondern durch ein gefaltetes Horn in den unteren Teil der Box geleitet und über eine Austrittsrutsche wiederum nach vorn abgegeben. Der Effekt war immens. Die Tiefen, die unten herauskamen, waren um vieles verstärkt und hatten wunderbare Subbässe, die einem den Magen umdrehen konnten. Alle Boxen differierten um jeweils zwei Wandstärken in ihrem Breitenmaß. Die unteren Hälften mit den Austrittsrutschen konnten durch Schnellspannverschlüsse abgenommen und bei Transporten ineinander gestapelt werden. Das sparte Platz. Allerdings konnten wir diese edlen Speaker nicht lange benutzen, da sie der rauhen Behandlung auf Tournee dauerhaft nicht gewachsen waren. Viel zu schnell gingen die genialen Kabinette während der vielen Transporte kaputt und wir mussten den Schrott dann irgendwann in den Staaten zurücklassen. Schade drum.
Als Lightshow hatten wir Kästen mit farbigen Neonröhren mitgebracht, die ich ebenfalls schon in den Jahren zuvor gebaut hatte. Wir stellten sie einfach hinter uns auf den Bühnenboden. Die blauen Neonschilder mit unseren Vornamen, von denen inzwischen jeder sein eigenes hatte, positionierten wir direkt auf den Boden vor uns. Emil hatte eine riesige Dialeinwand aufgespannt, auf die er während der Show, passend zu unseren Songs, einige seiner schönsten Gemälde projizierte. Das klappte recht gut, war aber ein wenig lichtschwach, da sein Projektor eine ziemlich schlappe Birne hatte. Videobeamer kannte man damals noch nicht.
Der Abend nahte, und wir wollten nun unsere Feuertaufe in der berühmtesten Metropole der westlichen Welt bestehen. Die zweitausend Plätze des Theaters waren vollkommen ausverkauft. Unser Autobahn-Hit, der ständig im Radio lief, war die beste Werbung für das Konzert. Nachdem die beiden Gitarrenbands ihre eher unspektakulären Auftritte absolviert hatten, kamen wir vier deutschen Musiker spät abends auf die Bühne. Als wir mit unserer minimalistischen Show begannen, war es mucksmäuschenstill im Theater. Die Leute waren schon von unserem ordentlichen Aussehen mit Anzügen und Krawatten und unserer konzentrierten Steifheit fasziniert, ja schockiert, und unsere ›exotischen‹ Klänge taten ihr übriges. Solche Typen wie uns hatten sie noch nicht gesehen, geschweige denn gehört. Die Synthesizer mit ihren satten tiefen Klängen waren absolut neu für das Publikum. Zwar war das Instrument in Amerika erfunden und produziert worden, doch hatte es bisher nur eine untergeordnete Rolle in der Popmusik gespielt. Bands wie Emerson, Lake & Palmer hatten es auch schon benutzt und andere Künstler hatten einige musikalische Figuren in ihren Songs damit eingespielt. So komplex und konsequent jedoch, wie wir den Synthie für unsere komplette Musik benutzten, war er wirklich etwas ganz Neues für die Amerikaner. Es ließ sich nicht übersehen: Hier waren wir mit unseren Klängen um Lichtjahre voraus. Ich sah nur offene Münder in neugierigsten Gesichtern mit fassungslos weit aufgerissenen Augen, als Ralf während unseres Autobahn-Songs die Sounds panoramamäßig von links nach rechts und wieder zurück über die gesamte Bühnenbreite donnern ließ. Das Stück war einfach unser Hammer. Und wir genossen das.
Da wir allerdings noch nicht viele Lieder hatten, spielten wir die wenigen, die wir hatten, sehr lang aus. Stücke von den Platten Ralf & Florian und Autobahn, spielten wir fast doppelt so lang, wie auf den Tonträgern. ›Tongebirge‹, Titel wie ›Mitternacht‹, ›Tanzmusik‹ oder ›Kometenmelodie‹, dehnten wir einfach aus. Karl und ich klopften auf unsere Elektroschlagbretter wie irre. Durch das Langziehen unserer Songs kamen wir mit der Show auf eine akzeptable Länge, und schon allein das Stimmen und Einstellen der Synthesizer zwischen den Songs war derart attraktiv für die Leute, dass unser Minirepertoire gar kein Problem bedeutete.
Die angesehene New York Times schrieb am nächsten Tag in einer Review des Abends, das Publikum hätte unser Konzert so andächtig verlassen, wie nach einem Kirchgang. Und selbst die deutsche Teenie-Illustrierte Bravo war über den großen Teich geflogen, um unseren triumphalen Auftritt mitzuerleben. Die Zeitschrift widmete uns einen Beitrag, der die gleiche Überschrift trug wie das nächste Kapitel: