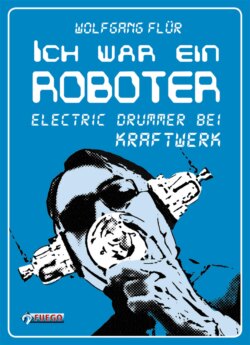Читать книгу Ich war ein Roboter - Wolfgang Flür - Страница 8
Оглавление2
KHATCHATURIAN IM FIEBER - KLICKERN, KNISTERN, FLÜSTERN
Frankfurt am Main, 17. Juli 1951 +++ Im zarten Alter von vier Jahren begann mich alles zu faszinieren, was klingt und tönt. Ich tippte, klopfte und schnippte gegen sämtliche Materialien, die mir unter die Finger kamen, um deren Klang zu erforschen. Musikinstrumente wurden bei uns zu Hause nicht gespielt. Gesungen wurde nur gezwungen unter dem Weihnachtsbaum, also nur einmal im Jahr, und ich erinnere mich mit Unbehagen, dass das immer krampfig war.
Als Zwilling und dritter Sohn meiner Eltern Hildegard und Heribert 1947 im zerbombten Frankfurt am Main geboren, spielte ich mit meinen Brüdern und den Nachbarkindern am liebsten auf den umliegenden Trümmergrundstücken. Dabei konnte man allerlei Unbekanntes und Tönendes finden. Natürlich lag auch Gruseliges und Gefährliches unter den mit Unkraut und hohen Pflanzenstauden überwucherten Steinhaufen der zerbombten Wohnhäuser in unserer Straße. Gefährlich waren die Entdeckungsreisen in dunkle Keller allemal. Regelmäßig brachten wir Schürf- und Platzwunden an Armen und Beinen mit nach Hause. Gewagte Kraxeleien versetzten unsere armen Eltern oft genug in Angst und Schrecken.
Da es an der Zeit war, wieder alles aufzubauen, was unsere Eltern sich hatten zerstören lassen, gab es kaum Spielzeug. Die ruinierte Wirtschaft hatte nur wenig Ausstoß und wir Kinder mussten uns unsere Spiele selbst ausdenken. Der Fantasie waren dabei kaum Grenzen gesetzt. Die Sommer waren heiß und wir brauchten nicht viel. Jeder hatte so wenig wie die anderen und es gab deshalb auch nichts, was wir uns gegenseitig hätten neiden können. Außer Sandalen und den obligatorischen Lederhosen, die viel zu groß um unsere dünnen Leiber schlenkerten, hatten wir nichts auf dem Leib.
Wir hielten uns am liebsten auf den Straßen auf, wo wir gar zu gerne nachmittags auf den gelben Eiswagen warteten, der, von zwei Pferden gezogen, die Familien mit Kühleis versorgte. Für zehn Pfennig schlug der Fuhrmann gekonnt abgezirkelte Stücke von meterlangen gefrorenen Wasserbarren mit dem Hammer ab, und warf sie in die von uns bereitgestellten Zinkeimer. Kleine kalte Splitter flogen dabei glitzernd durch die warme Sommerluft und fielen auf den Boden. Sie waren unsere Beute. Gierig prügelten wir uns um sie und lutschten sie schnell weg. Das Knirschen und Knacken der kristallenen Eisstangen übte eine ungeheure Faszination auf mich aus.
Vater war im Krieg bei der Luftwaffe gewesen. Aus der Gefangenschaft in Belgien hatte er von den Amerikanern Swingmusik auf leicht zerbrechlichen Schellackscheiben mitgebracht – von Benny Goodman, Glenn Miller und Duke Ellington. Er spielte sie auf einem hölzernen Koffergrammophon in unserer Sachsenhauser Wohnung ab. Dazu musste er umständlich eine Stahlnadel in den Führungsschlitz des hohlen blechernen Tonarms stecken und sie mit einer Schraube an der Membran des Tonabnehmers festziehen. Dann drehte er an der Seite mit einer Kurbel und zog das Federwerk für den Laufmotor auf, um einige Minuten Drehzeit des mit schwarzem Filztuch belegten Plattentellers zu erreichen. Er öffnete nun im unteren Teil des Holzmöbels zwei kleine Türen, hinter denen sich ein gefaltetes Horn befand, das die Musik entließ. ›In The Mood‹ von Glenn Miller war damals der Hit, den man ständig auf AFN, dem Soldatensender der amerikanischen Besatzer hörte.
Der schwarze Musikkasten war aufregend für uns Kinder, aber es war uns strengstens verboten, das wertvollen Gerät anzufassen. Die krächzende Musik, die daraus hervorkam und die perfekte Mechanik des Uhrwerks faszinierte uns aber derart, dass wir uns oft über das Grammophon hermachten, sobald die Eltern einmal nicht da waren und vergessen hatten, das Wohnzimmer abzuschließen, in dem der Kasten repräsentativ aufgebaut stand. Meist wurde aber abgeschlossen. Mein Zwillingsbruder und ich waren gnadenlos neugierig und geschickt. Mit einem selbstgebastelten Dietrich bekamen wir immer wieder die Tür zum ›Schönzimmer‹ auf, in dessen Kredenz es auch ein Barfach mit Eierlikör gab. Ziemlich regelmäßig naschten wir von der süßen Creme und füllten danach den Schwund mit Milch auf. Ich war besonders gierig und konnte nicht genug davon bekommen. Ich verlängerte und verlängerte die süße Brühe, bis sie ganz blass aussah und völlig laff schmeckte. Irgendwann flog der ganze Schwindel auf und Vater legte mich heftigst übers Knie. Keinen Ton gab ich dabei von mir. Zu stolz war ich, dem Alten meinen Schmerz zu zeigen. Ich verachtete ihn für seine feige Tat, die er nur für seine Frau ausführte, um ihr den starken Mann zu mimen. Früh merkte ich, dass Vater ein schwacher Mensch war, der sich nicht gut durchsetzen konnte. Früh merkte ich auch, dass es ihm gar keinen Spaß machte, mich zu verhauen. Er tat es wohl mehr für meine Mutter, die Zucht durch ihn für mich erwartete. Mutter hatte auf jeden Fall die Hosen an in unserer Familie, und ich sehe sie immer noch in ihren eleganten Kleidern und beim Lackieren der Fingernägel vor mir. Heimlich beobachtete ich sie manchmal durchs Schlüsselloch beim Anziehen ihrer scharfen Unterwäsche, die ich auch schon mal selbst überstreifte, wenn sie fort war. Schön glatt und kühl fühlten sich die seidigen Fetzen auf meiner Haut an und ich drehte mich lustvoll von allen Seiten betrachtend vor dem Spiegel. Ja, ich hatte Spaß an mir.
Vor dem Schlafengehen holte uns die Urgroßmutter, die gemeinsam mit uns den zweiten Stock ihres Hauses in der Rubensstraße bewohnte, in ihr riesiges, mit Möbeln vollgestopftes Zimmer, setzte uns an den großen Esstisch mit der Samtdecke drauf und las uns unter ihrer riesigen Lupe aus Grimms Märchen vor. Dabei zog die alte Dame die Deckenlampe an der Schnur ganz tief über den Tisch herunter, damit es schön schummrig im Zimmer wurde. Lange, mit Glasperlen beknüpfte Fransen des pendelnden Lampenschirms warfen dabei gespenstische Schatten und bizarre Glitzerreflexe auf das weiche Tuch. In der Nähe des Erkerfensters stand der eiserne Kohleofen, auf dem die Uroma gern Äpfel schmorte. Das ganze Zimmer roch dann lecker nach Backobst und getrockneten Pflaumen, die mit Zahnstochern zu kleinen Männchen gesteckt auf der Kredenz aufgereiht waren. Dort stand auch der quadratische schwarze Volksempfänger, vor dem die wache Frau oft saß, um den Nachrichten und den Reden unsers ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer zu lauschen. Sie verehrte ihn über alle Maßen. »Der einzige gescheite Mann in Deutschland«, das war ihre feste Überzeugung. Die abendliche Atmosphäre war äußerst sinnlich und öffnete uns für die Geschichten, die wir zu hören bekamen. Man kann sich denken, was aus Kindern wird, denen in solch gemütlicher Atmosphäre die schönsten und gruseligsten Märchen zelebriert werden. Eine bessere Lehre für unsere Fantasie konnten wir nicht bekommen.
Unser Vater förderte noch diese sinnliche Ausbildung dadurch, dass er uns ständig fotografierte und kleine Filmchen mit uns drehte. Er war Mitglied in einem Frankfurter Filmclub, der regelmäßig Wettbewerbe veranstaltete, an denen er sich mit der ganzen Familie und mit Freunden beteiligte. Das waren immer die aufregendsten Stunden, wenn wir uns verkleiden durften und uns wie kleine Stars fühlten. Ich selbst war dann kaum zu bremsen und brachte oft alle zum Lachen oder zur Verzweiflung, weil ich kein Ende finden wollte.
Gelacht wurde überhaupt viel in unserer Familie. Meine Mutter war eine äußerst temperamentvolle und lebenslustige Frau, die mit ihrem Mann gern Freunde einlud und ausgelassene Feste feierte. Dabei lauschten wir Kinder abends in unseren Bettchen der rhythmischen Musik aus lateinamerikanischen Ländern. Samba, Rumba, Cha-Cha-Cha, Mambo und Foxtrott - ich habe ihre Lebendigkeit heute noch im Ohr. Am fröhlichsten war immer der Freitag. Das war unser Badetag. Wir Kinder wurden dann gleichzeitig in die Wanne gesteckt und von Vater abgeschrubbt. Das Wasser musste vorher umständlich in einem Badeofen mit Brikettfeuer erhitzt werden. Beim Waschen ging es natürlich auch nie ohne Theater ab. Schauspielern und die Selbstdarstellung waren überhaupt unsere Lieblingsbeschäftigungen.
Träumen und Trödeln war indes etwas, dem ich mich zum Leidwesen meiner Mutter zu oft und zu gerne hingab. Immer war ich mit meinen Gedanken irgendwo anders, aber bestimmt nicht bei den ›vernünftigen‹ Dingen, und musste deshalb meist hart in die Wirklichkeit zurückgerufen werden. Bei der Oma genossen wir aber alle Freiheiten. Ich konnte voller Entzücken am Piano sitzen und die Klaviersaiten bearbeiten. Es war jedoch kein richtiges Musizieren, eher ein ungestümes Draufloshämmern auf die geduldigen Tasten. Mein rhythmischer Krach muss ein Greuel für die ›Grossi‹ gewesen sein, denn sie floh dann meistens in ihre Küche und trank ein Piccolöchen für ihren Blutdruck.
Eine schwarze ›Adler‹ entdeckte ich auch bei ihr, eine riesige Schreibmaschine. Es machte mir den größten Spaß, auf der Tastatur herumzuhacken und beim Zeilenumbruch auf den erlösenden Klingelton zu warten. Toll sahen die Wortbildungen hinterher auf dem Papier aus, einfach grotesk. Es war aber mehr der Klang und der Rhythmus der metallenen Typen, die mich beim Schreiben belebten. Takt geben und Zeichen setzen war meine Sache geworden, ohne dass ich damals auch nur ahnen konnte, wie ich später, viel später, jahrelang auf die Tasten hauen würde, um meine eigenen Geschichten aufzuschreiben oder diesen Bericht.
Uroma liebte ich am allermeisten. Sie hatte immer tolle Geschichten für uns parat, gruselige und schöne. Im Sommer durfte ich manchmal bei der gebildeten Frau Ferien machen. Sie hatte ein Häuschen in Filsen, einem katholischen Flecken direkt am Rhein, gegenüber von Boppard. Dort am Hang der rheinland-pfälzischen Weinberge lag der Ort, ärmlich gewachsen um die schlanke Dorfkirche herum, eingezwängt zwischen der alten Rheinuferstraße und den Gleisen der Bundesbahn, die damals noch mit fauchenden Dampfloks fuhr. Wie von einem Messer geschnitten, klaffte die Trasse mitten durch den schmalen Ort. Einen einzigen Bahnübergang gab es, und wenn der Stellwärter aus seinem Häuschen herauskam und seine Uniformmütze aufsetzte, um mit einem Klingeln die Barrieren per Handarbeit herunterzukurbeln, dann lief für einige Zeit erst einmal nichts mehr. Filsen war in zwei Teile zerschnitten.
Mit dem Küster der Kirche war die fromme Uroma lange befreundet, und sie schickte mich stets abends um sechs Uhr zu ihm in sein Gotteshaus, um die Glocke zu läuten. Das war vielleicht ein Spaß. Am dicken, geknoteten Seil zog ich mit meinen dünnen Ärmchen so lange und rhythmisch, bis ich mich an ihm festhalten und durch den Schwung der schweren, gusseisernen Form hinaufziehen lassen konnte. Ich wog ja nichts, und die Glocke hatte gar keine Last mit mir. Es ging bestimmt zwei Meter hoch. Schon damals wurde ich vom Küster für meinen ordentlichen Rhythmus gelobt: »Junge, du machst das ja besser als ich selbst.«
Nach meinem klangerzeugenden Kraftakt musste ich in einem Stall, der direkt an die Kirche angebaut war, die Ziege des Küsters melken. Stolz lief ich dann, die dampfend warme Milch in einer randvoll gefüllten Porzellantasse balancierend, die staubigen Gassen hinab zum Haus der Urgroßmutter. Oft kam ich aber nur mit der Hälfte des Tasseninhalts an. »Mein Elixier für‘s Altwerden«, klärte mich die Kluge verschmitzt auf.
Und wenn es Abend wurde, dann setzte sie sich oft noch mit mir auf das niedrige Mäuerchen der alten Bundesstraße, auf der damals kaum Autos fuhren, höchstens hundert Meter vom Haus entfernt, und wir schauten lange auf die behäbig vorbeituckernden Passagierschiffe der weißen ›Köln-Düsseldorfer Raddampfer‹ und tief im Wasser schnaufenden Schlepper, die an langen Stahltrossen mit Gütern beladene Lastkähne hinter sich herzogen. Je näher sie an uns vorbeifuhren, um so größer war unsere Freude über ihre Wellen, die bedrohlich klatschend unser Ufer überschwemmten. Wie konnte sie sich mit mir freuen, die großherzige Oma, und wie liebte ich diese innigen Tage in Filsen, wo ich die Gute einmal ganz für mich alleine hatte. Nie hätte ich sie hergeben wollen, doch Jahre später wurde die alte Dame noch mit 88 Jahren auf derselben Straße beim Überqueren von einem Auto angefahren und brach sich beide Beine. Wir dachten alle, sie käme nicht mehr aus dem Hospital, jedoch - es war nicht zu fassen - nach einigen Wochen humpelte die Tapfere wieder an einem Spazierstock aus dem Krankenhaus und fuhr geheilt nach Hause. Sie war einfach nicht klein zu kriegen und wurde wegen ihrer robusten Natur 96 Jahre alt. Solch ein geniales Alter, verbunden mit ihrem wachen Geist, würde ich mir selbst wünschen. Uroma Katharina war eben ein echtes Vorbild an Lebenslust und Stärke.
Koblenz, 1955 +++ Die Familie war inzwischen vom hessischen Frankfurt nach Koblenz gezogen, der Stadt am Deutsche Eck, spitz eingezwängt zwischen Mosel und Rhein, umrahmt vom Karthäuser Bergrücken und der gegenüber liegenden Festung Ehrenbreitstein. Das berühmte Denkmal auf dem nördlichsten Zipfel der Stadt, wo sich die beiden europäischen Flüsse treffen, hatte damals noch nicht wieder seine im zweiten Weltkrieg zerstörte Kaiser-Wilhelm-Reiterstatue in Bronce zurückerhalten. Das Bauwerk war noch bis 1993 nur ein steinerner Sockel, und der sah wie ein Zahnstumpf aus, dem oben was fehlte.
In Koblenz hatte mein Vater eine bessere berufliche Stellung als Augenoptiker angenommen. Hier hatte mir meine Patentante einmal eine Hohner Mundharmonika mitgebracht, die mein ständiger Begleiter wurde. Das Instrumentchen hatte mich regelrecht mit Musik infiziert. Es zu spielen war schnell gelernt, und da es klein war, konnte ich es immer in meiner Hosentasche bei mir tragen. Auf sonntäglichen Spaziergängen, die unsere Eltern oft mit uns durch die Rheinwiesen nach Braubach und Schloß Stolzenfels machten, habe ich gern kleine Melodien gespielt, die oft von einer leidenschaftlichen Melancholie geprägt waren. Meinem Zwillingsbruder gefielen sie anscheinend besonders gut, denn er prophezeite mir schon im Alter von acht Jahren: »Du wirst bestimmt einmal weltberühmt, Wolfgang.« Da konnte ich mir überhaupt nichts drunter vorstellen, was das ist - berühmt sein.
Größten Spaß hatten wir Jungs auch, wenn wir nach dem Zubettgehen noch im Radio spannenden Hörspielen lauschen durften. Das Licht war in unserem Zimmer bereits gelöscht; nur die magisch grüne Glasscheibe mit den Radiosendern und dem Pegelanzeiger des Empfängers beleuchtete schwach die Kommode, auf der er stand. Die Dunkelheit ließ unsere Vorstellungskraft aufblühen, während wir den Stimmen der Darsteller und den Geschichten lauschten. Heute weiß ich, dass das besser war als jedes Fernsehen, weil wir uns die Figuren, die Landschaften und Geschehnisse allesamt in unseren Köpfen selbst ausmalen mussten.
Dämmerlicht und zarteste Geräusche liebte ich besonders beim samstäglichen Beichtgang in unserer katholischen St.-Joseph-Kirche. Dem neugierigen Kaplan im intimen Beichtstuhl meine Sünden der Woche zu verraten, war hingegen für mich immer äußerst beschämend. Aus Wut log ich ihm deshalb oft schlüpfrigste Verfehlungen gegen den christlichen Katechismus vor, so dass ihm hinter dem aus Holz geschnitzten Gesichtsgitter die Schweißperlen auf die Stirn traten. Wir hatten die perfekte Symbiose. Er wollte ausführlichst ›diese Schmiersachen‹ gebeichtet bekommen, ich dagegen wollte eine lange Bestrafung erreichen. Zehn ›Vaterunser‹ und noch einmal zehn ›Gegrüßet seist Du, Maria‹ waren das Mindeste, was ich als Buße suchte. Dann flitzte ich zufrieden aus dem Beichtstuhl und suchte mir auf der Frauenseite eine Alte, die sich dort zum Gebet niedergelassen hatte. Ich kniete mich ganz nah neben sie in die Bank und faltete meine Händchen, kaum fähig über die Kirchenbank zu reichen. Ich schloß meine Augen und konzentrierte mich ganz auf das Geräusch ihrer flüsternden Lippen. Die Frauen beteten ganz leise ihren Rosenkranz, der aus Glasperlen aufgefädelt war. Das leise Klickern der Perlen und ihr Flüstern war es, was ich suchte. Im spätnachmittäglichen Halbdunkel der Kirchengewölbe und im Anblick des rubinroten ewigen Lichts auf dem Hochaltar und berauschender Farben der buntgläsernen Kirchenfenster hatte ich es einmal erlebt, wie eine Frau, nachdem sie ihren Mittelfinger zärtlich an der Zungenspitze beleckt hatte, so sanft das Seidenpapier ihres kleinen, goldumrandeten Gebetbuches umblätterte, dass mir das zarte Knistern der hauchdünnen Seiten eine genüßliche Gänsehaut und einen steifen Penis bereitete. Ich suchte mir immer wieder diese lustvolle Gelegenheit aus Klickern, Knistern und leisem Geflüster. Wohlige Schauer liefen mir jedesmal den jungen Rücken herunter, und ich konnte nicht genug davon bekommen. So war ich immer froh, wenn ich lange Buße tun durfte, konnte ich mich doch immer wieder dieser sündigen Lust aus zartem Hören hingeben und vor allem länger draußen bleiben.
Mit zehn entdeckte ich die weite Welt des Transistors. Mein großer Bruder hatte von der Schule ein paar Teile mitgebracht, einen Kristalldetektor, eine Diode, eine kleine Spule und ein Potenziometer, mit denen man ein funktionierendes Radio zusammenlöten konnte. Über eine simple Antenne war das Gedrähte tatsächlich fähig, Radiowellen aus dem Äther einzufangen, die man dann per Kopfhörer in die Lauscher schicken konnte. Ich glaube, wir bekamen nur Mittel- oder Langwelle herein, und die kratzte und rauschte ganz schön. Aber mit Geduld und Fingerspitzengefühl am Poti gedreht, konnte man durchaus etwas Hörbares erreichen. Das war höchst spannend. Mit solch wenigen Teilen ein eigenes kleines Radio zu bauen und richtig Töne zu hören, die von irgendwoher weit draußen kamen, das haute mich echt um, das brachte meine Fantasie zum blühen. Ich wollte nun unbedingt, wie das bei Geschwistern ja immer so ist, ein eigenes ›Spion-Radio‹ haben, wie ich es nannte. Kurz darauf, das war so um 1957, entdeckte ich dann auf dem Schulweg im Schaufenster eines Radiohändlers die Perfektion der physikalischen Hausaufgabe meines Bruders - ein modernes japanisches Transistorradio. Es hatte sogar schon einen kleinen eingebauten Lautsprecher und eine verchromte Teleskopantenne. Auf dieses Kästchen hatte ich es abgesehen wie wild. Ich weiß noch ganz genau, dass es etwas mehr als zehn Mark gekostet hat - eine Unmenge Geld für mich - und es war aus weißem Plastik mit einem gerasterten Tuningrad hinter einer im Deckel eingelassenen Lupe, auf der man die vergrößerten Frequenzzahlen der Sender ablesen konnte. An einer hübsch geflochteten Schnur hielt man das kleine Gerät in der Hand und ich konnte so schön damit angeben, wenn ich draußen herumlief. Das war modern und es schmückte mich vor meinen Freunden. Zusätzlich besaß es noch einen Ohrhöhrer, mit dem ich abends unter meiner Bettdecke, verborgen vor meinen Brüdern, die Sender durchforsten konnte. Am liebsten hörte ich die Kurzwelle. Da kamen fremde Sprachen und neue Klänge aus aller Welt herein. Dabei entdeckte ich, dass ich viel Spaß hatte an Musik unterschiedlichster Art. Im abgelegensten Winkel des großen Gartens meiner Oma hatte ich mir hinter den Stachelbeersträuchern eine Geheimecke ausgesucht, in der ich mich sonntagnachmittags stundenlang aufhielt und am Pegelrad drehte, immer auf der Suche nach einem fremden Klang. Menschliche Stimmen hatten es mir besonders angetan. Die hatten was zu melden, selbst wenn ich es inhaltlich oft nicht verstand.
Einmal war ich erkältet und musste mit hohem Fieber im Bett bleiben, während mein Zwillingsbruder ohne mich zur Schule ging. Im Kinderzimmer hörte ich in unserem großen Radio Marke Saba in der Fieberhitze Aram Khatchaturians ›Säbeltanz‹ aus dem Monolautsprecher. In meiner blühenden Fantasie sah ich die Derwische auf ihren Pferden durch die Puszta wirbeln und mit den Säbeln rasseln. Die Komposition hatte etwas gerührt in mir, das meiner Seele nah war. Was ich spürte, wollte ich immer wieder spüren. Eine Schallplatte musste auf mein heftiges Drängen hin besorgt werden, und von da an nervte ich meine Geschwister mit dem ständigen Abspielen des ungestüm dramatischen Epos auf unserem Phillips-Plattenkoffer, den mein älterer Bruder im Kinderzimmer zum Hören seiner Schlagerplatten benutzte.
Khatchaturians Komposition gefiel mir viel besser als der nachgeäffte Rock‘n‘Roll des Schlagersängers Peter Kraus, den mein Bruder gerne hörte. Gregor hatte schon früh ein Telefunken-Tonbandgerät. Mit diesem TK 17 haben wir bald unsere eigenen Hörspiele inszeniert und mit Geräuschen ausgeschmückt. Alles was sich mit dem Mikrofon aufnehmen ließ, sammelten wir ein, und wir erzählten selbst erfundene Geschichten mit verstellter Stimme. Mein Interesse an Klängen wuchs ständig. Ich wollte bald ein Instrument spielen. Eine Trompete sollte es anfangs sein, weil die so laut war. Dann wollte ich ein Klavier haben, später wiederum eine Gitarre. Aber bei meinen konservativen Eltern fand ich zunächst kein Gehör für derlei Zeitvertreib. Außerdem verdiente mein Vater damals nicht so viel Geld, als dass er mir meine ständig wechselnden Instrumentenwünsche ohne Weiteres hätte erfüllen können.