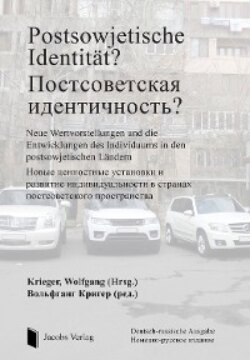Читать книгу Postsowjetische Identität? - Постсоветская идентичность? - Wolfgang Krieger - Страница 10
ОглавлениеDie paradoxe Natur
des postsowjetischen Menschen
als soziologischer Untersuchungsgegenstand
Bakitbek A. Maltabarov
Die Forschung der Soziologie soll zeigen, wie man sich selbst einschätzen sollte – nicht als isolierte Person, sondern als Person im Meer der Menschheit; sie soll uns dabei helfen, uns in der Geschichte und in ihrer Perspektive zu positionieren, um die Faktoren besser verstehen und bewerten zu können, die sowohl unser Verhalten als auch das Verhalten anderer Leute beeinflussen.
C. W. Mills (1916 – 1962) – Amerikanischer Soziologe
Der Begriff des „Menschen“ wird in der Soziologie als eine Einheit von Biologischem und Sozialem verstanden. Er wird deshalb in vielen Theorien und Teildisziplinen der Sozialwissenschaft verwendet, wie etwa in der Soziologie der Persönlichkeit. Der Begriff „Individuum“ wird eher in der Psychologie verwendet, obwohl auch die Soziologie nicht selten darauf zurückgreift, insbesondere wenn Identitäts- oder Interaktionsprobleme in kleinen Gruppen analysiert werden [10, 201].
Die heutige Soziologie arbeitet mit den Begriffen „Mensch“, „Individuum“, „Persönlichkeit“, „Gesellschaft“ und dem Grundgehalt nach ähnlichen, aber unterschiedlich interpretierten Begriffen, die oft als Synonyme betrachtet werden: „Bildung“, „Entwicklung“, „Erziehung“, „Sozialisation“. Wird die Person jedoch nur aus sozialer Sicht betrachtet, ist der Begriff „Persönlichkeit“ am gebräuchlichsten. In den Fällen also, in denen die Person als Subjekt sozialer Beziehungen betrachtet wird, beschäftigt sich mit der Person diejenige Teildisziplin der Soziologie, die als Soziologie der Persönlichkeit bezeichnet wird [9, 321].
Der gegenwärtige Zustand des kollektiven Bewusstseins sowohl in der GUS als auch in Kirgisistan selbst ist dadurch gekennzeichnet, dass dieses nicht nur gespalten, fragmentiert und widersprüchlich, sondern oft auch paradox ist. Im kollektiven Bewusstsein koexistieren weiterhin miteinander unvereinbare Einstellungen und reifen weiter heran. Diese stehen einander konfrontativ gegenüber und beanspruchen oftmals für sich, die einzige sich bietende Rettungsmöglichkeit zur Über-windung der Krise zu sein, in der sich sowohl Kirgisistan als auch die GUS befinden. Sinn einer soziologischen Analyse kann es nicht sein, sich auf diese Debatte einzulassen, sondern Klarheit darüber zu erlangen, dass diese Debatte perspektivlos ist, bis nicht eine Antwort auf eines der grundlegenden Probleme unserer Zeit gefunden ist: Die Frage, warum nämlich nicht nur die Gesellschaft, nicht nur viele soziale Gruppen und Schichten, sondern auch der Mensch selbst als Persönlichkeit bewusstseinsmäßig gespalten ist, stellt ein einzigartig widersprüchliches Phänomen dar, das in vielerlei Hinsicht das gegenwärtige Erscheinungsbild des Landes verkörpert.
Das Paradoxe an der Situation liegt darin, dass dieser Widerspruch gerade in einer Person, in einem bestimmten Individuum konzentriert ist, wenn dieses gleichzeitig sich gegenseitig ausschließenden Überzeugungen vertraut und an deren Wert für sein eigenes und für das gesellschaftliche Leben glaubt. Ein solcher Ansatz ermöglicht es, das Bewusstsein und das Verhalten eines Individuums zu charakterisieren, das sich in der Konfrontation, ja im Kampf mit sich selbst befindet und dies auf die öffentliche Bühne überträgt.
Der Zerfall der UdSSR führte zum Zusammenbruch einer etablierten Lebensweise und zum Überdenken der Einstellungen und Werte von Hunderten von Millionen Menschen. Verschwunden ist nicht nur das riesige Land, das ein Sechstel des Erdoberfläche einnahm, sondern auch die Grundlage der Weltanschauung, auf die sich die Menschen in ihrer Interaktion mit der Gesellschaft, mit staatlichen und industriellen Organisationen, mit ihren Kollegen, Freunden, Nachbarn am jeweiligen Wohnort, kurz mit ihrem gesamten Umfeld verlassen haben. Die Erkenntnis, dass es notwendig war, den Zustand der sowjetischen Gesellschaft zu verändern, war nicht nur für die Perestroika charakteristisch, sondern auch schon davor. Denn gerade die Erwartung von Veränderungen, das Streben nach diesen, waren es doch, welche die gesellschaftlichen Bewegungen hervorriefen, die sich in der zweiten Hälfte der 80er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts deutlich zeigten.
All dies führte zu einem Bewusstseinswandel bei den Menschen, zu einer offensichtlichen oder auch versteckten Abkehr von vielen Werten und Einstellungen, mit denen die Menschen zuvor ihr ganzes Leben lang gelebt hatten. Aber ihre Weltanschauung als Kern ihres Bewusstseins blieb eher konservativ: Sie sammelte und vereinte weiterhin zugleich ein Bekenntnis zur Vergangenheit wie auch eine Zustimmung zur Gegenwart und wiederum Kritik an ihr sowie Verunsicherung hinsichtlich der Zukunft beziehungsweise an den Möglichkeiten zur Verwirklichung von Zielen, Absichten und Interessen.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist der ethnische, nationale Faktor einer der bestimmenden im modernen Leben der gesamten Menschheit. Der ethnische Faktor manifestiert sich immer stärker in der Aktivierung von Forderungen nach nationalstaatlicher Souveränität, die nach Ansicht vieler nationaler Führungspersönlich-keiten die Bestrebungen und Erwartungen vieler Nationen und Völker widerspiegeln. Auf den ersten Blick klingt das recht plausibel. Seit mehr als 30 Jahren kommt es in Nordirland zu Auseinandersetzungen auf ethno-konfessioneller Basis und Großbritannien ist es bis zum heutigen Tag nicht gelungen, eine zufriedenstellende Lösung für diese Konflikte zu finden. Gleichzeitig erhielt Schottland in diesem Land durch die Bemühungen der nationalistischen Kräfte sein Parlament und das gleiche Problem ist in Wales noch immer aktuell. In Spanien behaupten sich seit Jahren nationale Minderheiten – Basken und ein Teil der Katalanen. Erstere fordern die Schaffung eines unabhängigen Staates auf Teilen des spanischen und französischen Hoheitsgebiets, letztere eine größere Unabhängigkeit von der Zentral-regierung. Unruhig ist es auch in Rumänien und in Transsilvanien, wo Autonomie weniger von Ungarn gefordert wird (deren Anzahl auf diesem Gebiet recht hoch ist), sondern von den dort lebenden Rumänen, die glauben, dass ihre Zugehörigkeit zum Habsburger-Reich bis zum Jahr 1918 sie grundlegend von der Bevölkerung Moldawiens und der Walachei unterscheide. In Sri Lanka, wo Tamilen um die Unabhängigkeit gegen die sri-lankische Regierung kämpfen, dauert der blutige Konflikt bereits seit einem Vierteljahrhundert an. Wie eine offene Wunde ist für die Kurden ihr Kampf für die Unabhängigkeit (das 37 Millionen Menschen umfassende Volk verteilt sich auf mehrere Staaten – Türkei, Iran, Syrien, Irak). Der Konflikt zwischen den beiden Atommächten Indien und Pakistan hat die Aufmerksamkeit der gesamten Weltgemeinschaft und sämtlicher Weltmächte erregt.
Es gibt auch einige als exzentrisch zu bezeichnende Ereignisse in diesem nationalen und separatistischen Prozess, wie zum Beispiel den Wunsch einiger Nationalisten in der Provinz Quebec (Kanada) in Neukaledonien (dem Protektorat Frankreichs), die Unabhängigkeit zu erlangen [8, 423].
Auch im Staat Texas (USA) ist es unruhig. Der Präsident der nationalistischen Bewegung von Texas, Daniel Miller, sagt, die Unabhängigkeit von Texas sei der einzige Weg, Texanern zu ermöglichen, auf texanische Art und Weise ihre Probleme zu lösen, trennte sich doch Texas im Jahr 1936 von Mexiko und war ganze neun Jahre eine unabhängige Republik, bis es sich als deren 28. Staat den USA anschloss [6, 18].
Insgesamt wurden allein im Jahr 1998 etwa 50 politische Großereignisse mit ethnischem Hintergrund verzeichnet, was sowohl das Schicksal einzelner Nationen und Staaten oder einzelner ihrer Regionen als auch das der Welt insgesamt stark beeinflusst. Die Tatsache, dass der ethnische Faktor eine wichtige Rolle bei der Lösung der Probleme des staatlichen Systems spielt, wird durch den Zusammenbruch der UdSSR, Jugoslawiens und der Tschechoslowakei belegt. Es gibt mehrere Gründe für ihr Verschwinden von der politischen Weltkarte. Die einen sprechen von der unvermeidlichen Auflösung von Imperien, andere von den Fehlern der politischen Führung dieser Länder, die Dritten von einer Welle des Nationalismus als neues Phänomen des gesellschaftlichen Lebens, dem man sich nicht entgegenstellen kann.
Bei dieser Analyse des Anstiegs ethnisch-nationaler Spannungen ist eine wachsende Zahl von Soziolog*innen geneigt, eine ernsthafte, gründliche und umfassende Bewertung nicht nur des ethnischen Faktors im Allgemeinen, sondern auch der nationalen Identität für unumgänglich zu halten. In diesem Zusammenhang ist es angebracht, sich an die Überzeugung von L.N. Gumiljow zu erinnern, wonach es „im menschlichen Leben nichts Unbeständigeres gibt als die soziale Lage und die sozialen Beziehungen“, der Mensch aber gleichzeitig „seine ethnische Zugehörigkeit nicht ändern kann und würde er noch so viele Anstrengungen unternehmen und wäre sein Wunsch danach noch so groß“. Seiner Ansicht nach ist nichts einflussreicher als das, was letztlich das Bewusstsein und das Verhalten des Menschen bestimmt, nämlich das „ethnische Element der Menschheit“, das die Tendenz hat, sich zu aktualisieren, sich neu zu positionieren und letztlich die Richtung zu bestimmen, in die sich die Menschheit entwickelt [2, 9-10].
Der postsowjetische Raum ist ein einzigartiges Feld, das die epochalen Veränderungen nach dem Zusammenbruch eines großen Landes zeigt. Derzeit ist auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion objektiv gesehen ein Prozess der Materialisierung von nationaler Eigenart, Nationalwürde und Nationalkultur im Gange. Viele Nationen und Völker wurden sozusagen wiedergeboren und richteten sich nach ihrer Kultur, ihrer Sprache, nach den Bräuchen und Traditionen ihrer Vorfahren aus. Die spezifisch nationalen Formen der Bewirtschaftung haben an Bedeutung gewonnen. Doch der Wunsch der Menschen nach nationaler Identität war nicht immer mit dem bestehenden Wunsch vereinbar, mit anderen zusammenzuleben und mit diesen in Frieden zu leben, da sich nationalistisch gesinnte Politiker machtvoll in diesen Prozess einmischten und im Kampf um die Macht die geistigen Werte durch ehrgeizige Aussagen und Erklärungen über allerlei Arten von „Souveränität, „Unabhängigkeit“ und „Selbstständigkeit“ zu ersetzen suchten.
Im Verhalten der politischen Führer, die den Aufbau des Wohlergehens ihrer Nation (und in den meisten Fällen ihres persönlichen Wohls) zum Nachteil der Würde und des Wohlbefindens anderer Völker zu ihrem Credo erklärt haben, manifestiert sich das Gebaren nationaler Marodeure. Was sind die Erklärungen des georgischen Präsidenten in den frühen 1990er Jahren, Herrn Gamsachurdias, der offen den Slogan „Georgien den Georgiern!“ proklamierte, oder seines Kollegen, des ersten Präsidenten von Aserbaidschan Elchibey, der in jenen Jahren die gleiche Politik verfolgte, nur unter dem Slogan „Russen – nach Rjasan, Tataren – nach Kasan!“. Ähnliches, wenn auch in dezenter Form, ereignete sich auch in anderen Republiken und nationalen Regionen [8].
Nationalistische Ideen faszinierten einen Teil der Bevölkerung, wenn auch keinen so großen, wie deren Schöpfer dies gerne gesehen hätten. Was gelten die emotionalen Äußerungen des LDPR-Führers W. Schirinowski, Zentralasien müsse eine Kolonie Russlands werden und der russische Soldat müsse seine Stiefel im Indischen Ozean waschen, man solle sich mit der Ukraine schon befassen, Kasach-stan solle als nächstes in den Blick genommen werden und was dergleichen mehr ist?
Soziologische Studien russischer wie kirgisischer Soziolog*innen zeigen, dass Menschen unterschiedlicher Nationalitäten im täglichen Umgang, bei der Arbeit und zu Hause trotz der klischeehaften Äußerungen von Führern nationaler politischer Parteien und Bewegungen ein hohes Maß an Vertrauen und Toleranz beweisen. Die Menschen sehen die Grundlage für das Zusammenleben in Spiritualität, in Kultur und in der Entwicklung ihrer Identität und nicht in einem offenen oder geheimen politischen Kampf, der nur ehrgeizigen Politikern oder irgendwelchen ambitionierten Populisten, Präsidenten oder anderen Führern Dividenden einbringen wird.
Die nationalistischen Stimmungen sind auch insofern gefährlich, als ihre Träger ihre wahren Ziele und Absichten sorgfältig verbergen. In den Fokus der Öffentlichkeit werden demagogische Diskussionen über die Landessprache, über die „zerstörte“ Nationalkultur gestellt, was geeignet ist, einen Teil der Bevölkerung für einige Zeit zu desorientieren. Diese nationalistische Stimmung wird auch nicht zuletzt durch einige para- und anti-wissenschaftliche Konzepte und Ansichten gefördert, die im 20. Jahrhundert enorme Verbreitung gefunden haben.
Zu ihrer „wissenschaftlichen“ Begründung werden die unterschiedlichsten Ideen herangezogen. So wird etwa die Position von Carl Gustav Jung als primordialistisches Konzept von Ethnizität interpretiert, dem zufolge ethnische (und damit kulturelle) Identität nicht konstruiert, sondern vererbt wird. Dieser Ansatz gibt Anlass, über die Exklusivität des nationalen „Ich“ zu sprechen, dient als Grundlage für die Konfrontation mit anderen Völkern, erzeugt ethnische Spannungen und sogar Nationalitätenkonflikte [8, 422].
Es gibt gravierende Zweifel und Einwände gegenüber dem Konzept von W.A. Tischkow, welches die Künstlichkeit und Unwissenschaftlichkeit des Begriffes „Nation“ sowie die Notwendigkeit, den westlichen Standard des „Nationalstaates“ anzuerkennen, unter Beweis stellt. [7] Es fällt schwer, dieser Aussage zuzustimmen: Erstens, weil man von den Realitäten ausgehen muss, die sich entwickelt haben, und aus jener realen Erfahrung, die nicht nur in westlichen Ländern vorhanden ist. Anders ausgedrückt: Das Denken sollte auf dem Leben basieren, nicht auf Fantasien und Wünschen, und seien sie noch so attraktiv. Daher ist es schwierig, die Vorstellung der Nation als „imaginäre Gemeinschaft“ zu teilen.
Zweitens: Wie gut die amerikanischen, französischen und spanischen Methoden zur Lösung nationaler Probleme auch immer sein mögen, sie spiegeln doch stets nur ihre je eigene Spezifik und ihre Verfahren zur Beeinflussung schwieriger nationaler Wechselbeziehungen wider. Fremde Erfahrung einfach „mechanisch“ zu nutzen, ist, wovon sich nicht nur Politiker*innen bei der Analyse unterschiedlichster Anleihen überzeugen konnten, eine äußerst umstrittene, wenn nicht gar gefährliche Strategie. Drittens sollte nicht den politischen Doktrinen der UdSSR, in der, wie auch der Autor zugestehen muss, viel zugunsten nationaler Minderheiten getan wurde, die Schuld an nationalen Zusammenstößen zugesprochen werden. Denn es gab in anderen Ländern keine solchen Doktrinen, doch Auseinandersetzungen (und zwar sehr akute) um nationale Interessen waren und bleiben dort Realität.
Der nationalistische Rausch vergeht sogar bei jenen Menschen, die sich zeitweise auf kurzsichtige, aber gefährliche Versprechungen der politischen Handlungsträger einließen. Es ist nicht nur unzutreffend, sondern auch absurd, die Völker als affiziert vom Geschwür des Nationalismus und Chauvinismus darzustellen. Es ist notwendig, die Spreu vom Weizen zu trennen und einzusehen, dass der Mythos von einem universellen nationalen Rausch oft nur der Vertuschung ehrgeiziger Ziele im Kampf um die Macht dient.
Natürlich bedarf die nationale Identität jeder Nation einer gründlichen und eingehenden Analyse. Gleichzeitig kann kein Zweifel daran bestehen, dass sich etwa die Besonderheiten bei der Manifestation des nationalen „Ichs“ in den baltischen Ländern erheblich von ähnlichen Bewegungen in Zentralasien und diese wiederum von der Situation im Kaukasus unterscheiden. Jedoch ist die Anhänglichkeit an nationale Werte zweifellos der wichtigste Bestandteil der nationalen Identität der meisten Nationen, die innerhalb der Grenzen der ehemaligen UdSSR leben. Die „Realitäten von Nationen“ behaupten sich als existentiell notwendig, da eine individuelle soziale Identität ohne eine nationale Identität unmöglich ist.
Bis zu einem gewissen Grad sind nationale Widersprüche auf die Tatsache zurückzuführen, dass zentripetale Tendenzen gegenüber zentrifugalen vorherrschen und, was paradox ist, eher zu Letzteren beitragen als diese einzudämmen. Anführer ethnischer Schichten und Gruppen sind mit der bestehenden „nationalen Rangordnung“, die ihrer Meinung nach ein Hindernis für das normale Funktionieren ihrer Völker war, nicht mehr zufrieden. Ihre Haltung wird durch einen entsprechenden Komplex an ideologischen Argumenten, Erklärungs- und Rechtfertigungsmechanismen sowie propagandistischen Maßnahmen zur Beseitigung der bestehenden Ungleichheit zwischen den Nationen und zur Überzeugung der Menschen von der Legitimität ihrer nationalen Ansprüche untermauert. Diese nationalen Ansprüche kommen oft im Gewande von Nationalismus, Chauvinismus und Rassismus daher, obwohl es unter den heutigen Bedingungen womöglich gar keine klaren Anzeichen für Unterdrückung oder Gewalt gibt. Natürlich ist den nationalen Beziehungen aufgrund der Interessensunterschiede verschiedener Völker eine ganze Palette an Widersprüchen eigen [1]. Und diese Widersprüche entstehen nicht nur auf der Ebene von Nationalstaaten, nationalen Gemeinschaften und ethnischen Gruppen (d. h. auf der Makroebene), sondern auch auf der zwischenmenschlichen Ebene und auf der Ebene kleiner Gruppen (d. h. auf der Mikroebene). Einige von ihnen wirken ständig, andere sind situativ, die einen sind konstruktiv, andere destruktiv.
Eine Analyse der mehrdeutigen, widersprüchlichen Prozesse im Bereich der internationalen und interethnischen Beziehungen ermöglicht es uns, einige Formen von Paradoxien der nationalen Identität zu identifizieren, die die spezifischen Merkmale von deren Funktionieren im postsowjetischen Raum am besten charakterisieren. In gewissem Maße manifestieren sich diese Formen des Paradoxons in fast allen Arten ethnischer Interaktion.
Eine Analyse der Paradoxien des nationalen Selbstbewusstseins erlaubt zwei weitere Schlussfolgerungen, wie der Soziologe Zh. T. Toshchenko betont [8, 423].
Erstens werden diese Paradoxien weitgehend von solchen Ideen gestützt (die sich leider auch auf theoretischer Ebene entwickelt haben), wenn die Interessen der Nation und nicht die Interessen der Person als zentrale Bezugspunkte für die Entwicklung eines Volkes herangezogen werden. Bei aller scheinbarer Attraktivität ist eine solche Position mit tragischen Konsequenzen behaftet: Sie führt zu nichts anderem als Hass, Blutvergießen und auf viele Jahre hinaus vergiftetem Denken, was insbesondere in Berg-Karabach, Tadschikistan, Transnistrien, Georgien und an anderen Brennpunkten deutlich wurde.
Zweitens verschärft sich das tragische Moment an dem Paradoxon, wenn eine scheinbar sinnvolle Haltung – die Interessen der Nation über alles zu stellen – zur Staatspolitik wird. Bei einer solchen Haltung kehrt sich die Priorität der Interessen einer Nation schließlich dahingehend um, dass eine andere Nation, ein anderer Staat die „Rechnung“ präsentiert bekommt, was nicht nur zur Unterbrechung von Wirtschaftsbeziehungen und zu einer Verschlechterung der diplomatischen Beziehungen führt, sondern auch zur Verbreitung nationalistischer Denkweisen, zur Beleidigung der nationalen Identität anderer Völker und zur Wiederbelebung und Kultivierung von Chauvinismus und Rassismus.
Genau dieses „Hybrid“ an Verschiebungen im öffentlichen Bewusstsein und deren Manifestation in bestimmten Situationen ist es auch, das es ermöglicht, von einer paradoxen Natur von Bewusstsein und Verhalten zu sprechen. Man sollte besonders betonen, dass die Paradoxie des Bewusstseins und des Verhaltens vielfältig ist und viele Gesichter hat. In der Soziologie wurde dieses Hybrid als das neue Konzept vom paradoxen Menschen eingeführt.
Der paradoxe Mensch als Phänomen des Zeitalters taucht in einem völlig widersprüchlichen Gewand vor uns auf, stellt der Soziologe Zh. T. Toshchenko fest, da die Gründe, die zu Paradoxen führen, nicht eindeutig sind und nicht einer einzigen Ordnung angehören. Dennoch kann man mit voller Überzeugung behaupten, dass es gerade der paradoxe Mensch ist, der das moderne Zeitalter verkörpert, er ist ein mächtiger destabilisierender Faktor. Die Gefahr dieses Phänomens besteht auch darin, dass der paradoxe Mensch ein sehr willkommenes Objekt für die Manipulation des öffentlichen Bewusstseins [8, 424] darstellt.
Die verfügbaren Informationen legen nahe, dass der paradoxe Mensch ein unausbleibliches Merkmal der Übergangszeit ist. Er kann nicht beseitigt oder ignoriert werden. Es ist notwendig, ihn zu erkennen und dieses Wissen zu nutzen, um brennende Fragen der Entwicklung Kirgisistans im gegenwärtigen Stadium zu beantworten. Eine Analyse der verfügbaren Daten, einschließlich soziologischer Daten, ermöglicht es uns, verschiedene Arten von paradoxem Bewusstsein und Verhalten von Menschen detailliert zu beschreiben.
Paradoxa zeigen sich deutlicher im historischen Gedächtnis und im Bereich der Moral sowie der Religion. Zu den Paradoxen des religiösen Bewusstseins gehört ein massenhaftes Zurschaustellung des Glaubens an Gott, vor allem bei jener Kategorie von politischen Anführern und Geschäftsleuten, die seinerzeit die kommunistische Parteischule abgeschlossen hatten, in den Reihen der KPdSU waren und sich für Atheisten hielten, und nun mit allem Anschein von Ernsthaftigkeit versuchen, sich der Wählerschaft als Gläubige zu präsentieren.
Laut der Staatlichen Kommission für Religionsangelegenheiten bei der Regierung der Kirgisischen Republik wurden im Jahr 2017 3.233 religiöse Verbände und Organisationen registriert, darunter 2.822 dem Islam, 397 dem Christentum, 1 dem Judentum, 1 dem Buddhismus zugehörige sowie 12 Vertreter neuer religiöser Strömungen und Glaubensrichtungen [3].
Nach Angaben des Nationalen Statistischen Komitees wurde im Januar 2018 eine religiöse Identifizierung auf der Grundlage der ethnischen Zugehörigkeit vorgenommen, wonach etwa 93% der Bevölkerung der Republik traditionelle Anhänger der sunnitischen Ausrichtung des Islams sind: Kirgisen – 73,3% der Bevölkerung; Usbeken – etwa 14,7% der Gesamtbevölkerung und mehr als 5% waren Uiguren, Dunganen, Kasachen, Tataren, Tadschiken, Baschkiren, Türken, Tschetschenen, Darginen usw. 5,9% der Bevölkerung in Kirgisistan waren (russisch) orthodoxe Christen, hauptsächlich Russen, Ukrainer und Belarussen. Mehr als 1,1% der Bevölkerung des Landes sind Vertreter neuer religiöser Bewegungen [5, 54].
Unter der Leitung von Prof. K. Isajew wurde mit Unterstützung des Amtes des Präsidenten der Kirgisischen Republik an der Kirgisisch-Türkischen Universität „Manas“ und mit finanzieller Unterstützung dieser Universität eine soziologische Studie durchgeführt, an der eine landesweite Stichprobe aus der Bevölkerung der Republik mit insgesamt 2.000 Befragten teilnahm. Im Rahmen der soziologischen Umfrage ermittelten wir die Einstellung der Befragten zur Religion und stellten dabei insbesondere die folgende Leitfrage: „Glauben Sie an Gott?“ So zeigen die Ergebnisse der Umfrage, dass 95,2% der Befragten an Gott bzw. Allah glauben. Und 0,7% der Befragten antworteten, dass sie nicht an Gott bzw. Allah oder eine andere Gottheit glauben. 3,6% der Befragten schwankten zwischen Glauben und Unglauben und 0,5% der Befragten taten sich schwer mit einer Antwort (siehe Tabelle 1).
Tabelle 1. Glauben Sie an Gott?
| Nr. | Antwortmöglichkeiten | In Prozent |
| 1. | Ja | 95,2 |
| 2. | Ich schwanke zwischen Glauben und Unglauben. | 3,6 |
| 3. | Nein | 0,7 |
| 4. | Ich tue mir schwer mit einer Antwort. | 0,5 |
| 5. | Insgesamt | 100 |
Nachdem wir die Beziehung der Befragten zu Gott erhellt hatten, wollten wir herausfinden, warum die Befragten diese Religion für die ihre halten. Dazu stellten wir die Frage: „Welche Religion betrachten Sie als die Ihre?“ Die Umfrageergebnisse zeigen, dass 90,4% der Befragten den Islam als ihre Religion ansehen und 9% der Befragten das Christentum, während nur 0,7% der Befragten, was der Meinung von 12 Personen entspricht, andere Religionsrichtungen angeben, die zu neuen religiösen Organisationen gehören. Jeder Befragte identifizierte persönlich seine Religionszugehörigkeit und bestimmte für sich selbst, welche Religion er als die seine betrachtet (siehe Abbildung 1).
Abbildung 1. Welche Religion betrachten Sie als die Ihre?
Anderes
Christentum
Islam
Bildung und Sozialisierung einer Person werden in erster Linie von der Familie beeinflusst, d. h. von der Einstellung der Eltern zur Religion, die sich im Wesentlichen auf das religiöse Bewusstsein der Familienmitglieder auswirkt sowie auf die Herausbildung der Religiosität in der Gesellschaft, die wiederum als soziale Norm angesehen wird, als erworbener Status eines Menschen. Im Rahmen der soziologischen Studie stellten wir den Respondenten die folgende Frage, um dieses Phänomen zu identifizieren: „Warum betrachten Sie diese Religion als die Ihre?“
Wie Tabelle 2 zeigt, hat mehr als die Hälfte (55,4%) der Befragten geantwortet, ihre Eltern hätten sich zur jeweiligen Religion bekannt und sie seien im Geiste dieser Religion erzogen worden. Die Familie als soziale Institution gilt als die Grundlage für die Sozialisation des Einzelnen von der Geburt bis zur Herausbildung seiner Persönlichkeit.
Jeder vierte Befragte (24%) gab an, seine ethnischen Wurzeln würden zu dieser Religion führen. Dass sie selbst durch das Lesen religiöser Bücher zu dieser Religion gekommen seien, gaben 8,2% der Befragten an. 7,3% der Befragten gaben an, sich nicht mit der Frage auseinandergesetzt zu haben, und 2,5% der Befragten wählten die Antwortmöglichkeit „Anderes“. 2,6% der Befragten taten sich schwer mit einer Antwort (siehe Tabelle 2).
Tabelle 2: Warum betrachten Sie diese Religion als die Ihre?
| Nr | Antwortmöglichkeiten | In Prozent |
| 1. | Meine Eltern bekennen sich zu dieser Religion und ich bin auch zu dieser erzogen worden. | 55,4 |
| 2. | Meine ethnischen Wurzeln führen zu dieser Religion. | 24,0 |
| 3. | Ich kam selbst durch das Lesen religiöser Bücher zu dieser Religion. | 8,2 |
| 4. | Ich habe mich mit der Frage nicht auseinandergesetzt. | 7,3 |
| 5. | Anderes | 2,5 |
| 6. | Ich tue mir schwer mit einer Antwort. | 2,6 |
| 7. | Insgesamt | 100 |
Um zu ermitteln, wie häufig die Befragten Moscheen, Kirchen, Gebetshäuser oder andere religiöse Orte besuchen, haben wir die folgende Frage gestellt: „Wie oft besuchen Sie religiöse Orte?“ Die Antworten auf diese Frage sehen folgendermaßen aus: 4,9% der Befragten besuchen täglich religiöse Orte. Fast jede vierte Person (24%) besucht jede Woche Moscheen, Kirchen, ein Gebetshaus oder andere religiöse Orte, und einmal im Monat besuchen 11,8% der Befragten ihrem Glauben zugehörige religiöse Orte. 9,6% der Befragten besuchen Moscheen, Kirchen, ein Gebetshaus oder andere religiöse Orte einmal im Halbjahr und 12,4% der Befragten tun dies einmal im Jahr. 32,7% der Befragten besuchen keine Moscheen, Kirchen, Gebetshäuser oder andere religiöse Orte.
Wie aus der folgenden Abbildung zu ersehen ist, belegen die höchste Position diejenigen, die einmal pro Woche religiöse Stätten aufsuchen. Diese Befragten sind Moslems, die jede Woche zum Freitagsgebet die Moschee besuchen (siehe Abbildung 2).
Abbildung 2: Wie oft besuchen Sie religiöse Orte?
Gar nicht
Einmal jährlich
Einmal halbjährlich
Einmal monatlich
Einmal wöchentlich
Täglich
Um Probleme in Bezug auf Religion zu identifizieren, haben wir den Befragten eine offene Frage gestellt, damit sie die Probleme erläutern konnten, die sie im Bereich der Religion stören. Da die Frage offen war, konnten die Befragten mehrere Varianten ihrer Antwort niederschreiben, sodass die Summe aller Antworten 157,2% betrug.
Wenn wir uns mit den Ergebnissen der Umfrage vertraut machen, so sehen wir, dass an erster Stelle die Befragten (57,1%) mit der Antwort stehen, sie seien über die Intensivierung der Aktivitäten verschiedener Sekten und deren zunehmenden Einfluss sowie destruktive religiöse Tendenzen besorgt. Etwa die Hälfte der Befragten (48,3%) ist sehr besorgt über das Problem des religiösen Extremismus. 19,8% der Befragten bereitet die schwache Arbeit von Führungskräften religiöser Organisationen Sorgen. 7,7% der Befragten stört das Problem, dass Religion politisiert wird, d. h. sie glauben, dass sie der Einfluss der Religion auf die politische Elite stark beunruhigt. Z. B. sind bei Beginn groß angelegter politischer Kampagnen einige politische Führer nicht abgeneigt, sich der Religion zu bedienen, um eigennützige Ziele in der Politik zu erreichen. 0,9% der Befragten wählte die Antwortoption „Anderes“ und jeder 33. Befragte tat sich schwer mit einer Antwort fand es schwierig (siehe Tabelle 3).
Tabelle 3: Welche Probleme stören Sie am meisten an der Religion?
| Nr. | Antwortmöglichkeiten | Antworten in % |
| 1 | Intensivierung der Aktivitäten verschiedener Sekten und deren zunehmender Einfluss | 57,1% |
| 2 | Religiöser Extremismus | 48,3% |
| 3 | Zunehmende Religiosität unter der jungen Generation | 20,4% |
| 4 | Schwache Arbeit von Führungskräften religiöser Organisationen | 19,8% |
| 5 | Einfluss der Religion auf die politische Elite | 7,7% |
| 6 | Anderes | 0,9% |
| 7 | Tue mir schwer mit einer Antwort. | 3,0% |
| 8. | Insgesamt | 157,2% |
Damit erschöpft sich noch nicht die Vielfalt der Aspekte im religiösen Bewusstsein und Verhalten der Menschen. In der soziologischen Literatur werden ihre Stile, Formen und Erscheinungsformen ebenso untersucht wie ihre Marginalität, Isolation, Assimilation etc., die wiederum neue Facetten der paradoxen Natur der Persönlichkeit aufzeigen. Zu den Paradoxen gehört auch die Tatsache, dass durch die religiöse Wiedergeburt nicht Beziehungen von Brüderlichkeit, Liebe und Humanität triumphieren, sondern im Gegenteil die schnelle moralische und psychologische Verrohung und die Auflösung des sozialen Gefüges auf der Ebene des Alltags, wie der russische Religionswissenschaftler L. N. Mitrokhin zu Recht betont [8, 215].
Die Analyse des gegenwertigen Zustandes des religiösen wie kollektiven Bewusstseins und Verhaltens ermöglicht es, von einer Vielfalt paradoxer Persönlich-keitstypen zu sprechen.
Die Übergangszeit hat diese Ambivalenz aufgedeckt, ein genaueres Bild von dem gezeichnet, was wir jetzt sind. Und gerade diese Offenheit und das Verständnis der Situation macht Hoffnung, dass eine korrekte Beurteilung der kirgisischen Gesellschaft auch die Möglichkeit bietet, im 21. Jahrhundert die sozialen Missstände in Kirgisistan zu überwinden.
Die Persönlichkeit wirkt als Produkt historischer Entwicklung, als Ergebnis des aktiven Handels und der Kommunikation. Die Persönlichkeitsmerkmale hängen immer von sozioökonomischen, sozio-kulturellen und subjektiven Verhaltens-merkmalen, der Art des Menschen und der gegenwärtigen Lebensqualität ab. Eine Persönlichkeit fungiert nicht nur als Objekt, sondern auch als Subjekt sozialer Beziehungen in der modernen Informationsgesellschaft. Sie ist geprägt von Auto-nomie, verfügt über die Fähigkeit, sich der Gesellschaft zu widersetzen und neue öffentlich notwendige Funktionen und Verhaltensmuster herauszubilden. Persönliche Unabhängigkeit und schöpferische Tätigkeit setzen dabei jedoch nicht nur Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur Reflexion voraus – Selbstanalyse, Selbsteinschätzung, Selbstkontrolle –, sondern auch deren Abstimmung mit den objekti-ven Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens von Kirgisistan.
So führten die auf nationalistischer Grundlage entstandenen Widersprüche zu den blutigsten Auseinandersetzungen am Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts, säten Feindseligkeit und Misstrauen, erschwerten ungeheuer das Leben vieler Länder und Regionen der Welt. Die Krisengebiete, die in der Welt entstanden sind, sind dies größtenteils durch Versuche, nationalistische Ambitionen zu verwirklichen, die oft weder mit der Realität selbst abgestimmt wurden noch mit dem Bemühen darum, diese Realität auf wirksame und rationale Weise zu verändern. Daher existierte das Paradox des ethnischen Bewusstseins nicht nur in der Vergangenheit, sondern es existiert weiterhin, sowohl in Kirgisistan als auch in der GUS insgesamt in der heutigen Phase ihrer Entwicklung.
Literaturverzeichnis
1. Abdulatinov, R.G.: Priroda i paradoky nazionalnogo. „Ja“. – M., 1991. Абдулатипов Р.Г. Природа и парадоксы национального “Я”. – М., 1991.
2. Gumilev, L.N./Emrmolaev, V.Ju: Gore ot illusij. Alma-Mater, 1992. No79. – S.9-10. Гумилев Л.Н. Ермолаев В.Ю. Горе от иллюзий // Алма-матер. 1992. – C. 9-10.
3. Ikh arkhiva osudarstvenoj komissii po delam religij pri Pravitelnstve KR am 1.3.2018. Их архива государственной комиссии по делам религий при Правительстве КР от 1.03.2018 г.
4. Mitrokhin, L.N.: Religia i kultura. M. 2006, 364 S. Митрохин Л.Н. Религия и культура. - М., 2006. – 364 с.
5. Nazionalnij sostav naselenia 2013-2017 statisticheskij ekhegodnik Kirgiskoj Respuliki. Nazionalnij statisticheskij komitet Kirgiskoj Respuliki. Bischkek, 2018, S. 54. Национальный состав населения. 2013-2017 статистический ежегодник Кыргызской Республики. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.– Бишкек, 2018. – С. 54.
6. Rasedinenie shati Ameriki. Grosit li superdershave sudba SSSR? // MK – Kirgisistan. No 17 (397) – 13-19 Mai 2009, S. 18. Разъединеные штаты Америки. Грозит ли супердержаве судьба СССР? // МК – Кыргызстан. No17 (397). – 13-19 мая 2009 г. – С. 18.
7. Tishkov, V.A.: Hazia – eto metafora. Drushbi narodov. 2000. – No 7. Тишков В.А. Нация – это метафора // Дружбы народов. 2000. – No7.
8. Toshenko, Sh.T.: Paradoksalnij chelovek: monograhia. 2. Isd. Pererab. i. dop. – M.: Juniti-Dana, 2008. 543 S. Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек: монография – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 543 с.
9. Toshenko, Sh. T.: Soziologia lichnosti. V kn. Soziologia. M.: Juniti-Dana, 2005, - 640 S. Тощенко Ж.Т. Социология личности. В кн. Социология. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 - 640 с.
10. Filatova, O.G.: Obshaia sociologia. M.: Gardariki, 2005. – 464 S. Филатова О.Г. Общая социология. - М.: Гардарики, 2005. – 464 с.