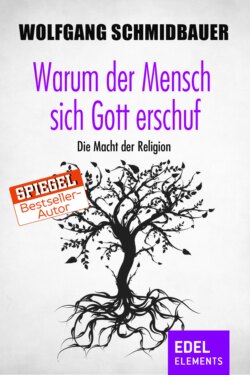Читать книгу Warum der Mensch sich Gott erschuf - Wolfgang Schmidbauer - Страница 7
3. Freuds Religionskritik vor dem Hintergrund seiner Biografie
ОглавлениеIn Freuds Persönlichkeit sind viele Widersprüche und Brücken angelegt, die ihn auf die Rolle des Entdeckers der analytischen Psychotherapie vorbereitet haben. Er war ein Aufsteiger in die akademische Welt; er hatte viele soziale Schritte als Erster seiner Familie zu bewältigen. Er war Kind in einer Familie, die große Spannungen überbrücken musste: Erstgeborener der zweiten Ehe seines Vaters, Sohn einer sehr jungen Mutter, ein nachgeborener Bruder starb früh, die Familie zog mehrmals um.
Freud ist der Gründer und damit in gewisser Weise auch das Symbol einer neuen Profession. Ihn besser zu verstehen heißt, die Geschichte dieses Berufs besser zu verstehen und damit auch die Identität einer neuen Gruppe von Helfern, die man als »Beziehungshelfer« den traditionellen, normativen Helfern vom Typus Priester, Lehrer, Arzt gegenüberstellen kann.4
Der Arzt handelt »objektiv«, er versachlicht den Patienten und vollstreckt an ihm die (Natur-)Gesetze der Heilung. Der Psychotherapeut hingegen orientiert sich subjektiv; er wirkt umso mehr, je persönlicher, individueller und kreativer er die emotionale Beziehung zum Kranken gestalten kann.
Folgerichtig erlernen Ärzte ihr Handwerk technisch in Sezierkursen, Schamanen und Psychoanalytiker in der Heilung einer eigenen Krankheit, in der Identifizierung mit einem Heiler, der ihr Vorbild ist. Er hat seine Krankheit vor ihnen bewältigt und kann ihnen nun zeigen, welchen Weg sie einschlagen müssen, um ihre eigene Krankheit zu bewältigen.
Freuds Vater war zwar selbst thorakundig und des Hebräischen mächtig, ließ aber seinen Sohn »in voller Unwissenheit über alles, was das Judentum betrifft, aufwachsen«.5 Freuds Vater dachte, das Beste für seinen Sohn zu tun, indem er ihn aufforderte, sich zu assimilieren. Freud glaubte die meiste Zeit seines Lebens daran, es sei möglich, eine neue, aufgeklärte Kultur zu schaffen, in der ungläubige Juden und ungläubige Christen sich gemeinsam von aller frommen Verdummung abwenden.
In seiner »Selbstdarstellung« von 1925 schreibt Freud:
»Als Kind von vier Jahren kam ich nach Wien, wo ich alle Schulen durchmachte. Auf dem Gymnasium war ich durch sieben Jahre Primus, hatte eine bevorzugte Stellung, wurde kaum je geprüft. Obwohl wir in sehr beengten Verhältnissen lebten, verlangte mein Vater, daß ich in der Berufswahl nur meinen Neigungen folgen sollte. Eine besondere Vorliebe für die Stellung und Tätigkeit des Arztes habe ich in jenen Jugendjahren nicht verspürt, übrigens auch später nicht. Eher bewegte mich eine Art von Wißbegierde, die sich aber mehr auf menschliche Verhältnisse als auf natürliche Objekte bezog und auch den Wert der Beobachtung als eines Hauptmittels zu ihrer Befriedigung nicht erkannt hatte. Indes, die damals aktuelle Lehre Darwins zog mich mächtig an, weil sie eine außerordentliche Förderung des Weltverständnisses versprach, und ich weiß, daß der Vortrag von Goethes schönem Aufsatz ›Die Natur‹ in einer populären Vorlesung kurz vor der Reifeprüfung die Entscheidung gab, daß ich Medizin inskribierte.«6
Der junge Freud entwarf sich zunächst militärische Gestalten als Vorbild, etwa den Feldherrn der Karthager, Hasdrubal7, der seinen Sohn Hannibal in einem Heiligtum schwören ließ, Rache an den Römern zu nehmen. Ein genialer semitischer Feldherr, der übermächtige Feinde in vernichtenden Schlachten besiegt, war einer der imaginären Väter Freuds. Die Phantasie, ein von der römischen Kirche »besetztes« Land erobern zu können, lag im Wien nach 1867 in der Luft. Endlich hatten Juden zumindest auf dem Papier die gleichen Möglichkeiten wie Christen.
Freud hat sich immer zu einer liberalen politischen Haltung bekannt; konservativ-nationalistische Strömungen kamen für ihn so wenig in Frage wie Sozialismus. Die Grundlage zu dieser Entwicklung wurde in seiner Kindheit gelegt. Für einen Juden war der Liberalismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die große Hoffnung, in einem nationalen, aber nicht klerikalen oder rassistischen Bürgertum eine neue Heimat zu finden, Schutz vor Diskriminierung und Pogrom. Überall kämpften Juden an der Seite liberaler Revolutionäre, in Frankreich, Deutschland, Ungarn und Russland. Zionismus und Sozialismus entfalteten erst später politischen Einfluss. Sie reagierten auf das geschwächte Projekt des Liberalismus.
Freuds Jugend in Wien war von einer Epoche bestimmt, in der die Utopie einer friedlichen, von Wissenschaft und Bildung getragenen, liberalen und multikulturellen Gesellschaft zum Greifen nahe schien. Seit 1848 hatte sich die Lage der Juden in der Donaumonarchie stetig verbessert. Um 1867 waren alle Reste rechtlicher Diskriminierung aufgrund der Religionszugehörigkeit beseitigt worden (die bis dahin beispielsweise jüdische Hebammen in nichtjüdischen Haushalten verboten). Juden waren wählbar, sie stellten Bürgermeister der liberalen Partei, »jeder fleißige Judenknabe (trug) also das Ministerportefeuille in seiner Schultasche«.8
Die Zahl der jüdischen Schüler des Gymnasiums, das Freud von 1865 bis 1873 besuchte, stieg während dieser Zeit von 44 auf 73 Prozent. In den 80er Jahren war mindestens die Hälfte der Ärzte, Journalisten und Anwälte in Wien jüdisch. Es war eine Aufbruchstimmung ohnegleichen. Niemand konnte voraussehen, dass die Verfolgung der »Ungläubigen« bald in weit bösartigerer Gestalt zurückkehren würde. Was Freud immer als seine »Weltanschauung« verteidigt und zur Grundlage der psychoanalytischen Haltung gemacht hat, wurzelt in dieser politischen Situation.
Im vorliberalen Österreich musste sich ein Jude, dem die rechtlichen Einschränkungen lästig waren, taufen lassen. Eine solche Demütigung wäre in der liberalen Zukunft, in der engstirnige Tradition dem wissenschaftlichen Fortschritt weichen muss, den Juden erspart geblieben. Es gab eine gemeinsame Welt für sie und für alle anderen, die sich der Welt geistig bemächtigen wollten. In dieser spielten Glaube, Hautfarbe, Herkunft und Geschlecht keine Rolle mehr.
Für Freud bedeutete der Satz: »Auch ich bin Jude geblieben«, dass er es für verfehlt gehalten hätte, den durch Geburt erworbenen Aberglauben gegen einen zufällig praktischeren zu tauschen, sich also – wie Heinrich Heine – aus Karrieregründen taufen zu lassen. Das wäre in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts für eine Karriere in Verwaltung oder Militär noch unabdingbar gewesen.
Seit der liberalen Regierung in der Donaumonarchie schien die Möglichkeit greifbar nahe, solche Einschränkungen zu überwinden. Freud hat auf seine Weise für eine solche Zukunft gekämpft. Aus diesem Grund war für ihn der Bruch mit C. G. Jung so schmerzhaft. Er hatte die stürmische Hingabe des Schweizers an die gemeinsame Sache als Zeichen genommen, dass die Psychoanalyse Bindungen schaffen könnte, die Gegensätze des traditionellen Glaubens und der Herkunft überwinden.
Freud dachte als Gymnasiast daran, Jura zu studieren und Politiker zu werden. Während des Krieges von 1870 zwischen Frankreich und Deutschland hatte der 14-Jährige eine Karte des Kampfgebietes auf seinem Schreibtisch befestigt und die Schlachten mit bunten Fähnchen markiert. Er war auf der Seite der Deutschen.9
Freud glich einem Religionsstifter insofern, als er – persönlich ein bescheidener, schüchterner, in seinem Exhibitionismus sichtlich gehemmter und eher skeptischer Mensch – durch die Identifizierung mit seiner »Sache«, seinem »Neugebilde« so viel Stärke und Durchsetzungskraft gewann, dass er viele andere Menschen überzeugen und zu Aposteln machen konnte.
Sobald Freud die psychoanalytische Bewegung aufgebaut hatte, in der er (wie in seiner Schulklasse) der unangefochtene Primus war, blühte seine Kreativität auf und nahm eine mehr und mehr künstlerische Richtung. Er verzichtete bald auf den wissenschaftlichen Apparat und ging mit Fakten gelegentlich so sorglos um, dass ihn Böswillige als »Fälscher« brandmarken.10
Freud hat die Psychoanalyse geschaffen, aber umgekehrt schuf die Psychoanalyse auch Freud. Er unterwarf sich ihr, denn sie machte ihn stark, macht ihn unangreifbar.
Wie suggestiv Freuds Wünsche in dieser Richtung waren, zeigt die Gründung des »geheimen Komitees« während der Auseinandersetzungen mit C. G. Jung. Der Gedanke ging von Ernest Jones aus, der darüber mit Ferenczi sprach, worauf sich Ferenczi angeblich an entsprechende, schon früher geäußerte Wünsche Freuds erinnerte. Das Ergebnis war jedenfalls eine von Freud enthusiastisch begrüßte, aber auch zu einer Existenz im strikt Geheimen verpflichtete Männerrunde, die er mit goldenen Ringen ausrüstete, in die antike Gemmen gefasst waren.
Diese an Tolkiens Trilogie vom »Herrn der Ringe« anklingende Symbolik steht für einen regressiven Zug in der psychoanalytischen Institution. Der Gründer selbst wollte an den »demokratischen« Gremien der Internationalen Psychoanalytischen Gesellschaft vorbei im Geheimen für den Erhalt der reinen Lehre sorgen. Die Mitglieder dieses innersten Kreises sollten darauf hinwirken, dass keine der Grundlehren der psychoanalytischen Theorie verlassen würde.
In Jones’ Brief an Freud, in dem er diesen Plan erläuterte, wird die Verbindung von »gründlicher Analyse« und Treue zu Freud geknüpft: »daß eine kleine Gruppe von Männern von Ihnen gründlich analysiert werde, so daß sie die reine Theorie, unverfälscht durch persönliche Komplexe, repräsentieren und so einen inoffiziellen inneren Kreis im Verein bilden und als Zentren dienen könnten, wo andere (Anfänger) hingehen und die Arbeit lernen könnten.«11
Jones hat diesen Vorschlag und Freuds Reaktion in seiner Freud-Biografie wiedergegeben. Freud antwortete sogleich: »Was meine Phantasie sofort in Beschlag nahm, war Ihre Idee eines geheimen Konzils, das sich aus den besten und zuverlässigsten unserer Leute zusammensetzen solle, deren Aufgabe es sei, für die Weiterentwicklung der Psychoanalyse zu sorgen und die Sache gegen Persönlichkeiten und Zwischenfälle zu verteidigen, wenn ich nicht mehr da bin.«
Jones hat aber zwei weitere Sätze aus Freuds Antwort weggelassen: »Sie sagen, es war Ferenczi, der diese Idee aussprach, aber sie könnte meine eigene sein, geformt in besseren Zeiten, als ich hoffte, Jung werde einen solchen Kreis um sich versammeln, der sich aus den unabhängigen Führern der Ortsgruppen zusammensetzte. Jetzt muss ich leider sagen, daß eine solche Vereinigung unabhängig von Jung und den gewählten Präsidenten zu bilden ist.«12
Das dokumentiert ein wenig die Peinlichkeit, die für die »orthodoxe« psychoanalytische Geschichtsschreibung in der Freundschaft zwischen Freud und C. G. Jung steckt.