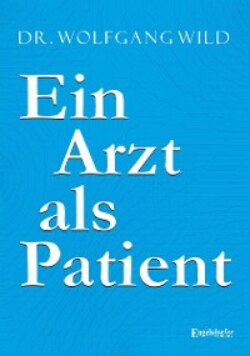Читать книгу Ein Arzt als Patient - Wolfgang Wild - Страница 16
5. Kapitel Dezember 2003: Die Sorge um mein Bein nimmt zu, und mein Hund ist eine Katze
ОглавлениеNach knapp fünfjähriger, krankenhausfreier Phase bekam ich Anfang Dezember 2003 Schmerzen in der linken Kniekehle und dazu das Gefühl, dass sich da etwas befand, was aus anatomischer Sicht nicht dort hätte sein dürfen. Diesmal gab es keine Zeichen einer Minderdurchblutung – es musste sich demnach um etwas anderes handeln. Wären diese Beschwerden am gesunden Bein aufgetreten, hätte ich wie bei anderen Patienten zunächst an eine harmlose, gut zu operierende Zyste gedacht. Aber es war das kranke Bein, und so ging ich wieder einmal zunächst in eine Praxis für Gefäßkrankheiten. Hier wurde mir bescheinigt, dass kein Verschluss durch Thrombosierung vorlag. Das hatte ich mit Sicherheit der gerinnungshemmenden Zusatzmedikation zu verdanken. Diesmal war aber an der unteren Anastomose (Verbindung zwischen Bypass und Kniekehlenarterie) eine Veränderung mit Massezunahme zu erkennen.
Zur Sicherung dieses Befundes erfolgte eine Computeruntersuchung, die einen Defekt an dieser Anastomose ans Licht brachte. Der Radiologe und Computerspezialist sprach erstmals darüber, dass der starre Kunststoffbypass für die Anwendung in der Kniekehle nicht geeignet war.
Dem Erstoperateur, der das Kunststoffgefäß eingebracht hatte, war wohl bekannt, dass die Verwendung körpereigenen Materials von Vorteil gewesen wäre. Deshalb hatte er auch eine Vene vom selben Bein als Bypass verwenden wollen. Dieser Versuch scheiterte aber an dem schlechten Zustand der Venenwand. Die beste Möglichkeit, ein Stück eigene Schlagader (Arterie) dazwischenzuschalten, bleibt auch heute noch nur bestimmten Zentren vorbehalten. Außerdem bestand damals akute Zeitnot, weil das Bein schon stundenlang minderdurchblutet war.
„Schneeweißchen“ war eine von unseren zwei Katzen … (S. 36)
Nach Vorstellung und Besprechung des Computerbefundes mit dem Gefäßchirurgen war wieder einmal die stationäre Aufnahme vereinbart worden. Diesmal mussten die gerinnungshemmenden Medikamente sofort abgesetzt werden, weil nicht nur eine „Durchspülung“ des Bypasses, sondern eine größere Operation geplant war.
Zur Vervollständigung der Diagnostik sollte eine Angiografie (Gefäßdarstellung mit Kontrastmittel) durchgeführt werden. Zum Glück wartete man damit, bis der Laborwert, der über die Gerinnung und so auch über die Blutungsgefahr Auskunft gibt, vorlag. Der Stationsarzt kam und sagte: „Herr Wild, mit diesem Wert können wir keine Angiografie und schon gar nicht eine Operation durchführen. Wir müssen abwarten und werden Sie erst noch einmal entlassen.“
Vier Tage später wurde ich wieder stationär aufgenommen und am Folgetag operiert. Entsprechend des Computerbefundes fand man an der unteren Anastomose einen Ausriss. Aus diesem Leck war Blut ausgetreten und hatte einen ziemlich großen Bluterguss verursacht. Dieses Hämatom verspürte ich als Fremdkörper in der Kniekehle, was die Beugung des Kniegelenkes zusätzlich behinderte.
Die Behandlung bestand darin, dass diese defekte Anastomose herausgeschnitten und ein neues Prothesenstück dazwischengesetzt wurde.
Zur Visite am nächsten Tag sagte mir der Oberarzt: „Der Bypass funktioniert wieder, aber Sie haben nur noch eine Unterschenkelarterie.“
Darauf ich: „Damit werde ich leben können.“
„Nein, Herr Wild, damit werden Sie leben müssen.“
Nach dem Grund des Verbleibs der anderen zwei Unterschenkelarterien zu fragen, verkniff ich mir; – ich wäre nicht Arzt, hätte ich die Antwort nicht bereits gekannt.
Trotz meiner angeborenen Gerinnungsstörungen waren – dank der medikamentösen Behandlung – der Bypass und die größte der drei Unterschenkelarterien über fünf Jahre durchgängig geblieben. Die beiden im Kaliber dünneren Unterschenkelschlagadern waren allerdings über eine längere Strecke verstopft und funktionslos. Dafür hatten sich aber viele neue kleinere Gefäße, sogenannte Kollateralen, gebildet. Das war möglich, weil ich die Empfehlung, täglich drei bis fünf Kilometer zu laufen, sehr ernst nahm. Später, nachdem auch die dritte und letzte Unterschenkelarterie verschlossen war, bin ich nur noch mit diesen Kollateralen unterwegs gewesen.
Wenn ich nach Hause kam, stellte ich meist nur die Tasche ab und ging gleich wieder mit „Schneewie“ los. „Schneeweißchen“ war eine von unseren zwei Katzen, derentwegen ich mir keinen Hund zulegen konnte, aber es war auch nicht mehr nötig. Die weiße Katze war uns zugelaufen und total auf mich fixiert. Ständig lief sie mir hinterher und lag auf der Lauer, damit sie es ja nicht verpasste, mich bei meinen „medizinischen“ Spaziergängen zu begleiten. Kamen wir an Grundstücke, wo ein Hund bellte, blieb sie stehen, sah mich an, und ich musste sie auf den Arm nehmen, bis wir die „Gefahrenstelle“ passiert hatten. Oft wurde ich von Passanten, die aus der Ferne einen weißen Hund vermuteten, wegen dieser dankbaren und treuen Katzenseele angesprochen.
Für die Wochentage hatte ich mir eine etwas kleinere und für das Wochenende eine größere Strecke ausgesucht. Trotzdem musste ich mich wohl nun gedanklich damit abfinden, dass Gefäßpatienten, wie ich einer war, nicht nur immer wieder auf dem OP-Tisch landeten, sondern dass auch der Befund von mal zu mal kritischer ausfallen würde.
Die Wundheilung gestaltete sich bei mir, wie stets, komplikationslos; einen hartnäckigen Durchfall jedoch sollte ich zu Hause selbst behandeln. So wurde ich wieder einmal kurz vor Weihnachten entlassen.
Diesmal hatte ich während und nach der Operation ein Antibiotikum erhalten, worauf erfahrungsgemäß viele Patienten mit Durchfall reagieren. Das wurde von den behandelnden Ärzten zunächst auch bei mir so gedeutet. Aber leider lag die Ursache dafür woanders.