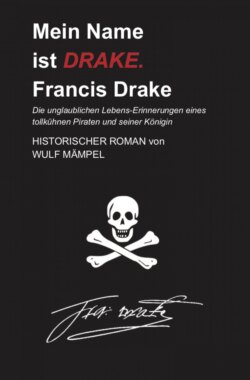Читать книгу Mein Name ist DRAKE. Francis Drake - Wulf Mämpel - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PROLOG
ОглавлениеGedanken in modernen Zeiten
Muss in den Blutbahnen eines Seemanns denn unbedingt Salzwasser fließen? Oder Rum? In den Adern eines Autors unbedingt Tinte? Diese Fragen beschäftigen mich mit einem Mal. Ich schreibe nun, besser, ich beschrifte weißes Papier. Es macht mir Mühe. John sagte neulich zu Fernando, ich bekam den Satz rein zufällig mit: „Ich glaube, der Kapitän muss wieder auf der Brücke seines Schiffes stehen, er schreibt mir zu viel. Ich mache mir Sorgen.“ Fernandos Antwort bestand aus einem Grinsen und Achselzucken. Dann bekreuzigte er sich.
Es gibt ja so etwas wie Weisheiten vom Meer und seinen Menschen, die so ganz anders denken und fühlen als die Flachländler, Weisheiten vom Leben an den Küsten der Ozeane. Und in den abendlichen Gesprächen der Seeleute, wenn sie – schon alkoholisiert - von ihren Fahrten erzählen. Wer unter Segeln reist, ist sicher ein anderer Mensch. Mein Freund John Hawkins lehrte mich: „„Man kann keine neuen Meere finden, wenn man nicht den Mut hat, die Küste aus den Augen zu verlieren.“ Anders als ein Städter, der sich über den vielen Dreck, den die Masse Mensch produziert, empört. Jeder Kapitän hat im Laufe der Jahre so seine eigenen Sprüche entwickelt, die er ständig zitiert. Das gehört zum Seemannsgarn. Mein Spruch, den ich schon in jungen Jahren für mich aussuchte, lautet: „Wenn das Schiff auf falschem Kurs ist, genügt es nicht, den Kapitän auszuwechseln — man muss den Kurs ändern.“ Ich habe es oft erlebt, was mich am meisten erstaunte, wenn ich von einer langen Fahrt zurückkehrte, war das ungläubige Staunen der zurückgebliebenen Landratten über das dann Gehörte. Ich sage immer: Erst ein kühnes Auge vermag neue Welten zu entdecken, denn der Kapitän kann den Wind nicht verändern, er kann nur die Segel richtig setzen. Ich habe gelernt, dass der, der viel reist seine kleinkarierten Vorurteile positiv verändert . . . Jeder, der den Fuß auf ein fremdes Land setzt, verlässt es reich beschenkt. Nicht nur, weil er ein Freibeuter, also ein Dieb ist.
Odin, mein Lieblingshund, ein munterer Beagle-Rüde, einer von meinen sieben Jagdhunden, stupst mich mit seiner feuchten, kalten Nase und sehr traurig blickenden Augen erneut an. Er kennt mich nur zu gut. Meine bisherige Verweigerung, ihm ein Stück von der Hirschwurst zu spendieren, die ich auf einem Zinnteller in kleine Portionen aufgeschnitten habe, schmilzt dahin. Odin, mein bester Treibjagdhund für Niederwild, kennt das Spiel, das er nur bei mir wagt, denn meine Frau Elisabeth ist konsequenter als ich. Sie lehnt es strikt ab, den treuen Freund - nur er darf ins Haus, seine Kumpane bewohnen einen großräumigen Zwinger in der Nähe der Scheunen und Ställe - bei Tisch zu füttern. Das unterscheidet unseren Haushalt von anderen, in denen den Hunden, wie seit Jahrhunderten, sogar Knochen zugeworfen werden, während die Herrschaft am Tisch sitzt und speist. Hunde bei Tisch nicht zu füttern, ist die neue Mode im vornehmen England. Bei den Bauern und Handwerkern hat sich das bisher nicht durchgesetzt. Odins treue Augen strahlen, als er eine dicke Scheibe der Wurst verschlingt, die ich ihm reiche. Mit einem leisen Knurren, wohl eher ein zufriedenes Grunzen, legt er sich neben meinen Sessel. Ich mag diesen treuen Gefährten sehr, manchmal habe ich den Eindruck, er versteht, was ich ihm sage . . .
Wir beide befinden uns in der großen Halle unseres Landsitzes, der Buckland Abbey, einer ehemaligen Abtei der Zisterzienser-Mönche aus dem 13. Jahrhundert, in der Grafschaft Devon gelegen, zweieinhalb Meilen von der Straße nach Plymouth entfernt. Ich liebe dieses von Waldstücken umgebene wildreiche Refugium, in dem ich Ruhe finde, meinen Wahn reduziere, in dem ich die Bequemlichkeit genieße, die mich umgibt. Hier denke ich, hier schreibe ich, hier wühlen sich meine Gedanken durch mein bisheriges unstetes Leben. Erst hier in Buckland habe ich Wurzeln geschlagen, denn nirgendwo sonst in der weiten Welt war ich ganz zu Hause. Hier kann ich meine Dämonen verjagen!
Da ich ein Frühaufsteher bin, herrscht an diesem Morgen im Haus noch Ruhe. Meine Frau ist ausgeritten und wird erst in gut einer Stunde zurück erwartet. Ich sitze vor einem Blatt Büttenpapier, das in der Mühle von Plymouth in einem langwierigen Prozess hergestellt wird. Mein Vorrat an Papier ist groß, denn mein Plan, der noch nicht bekannt, noch nicht ausgereift und beschlossen ist, quält mich sehr.
Verfluchte Tat!
Der erste stümperhafte Versuch, eine für mich enorme Überwindung, da ich meine Inkompetenz auf diesem Gebiet nur zu gut kenne, meine Erinnerungen zu sortieren, bevor ich einen Satz schreiben werde, misslingt prächtig. Ich weiß nicht, wo, wann und womit ich beginnen soll. Da helfen mir nicht die oft selbst gewählte Stille, ein Glas vom vorzüglichen französischen Roten oder lange, einsame Ausritte durch die Wälder meines Anwesens. Auch keine kurzweiligen Besuche in London oder fröhliche Feste mit Freunden in meinem Haus, die meine Frau meinetwegen organisiert. Erste Schreibversuche zerstöre ich wütend, indem ich die Seiten zerknülle und ins Feuer werfe. Ich weiß natürlich, dass das Schreiben eine elementare Kulturtechnik ist und zu den Grundfertigkeiten eines gebildeten Menschen im modernen Europa gehört. Doch mich quälen Zweifel, weil ich beschlossen habe, dass mein Text nicht jedem gefallen muss. Ist das schon eine beginnende Arroganz? Glauben und Wissen sind ja keine sich ausschließenden Gegensätze. Ich sollte England über meine Person stellen, doch das ist bei der eigenen Biographie schwierig. Wie gehe ich mit meinen Dämonen um, mit meinen dunklen Gedanken, mit Gewalt, Sex, Mord und Krieg oder mit den Schwächen der anderen? Ich habe das Gefühl, Schreiben ist die Spitze eines Eisbergs, mehr nicht, da vieles, das meiste, nicht geschrieben wird. Nicht, weil ich es nicht schreiben will, sondern weil beim Korrigieren eines Textes immer Neues hinzu kommt. Neue Worte, neue Informationen, Zitate und Szenen. Und neue Boshaftigkeiten!
Gedankensprudel! Gedankenwust! Gedankenberge!
Schreiben ist, das habe ich nun erfahren, zu einem Dialog mit mir selbst geworden . . . So nervös ich auf der einen Seite bin, desto ruhiger werde ich, wenn ich abends zufrieden die Feder beiseitelege. Kann das Schreiben einen Menschen beruhigen, glücklich machen, ablenken von den Alltäglichkeiten? Schreiben als Therapie?
Da sitze ich nun bequem im Warmen und kann mein Wissen nicht verwerten! Mich verlässt meine Tapferkeit. Ich stelle schon im Vorfeld meines verrückten Plans fest: Das Leben kann wie ein großer Speicher sein, in den man alles hineinpackt, was eigentlich unnütz ist, von dessen Inhalt man sich aber nicht wirklich trennen möchte. So geht es mir beim Schreiben. Was, in des Herrgotts Namen, treibt mich an? Warum tue ich das? Ich fürchte mich doch nicht etwa vor der Wahrheit? Vor der Realität, der Peinlichkeit, etwas preiszugeben, was andere von mir nicht wissen? Und vor der möglicherweise einsetzenden Kritik, wenn das Werk eines fernen Tages tatsächlich gedruckt werden sollte, wie die Königin mir riet, als wir darüber sprachen. Ein Rat, den ich mit einem schwachen Lächeln quittierte.
William Shakespeare, den ich bei einem seiner letzten Besuche danach fragte, erklärte es mir so: „Zwinge den Leser, Dir zu folgen. Mache ihm das Lesen nicht zu einfach. Sei mutig und konsequent, gehe keine Kompromisse ein. Schreibe so, wie es aus Deiner Feder fließt, in welcher Stimmung Du auch gerade sein magst. Das allein ist authentisch. Du musst wissen: Unsere Gesellschaft will lieber unterhalten als unterrichtet werden! Habe also keine Angst vor Wiederholungen, denn die Wiederholung unterstreicht die Bedeutung dessen, was Du berichten willst: einen nicht gefälschten Inhalt. Denke immer daran, lieber Francis: Je weniger Verstand einer hat, desto weniger merkt er den Mangel.“
Die Worte unseres jungen Freundes William haben ihre Wirkung bei mir nicht verfehlt: Ja, so werde ich es versuchen. Einfach drauf los schreiben! Wie heißt es: Wie einem der Schnabel gewachsen ist! Ich möchte aber nicht nur mein Leben erzählen, sondern auch mein Umfeld beschreiben, meine Gefühle ebenso wie unsere neue Welt, die zu Ende des 16. Jahrhunderts aus den Fugen zu geraten scheint. Über Politik, Gesellschaft, Brutalität, Welthandel, Religion, Wissenschaft, Kultur, Literatur – alles ist anders geworden, neu, fremd, brutal auf der einen, grandios auf der anderen Seite! Was für eine wunderbare neue Welt, in der wir leben, auch wenn die ewig Gestrigen versuchen, das alte, das konservative England – und damit auch Europa - mit allen Mitteln zu bewahren. Das sind die fanatischen Sektierer und Populisten, die die Spaltung der katholischen Kirche nutzen, um ihre eigene Religion zu gründen und sich die Rosinen aus dem Christentum nach Belieben herauspicken. Ich mag sie nicht, diese Wichtigtuer, die Papisten, Puritaner und selbsternannten christlichen Eigenbrötler. Sie nutzen die Dummheit eines Teils des Volkes für ihre eigenen Zwecke. Ihr Feld ist das der Gutgläubigkeit, des Aberglaubens und der Naivität. Ein widerliches Pack!
Sie ergötzen sich bei den Hexenverfolgungen, klagen ohne Grund harmlose Frauen an, quälen, vergewaltigen sie, foltern sie auf brutalste Art und verbrennen sie dann auf dem Scheiterhaufen. Die einen verfolgen die evangelischen Ketzer, die anderen die katholischen Häretiker. Je nach Meinung der Krone: Heinrich VIII. verfolgte die Katholiken, seine Tochter Königin Mary die Protestanten, Elisabeth I. wiederum die Katholiken. Das Leid des Volkes sieht dabei niemand. Ich kann verstehen, dass das Christentum bei vielen Bürgern auf der Strecke bleibt. Wer die Macht hat, bestimmt den wahren Glauben! Falschheit und Gleichgültigkeit sind das Ergebnis. Die Menschen fügen sich der jeweiligen Glaubensrichtung. Aus Angst. Aus Not und weil sie nicht auf die Liste der Inquisition gesetzt werden wollen. Es genügt ja schon nur der Anfangsverdacht, um der Maschinerie der brutalen Verfolgung durch die Hexenjäger ausgeliefert zu sein. Was für eine verrückte Zeit, die auf der anderen Seite geradezu nach Fortschritt, Wissenschaft, Handel und Kultur schreit. Auf der anderen geradezu mittelalterlich anmutet. Aberglaube vergangener Zeiten treibt ebenso die brutalsten Blüten wie der weltweit einsetzende Handel, die Entdeckung neuer Welten und große Erfolge in der Wissenschaft und Bildung. Es ist eine Zeit, in der Feuer und Wasser in einem Topf brodeln! Der deutsche Dominikaner Kramer hat sogar ein Buch über den Hexenwahn und deren Gesetze verfasst, den umstrittenen Hexenhammer, ein Werk, das die höchst strenge Verfolgung der Hexen legitimiert. Laien und Kleriker, die die Hexenjagd ablehnten, wurden im Hexenhammer zu Häretikern erklärt und ebenfalls der Verfolgung preisgegeben. Die Frauen selbst, die als Hexen angeklagt wurden, hatten keine Chance, mit dem Leben davon zu kommen. Die Folter erpresste jedes Schuldbekenntnis! All dies geschah - und es geschieht auch heute noch - im Zeichen des Kreuzes . . .
In dieser frühen Neuzeit - erst vor einhundert Jahren wurde der Kontinent Amerika entdeckt - so muss ich feststellen, erkenne ich neben diesen unsäglichen Glaubenskämpfen auch so etwas wie die hässliche Fratze des Goldes, des Kapitalismus, ein Wort, an das ich mich erst gewöhnen muss – denn das Königreich England definiert sich erst ab 1550 als eine noch kleine, expandierende Handels- und Kolonialmacht im europäischen Maßstab. Gold regiert die alte und die neue Welt! Spanien, Portugal, die Niederlande, die deutschen Hansestädte, Italien mit den erfolgreichen Stadtstaaten, Russland und schließlich England selbst entwickeln große Aktivitäten, was den Handel betrifft. Die Kaufleute, die mächtige Gilde der Handelshäuser, haben dem Adel in vielen Bereichen schon den Rang abgelaufen. Die Zukunft, so bin ich sicher, wird den großen Handelskontoren gehören. Das Geld regiert die Welt – früher, heute, morgen. Die Fugger, Welser, Borgia, Medici und andere regierten und regieren das alte Europa maßgebend. Denn das späte Mittelalter war hinübergegangen in die Epoche der Renaissance, dem Beginn der so genannten Frühen Neuzeit.
Unsere Bürger wandeln sich. Auf der einen Seite herrscht immer noch brutaler Aberglaube und ein Kriechen vor dem Kreuz, gleichzeitig verlieren der Tauschhandel, das Rittertum und die Landwirtschaft ihre Vorherrschaft. Das Bürgertum gewinnt an Bedeutung. Und wie! Erste Parlamente sind entstanden, Bürgermeister aus dem Volk regieren die Städte so gut sie es nur können. Eine Welt im Wandel, in einem Taumel – und wie!
Großhändler – neidisch als Pfeffersäcke bezeichnet – mehren ihren Reichtum und damit ihr Ansehen. Das Goldene Antwerpen ist solch eine Metropole geworden, natürlich Florenz, aber auch Lyon, Genf, Frankfurt, Augsburg, Lübeck, Hamburg, Danzig, Leipzig und Köln. Die großen Familien-Clans versorgen Kaiser, Könige, Fürsten und Päpste mit dem notwendigen Kapital für deren durch ständige Kriege leer geräumte Kassen. Die Kaufleute steigen in den Adelsstand auf, nutzen ihren ausgeprägten politischen Einfluss für ihre Geschäfte und werden dabei unverschämt reich und reicher. Englands Reichtum entsteht durch die Kaperfahrten ihrer mutigen Kapitäne. Darauf können wir stolz sein. Erst dadurch entwickeln sich Handelshäuser, Reedereien und Banken wie etwa in Deutschland.
Zu Beginn des 16. Jahrhunderts ist England eine relativ unbedeutende Größe im europäischen Machtspiel gewesen, heute, etwa 80 Jahre später, hat es deutlich an Einfluss gewonnen. Wir nennen es stolz das „Goldene Zeitalter“. Die Menschen spüren, dass sie an der Schwelle einer neuen Epoche stehen, Teil eines grandiosen Aufbruchs sind, der von einer Frau geprägt wird: Von unserer, von meiner Königin Elisabeth I. Ich hoffe, die Regentin weiß, dass sie das Volk weiterhin an der zarten Pflanze Wohlstand beteiligen muss, um Unruhen zu verhindern. Wie diese Mönche geifernd durch die Städte und Dörfer ziehen, Neid und Angst schüren, so stelle ich Unzufriedenheit auch unter den Dockarbeitern, den Knechten und kleinen Köttern fest.