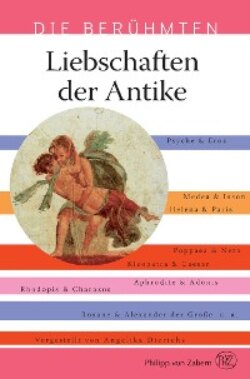Читать книгу Liebschaften der Antike - Angelika Dierichs - Страница 12
Оглавление[Menü]
Bedauerlich, dass sie ihn nur kurzfristig außer Gefecht setzte
Aphrodite und Ares
Dauer der Beziehung: Unbestimmt
Art der Beziehung: Außerehelich (Episode im Olymp); ehelich (Vermählung in Theben)
Kinder: Eros (Liebesgott), Anteros (Gott der unerwiderten Liebe); Deimos (Gott des Grauens), Phobos (Gott der Furcht), Harmonia (Göttin der Eintracht), Enyalios (Gott des Kampfes)
Aphrodite, bekannt als: Liebesgöttin
Eltern: Zeus und Dione
Mutterlose Geburt: Mit einer Sichel entmannt Kronos seinen Vater Uranos, den Himmelsgott. Infolge der Verstümmelung fallen Blutstropfen auf die Erde. Sie bilden Erinyen, Giganten und Nymphen. Das ins Meer stürzende Glied des Uranos gebiert Aphrodite, die an Zyperns Strand den Fluten entsteigt.
Erscheinungsbild: Voll Anmut, Grazie und Schönheit; prächtig gekleidet; veilchenbekränzt.
Unveränderliche Kennzeichen: Schönäugig, schönhalsig, schönbrüstig; sie trägt den Kestos, ein Busenband, das Liebe, Liebesverlangen und Liebesgeplauder garantiert; Attributtiere: Gans, Schwan, Taube, Ziegenbock
Hauptwohnsitze: Götterwelt; Paphos auf Zypern
Ares, bekannt als: Kriegsgott
Eltern: Zeus und Hera
Erscheinungsbild: Attraktive männliche Statur; schöne Gliedmaßen; starker Körperbau; bärtig oder bartlos; gerüstet oder nackt
Unveränderliche Kennzeichen: Attribute: Fackel; Helm; Lanze; Schwert; Schild; Geier; Hund
Hauptwohnsitz: Thrakien
Es war einmal …
Vorgeschichte – der unattraktive göttliche Ehemann
Hephaistos, Herr des Feuers und göttlicher Schmied, obgleich erfindungsreich und einsatzbereit, ist ein Außenseiter in der „göttlichen Spaßgesellschaft auf dem Olymp“. Seine Geschwister dürfen sich ihrer körperlichen Schönheit erfreuen. Er hingegen leidet unter verkrüppelten Füßen. Wegen dieser Behinderung stößt ihn Mutter Hera aus dem Olymp. Als er „endlich“ wieder im Kreis der Gottheiten weilt, lebt er an der Seite seiner untreuen Gemahlin. Warum wird gerade die schöne Göttin Aphrodite zur Gattin des unansehnlichen Schmiedegottes? Versionen des Mythos geben keine Antwort. Aber gemäß Spezialforschungen könnte man erwägen, dass es im spätbronzezeitlichen Zypern eine Verbindung aus der Großen Göttin und dem Gott der Metallurgie gab, die zu Aphrodite und Hephaistos wurden.
Was Namen verraten
Der Name Aphrodite ist verbunden mit dem griechischen Wort für Schaum, weil die Göttin gemäß einer Version des Mythos aus den abertausend Bläschen geboren wird, die sich um das abgeschlagene Glied des Uranos im Meer bilden. Nach Aphrodite heißen die Aphrodisiaka, jene wie auch immer gearteten Mittel, welche Liebe, Libido, Erotik und Sexualität in zwischenmenschlichen Beziehungen anregen, sei es, dass sie wirklich helfen oder dass man ihrer Wirkung gläubig vertraut.
Ares wird seinem Namen gerecht, der Schädiger, Strafer und Rächer bedeutet.
Das alles tut die bekleidet, teilbekleidet oder nackt dargestellte Aphrodite
Sie verkörpert süßes Verlangen und sinnliche Lust, schenkt beides anderen; befiehlt Leidenschaft; agiert mit mächtigem Nachdruck; übt trotz ihres zauberhaften Wesens Gewalt aus; stiftet Frieden in der Natur; dominiert Winde und Wolken; schützt Blüten und Bäume; kümmert sich um das Meer und die Seefahrt; liebt Düfte und Räucherwerk, Salben und Öle; bevorzugt Weihrauch als Lieblingsopfer; favorisiert Goldschmuck.
Göttlicher Ehebruch
Aphrodite geht fremd. Ihrem Liebhaber, dem Kriegsgott Ares, gefällt es, ihren Gemahl, den Schmiedegott Hephaistos, macht es rasend eifersüchtig, als der alles sehende Sonnengott Helios ihm verrät, dass Aphrodite den Geliebten – er wohnt ja nicht im Olymp, sondern im fernen Thrakien – mehrfach im Haus ihres Ehemanns empfing. Der Schmiedegott handelt klug. Sich wohl bewusst, dass er den mächtigen Ares nicht im Kampf besiegen kann, rächt er sich durch eine List. Ein Netzwerk aus feinen Ketten schmiedet er und befestigt es rund um das Bett, auf dem ihn die Ehebrecher in Bälde wieder hintergehen werden. Dann begibt er sich angeblich nach Lemnos. Diese Insel gehört zu den wichtigsten Kultorten des Hephaistos, weil er dort, als Baby aus dem Olymp geworfen, den Boden berührt und aufgezogen wird. Als nun Ares, die Abwesenheit des Aphroditegemahls nutzend, zum Haus der Geliebten eilt, fasst er sein sehnsüchtiges Begehren in Worte, denen Aphrodite, wie könnte es auch anders sein, sofort Gehör schenkt. Die Liebesgöttin und der Kriegsgott begeben sich auf das Lager. Das Netz aus Metall bemerken sie nicht. Helios wird abermals Zeuge des Liebesspiels und benachrichtigt unverzüglich den betrogenen Hephaistos. Dieser naht augenblicklich und lässt die wie ein feines Spinnennetz gewirkten Metallfäden auf das Paar niedersinken. Ob es sich gerade erst in inniger Umarmung beim Liebesvorspiel oder schon bei leidenschaftlichem Liebesverkehr befindet, kann niemand mehr ergründen. Sicher hingegen ist des Hephaistos Zorn. Außer sich vor Wut und laut schreiend zitiert er alle Gottheiten herbei – nur die Götter kommen, die Göttinnen bleiben „züchtig“ in ihren Gemächern – und verlangt von Zeus die Brautgeschenke zurück, die Hephaistos dem obersten der olympischen Götter für seine Tochter brachte. Das bedeutet Scheidung für das göttliche Ehepaar und Trennung für die göttlichen Ehebrecher. Hephaistos befreit die Gefesselten. Ares enteilt in seine Heimat Thrakien. Aphrodite reist zurück auf ihre Insel Zypern, wo sie die Chariten (Göttinnen der Anmut) nach dem Abenteuer mit Ares waschen, salben und kleiden.
Sandro Botticelli: „Venus und der schlafende Mars“, um 1483. Tempera/Holz, 69 x 173,5 cm. National Gallery, London
Das alles tut der in Kriegerrüstung oder nackt dargestellte Ares
Er agiert wortkarg; bedroht durch körperliche Kraft; ist rasch entschlussfähig; personifiziert den tobenden Kampf; reagiert schnell; überrascht durch ungestüme Tatkraft; beweist Einsatzbereitschaft.
Das Lachen der Götter
Das Liebesabenteuer zwischen dem gewaltbereiten Ares und der verführerischen Aphrodite – zu den prickelnden Betrugsgeschichten der Götterwelt gehört es – erzählten zwei berühmte Dichter des griechischen und römischen Altertums: Homer (Mitte 7. Jh. v. Chr.) und Ovid (43 v. Chr.– 17 n. Chr.). Vergleicht man die beiden „kurzweiligen“ Textpassagen, setzt sich in den Worten Homers eine merkwürdige Mischung aus Betroffensein und Heiterkeit frei, während Ovids Schilderung hauptsächlich die Pikanterie des Geschehens fokussiert. Das Lachen der Götter, als sie Aphrodite und Ares bewegungslos unter den Ketten des Hephaistos erblicken, wird gern als „homerisches Gelächter“ umschrieben. Und wer es in eine Unterhaltung einbringt, verrät, dass er eine sehr berühmte Passage der Weltliteratur kennt.
Eine andere Art göttlicher Liebe
Aphrodite und Ares, deren Liebesabenteuer zu Ungunsten des Hephaistos bis heute auf ein großes, „annähernd voyeuristisches“ Interesse stößt, kennt man weniger als honoriges Ehepaar in Theben. Dort nämlich wird eine kämpferische Aphrodite verehrt neben ihrem kriegerischen Gemahl, der als Ahnherr der Thebaner gilt. Sie haben drei Kinder: Die Kriegsdämonen Deimos (Schrecken), Phobos (Furcht) und die Personifikation der Eintracht namens Harmonia. Diverse Statuen zeigen die nackte Aphrodite, wie sie sich „rüstet“ bzw. „bewaffnet“, d. h. sie legt sich einen Gurt mit Gehänge um, in das sie ihr Schwert steckt. Da dieses „Rüstungsensemble“ in den betreffenden Bildwerken zumeist gänzlich oder stark zerstört ist, nimmt man die in ihnen verkörperte Liebesgöttin kaum kriegerisch wahr, sondern versteht sie, gemäß gewohnten Sehmustern, primär als die schöngestaltige, verführerische Geliebte des Ares.
Das göttliche Kind besonderer Art
Wohlbekannt ist Eros, jener Sohn der Aphrodite und des Ares, dem Zuwendung und Maßgaben seines kriegerischen Vaters zu fehlen scheinen. Bereitet er deshalb, um „modern zu fragen“, seiner alleinerziehenden Mutter zuweilen Probleme? Eine Antwort findet sich wohl kaum. Aber üblicherweise ist er Aphrodite als willfähriger Sohn und Diener beigeordnet, durch den sie Macht ausübt.
Nachantike Seitenblicke
Welt der Planeten: Venus und Mars
In der elektronischen Zeitschrift „Schattenblick“ (16. August 2007) heißt es unter der Kennung Planet/311: „Bei klarem Himmel kann man sie täglich mit bloßem Auge sehen: Mars mit seinem typischen rötlichen Licht; Venus leuchtend am Tage wie in der Nacht. Kopernikus, Kepler, Galilei und viele andere haben diese Schwesterplaneten der Erde bereits untersucht. Jedoch waren sie weit von ihnen entfernt. Heute umkreisen zwei europäische Satelliten-Zwillinge, Mars Express und Venus Express, ausgestattet mit einem erstaunlichen Instrumentenarsenal, diese beiden Planeten. Der erste wurde 2003 und der zweite im Jahr 2006 ins All befördert. Die von beiden gesammelte Datenmenge ist äußerst beeindruckend.“
Welt der Gemälde
Zahlreiche Maler der Neuzeit thematisierten die erotische Begegnung zwischen der Liebesgöttin und dem Kriegsgott. Zu den faszinierendsten Gemälden gehören Sandro Boticellis (1444/1455–1510) Aphrodite/Venus bzw. Ares/Mars (um 1483) in London (National Gallery, Inv. Nr. 915). Venus, in hellem, verführerisch geschnittenen Renaissancegewand, sitzt neben dem liegenden, schlafenden Mars. Er ist nackt. Sein ebenmäßig schöner Körper wirkt wie eine Statue aus Marmor (s. S. 33).
Leseproben
Aphrodite quält und beglückt
„Armut und Liebe – darunter leide ich. Das eine erdulde ich leicht. / Das Feuer der Aphrodite aber – das kann ich nicht ertragen.“
Anonym, Anthologia Palatina, 3.–1. Jh. v. Chr. (Übersetzung: Cornelius Hartz)
Zeus sagt zu Aphrodite: „Töchterchen, dein Geschäft sind nicht die Werke des Krieges. / Ordne du lieber hinfort die lieblichen Werke der Hochzeit. / Jene besorgt Athene schon und der rüstige Ares.“
Homer, Ilias 5, 428–430 (Übersetzung: Hans Rupé)
Ares brilliert
„Hoch die Tür des Gemaches! / – Hyménaios! – / Hebt den Türsturz, ihr Bauleute, höher! / – Hyménaios! – / Ganz wie Gott Ares, so naht nun der Bräutigam / Viel größer als sonst große Männer Bräutigam, gleich dem Ares, / viel größer als sonst große Männer.“
Sappho, Epithalamioi (Hochzeitslieder) 123 D (Übersetzung: Max Treu)
Vom Zorn des Hephaistos
„Vater Zeus und ihr anderen ewigen, seligen Götter, / Kommt doch hierher! Da seht ihr ein Werk nicht zum Loben und Lachen! / Aphrodite, die Tochter des Zeus, mißehrt mich, den Humpler,/ Immer wieder, sie liebt ja den scheußlichen Ares, der ist wohl / Schön und hat kräftige Füße, doch ich bin geboren als Lahmbein. / [ …] / Hier aber könnt ihr es sehen, da liegen sich beide in Armen,/ Stiegen hinein in mein Bett – ein Grimmen fasst mich beim Anblick. / Freilich ich hoffe, sie werden nicht kurz nur so liegen, die beiden, / Trotz ihrer heftigen Liebe; es dauert nicht lange, dann schwindet / Beiden der Wille zum Schlaf, doch die Falle der Fesseln behält sie; / Restlos zahlen muß mir ihr Vater die bräutlichen Gaben, / Die ich der hündischen Augen des Mädchens wegen ihm brachte. / Freilich, er hat eine herrliche Tochter, doch fehlt ihr Beherrschung.“
Homer, Odyssee 8, 306–320 (Übersetzung: Anton Weiher)
„Wie in das Bett nun kam mit dem Buhlen zusammen die Gattin, / Sind durch die Kunst des Gemahls und die schlau erfundenen Bande / Mitten im Liebesumfangen die Beiden ertappt und gefangen. / Jetzt im Nu geht auf die helfende Tür, und die Götter / Läßt der Lemnier ein. Sie lagen verschlungen in Schande. / Aber es wünscht wohl mancher der höchlich erheiterten Götter, / So in Schande zu sein. Die Himmlischen lachten, und lange blieb das Tagesgespräch im ganzen Olympus der Vorfall.“
Ovid, Metamorphosen 4, 182–189 (Übersetzung: Reinhart Suchier)