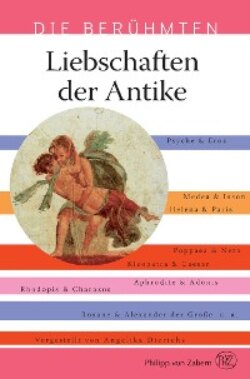Читать книгу Liebschaften der Antike - Angelika Dierichs - Страница 7
Оглавление[Menü]
Weibliche Opferbereitschaft als Exemplum treuer Gattenliebe über den Tod hinaus
Alkestis und Admetos
Dauer der Beziehung: Unbestimmt
Art der Beziehung: Ehelich; innig; auf Treue basierend
Kinder: Söhne: Eumelos, Hippasos; Tochter: Perimele
Alkestis, bekannt als: Frau, die anstelle ihres Mannes in den Tod geht
Eltern: Pelias (König von Iolkos) und Anaxibie
Erscheinungsbild: Dezent; schön; Verhüllung – der über den Kopf gezogene Mantel – verweist auf den zwischen Diesseits und Jenseits verkehrenden Schatten der Alkestis
Unveränderliche Kennzeichen: Keine
Hauptwohnsitze: Thessalien, Nordostgriechenland in Iolkos (heute Volos) und Pherai (heute Velestino)
Admetos, bekannt als: König von Pherai
Eltern: Pheres und Periklymene
Erscheinungsbild: Jugendlich
Unveränderliche Kennzeichen: Keine
Hauptwohnsitz: Thessalien, Nordostgriechenland in Pherai (heute Velestino)
Es war einmal …
Vorgeschichte – Apollon als Heiratsvermittler
Einst kommt es Zeus in den Sinn, Apollon zu verurteilen. Als Sühne für eine von ihm begangene, unterschiedlich überlieferte Blutschuld, muss er zwölf Monate im Dienst eines Sterblichen bleiben. Sein Arbeitsplatz ist der Hof des Königs Admetos von Pherai in Thessalien. Bei diesem Herrscher, der seine Untergebenen achtet, fromm lebt und gottesfürchtig handelt, übernimmt Apollon die Aufgaben eines einfachen Hirten. Mit unerwarteter Freundlichkeit und großem Wohlwollen behandelt der weltliche Regent den strafversetzten Gott, welcher sich für ein solches Verhalten des Admetos stets dankbar zeigt. Zunächst erhöht er des Königs Reichtum, indem er alle Kühe auf dem Anwesen Zwillingskälber gebären lässt. Dass er durch die Erhöhung des Rinderbestandes mehr leisten muss, nimmt er gern in Kauf. Später hilft Apollon, eine bewundernswürdige Gattin für Admetos zu gewinnen. Es ist Alkestis, die schöne Tochter des Pelias, des Königs von Iolkos. So viele Freier umwerben sie, dass ihr Vater eine unerfüllbare Prüfung vom zukünftigen Schwiegersohn verlangt: Wer Alkestis heimführen will, muss zwei wilde Tiere vor einen Wagen spannen. Aus eigener Kraft kann Admetos das selbstverständlich nicht schaffen, aber Apollon greift ein. Einen Löwen und einen Eber zwingt der Gott ins Zaumzeug. Umgehend lenkt Admetos den Wagen mit dem gefährlichen Gespann zu Pelias, erhält Alkestis und nimmt sie mit in seine Stadt. Das Paar heiratet unverzüglich. Leider versäumt Admetos, der Artemis Opfer zu bringen, welche ihr anlässlich einer Hochzeit zustehen. Höchst beleidigt reagiert die Göttin. Schlangen schickt sie ins Brautgemach. Wiederum löst Apollon das Problem. Er erklärt Admetos, dass sich Artemis durch die unterlassenen Ehrungen zu Recht missachtet fühle. Sie werden sofort nachgeholt und ein Happy End erfreut alle Beteiligten.
Noch immer aktuell in Theaterspielplänen
Alkestis und Admetos sind die Hauptgestalten in Euripides’ Tragödie „Alkestis“ (438 v. Chr.), die Tod und Wiederkehr der Alkestis thematisiert.
Eine große, nicht so ganz gleichgewichtige Liebe
Alkestis schenkt ihrem Gatten drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter: Eumelos, Hippasos und Perimele. Nur gute Eigenschaften zeichnen diese Ehefrau aus, die der König sein Eigen nennen darf. Sie ist diskret, einfühlsam, fromm, gottesfürchtig. Wie sehr Alkestis ihren Mann liebt, zeigt sich, als er – noch in jungen Jahren – erkrankt und im Sterben liegt. Sie steigt freiwillig ins Totenreich hinab, damit er weiterleben kann. Auch dieses Geschehen initiiert Apollon aufgrund seiner besonderen Beziehung zu Admetos. Der Gott erreicht, sei es durch Fürsprache bei Artemis oder durch Zugeständnisse der betrunken gemachten Schicksalsgöttinnen, dass Admetos nicht sterben muss, wenn jemand anderes für ihn in den Tod geht. Des Königs betagte Eltern wollen sich nicht für ihren Sohn opfern; Alkestis ist dazu bereit. Freiwillig folgt sie Thanatos, dem gnadenlosen Gott des Todes, in die Unterwelt zum unsterblichen Hades. Admetos weist die Selbstlosigkeit seiner Gemahlin nicht zurück, aber trauert zutiefst um sie. Endlich wendet sich Schreckliches zum Schönen, denn Alkestis darf aus dem Totenreich zurückkehren. Wie konnte das geschehen? Ihre Rettung gelang, weil der Held Herakles zugegen ist und im Ringkampf über Thanatos oder Hades siegt. Eine andere Version des Mythos weiß, dass Persephone, Gattin des Hades und Königin der Unterwelt, so überaus gerührt ist von der Treue der jungen Frau, dass sie Alkestis wieder zu den Lebenden emporschickt. Ein neues Glück verbindet Admetos und Alkestis.
Nachantike Seitenblicke
Alkestis im Lackbildtypus
Die Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste in Wien besitzt ein eindrucksvolles Gemälde (Inv. Nr. 1493), das Heinrich Friedrich Füger (1751–1818) in den Jahren 1804/1805 schuf. Alkestis steht in hellgelbem, über den Kopf genommenem Gewand vor dem Bett, auf dem der todgeweihte Admetos liegt. Sie zeigt mit ihrer linken Hand zum Gatten, hält die rechte Hand vor die Brust, blickt gen Himmel. Diese Darstellung der Alkestis erinnert im Gesamtausdruck an das Bild einer Heiligen.
Leseproben
Aus der Sicht des Philosophen
„Ja, gar füreinander sterben mögen Liebende allein, und nicht Männer nur, sondern sogar Frauen. Und dessen gibt uns schon Alkestis, die Tochter des Pelias, hinlänglich Beweis für diese Wahrheit vor allen Hellenen, da sie allein für ihren Gatten sterben wollte, der doch noch Vater und Mutter hatte, welche sie aber so weit übertraf an Freundschaft vermöge der Liebe, daß mit ihr verglichen sie ihrem Sohne fremd zu sein schienen und nur dem Namen nach ihm angehörig. Und diese Tat, welche sie vernichtet, wurde für so schön gehalten nicht nur von den Menschen, sondern auch von den Göttern …“.
Platon, Symposion 179 c (Übersetzung: Friedrich Schleiermacher)
Aus der Sicht des Dichters
Dienerin: „Wie hoch müßte eine Frau steigen, um sie [Alkestis] zu übertreffen? / Auf welche Weise könnte eine mehr Achtung für ihren Mann / zeigen, als durch die Bereitschaft für ihn zu sterben? […] Als sie fühlte, daß der entscheidende Tag / gekommen war, badete sie den weißen Leib / im Wasser aus dem Fluß, nahm aus der Truhe von Zedernholz / ein Gewand und Schmuck, kleidete sich festlich […] Dann im Schlafgemach und zum Bett stürzend, / brach sie dort in Tränen aus und sagte: /„O Lager, wo ich den Mädchengürtel löste / wegen dieses Mannes, für den ich sterbe, / lebe wohl; denn ich hasse dich nicht. Doch du brachtest mir den Tod, / mir allein; denn weil ich dich und den Gatten nicht verraten wollte, / sterbe ich. Dich wird nun eine andere Frau besitzen, / nicht von besserer Gesinnung als ich, aber vielleicht glücklicher.“
Euripides, Alkestis 153–182 (Übersetzung: Gustav Adolf Seeck)
Admetos: „[…] Denn du / warst im Leben meine Frau und auch tot wirst nur du / meine Frau heißen. Keine andere Thessalerin, / sie mag von noch so edler Abstammung / und noch so schön sein.“
Euripides, Alkestis 328–333 (Übersetzung: Gustav Adolf Seeck)
Admetos: „Ein von Künstlerhand geschaffenes Abbild von dir / soll auf deinem Lager hingestreckt sein, / vor dem ich niedersinke und das ich umarme, / während ich deinen Namen rufe und in den Armen / meine geliebte Frau – sie nicht haltend – zu halten glaube.“
Euripides, Alkestis 348–353 (Übersetzung: Gustav Adolf Seeck)
Chor: „Du aber bist in deiner Jugendblüte / für den jungen Gatten gestorben und bist nun dahin.“
Euripides, Alkestis 471–472 (Übersetzung: Gustav Adolf Seeck)
Admetos: „O mein gutes Haus, wie trete ich nun ein? / Wie werde ich in dir wohnen, nachdem sich mein Schicksal so geändert hat. […] Damals zog ich hier ein mit Fackeln vom Pelion / und unter Hochzeitsliedern, / die Hand der geliebten Gattin haltend […]. Jetzt aber geleiten mich statt der Hochzeitslieder Klagen / und statt weißer Gewänder schwarze Trauerkleider / hinein zur / verödeten Bettstatt.“
Euripides, Alkestis 911–925 (Übersetzung: Gustav Adolf Seeck)
Admetos: „ […] Du aber, Frau, / wer du auch bist, wisse, daß du dieselbe Größe / wie Alkestis hast und ihr der Gestalt nach gleichst. / Wehe bei den Göttern, schaffe mir die Frau aus den Augen,/ damit du nicht meinem Schmerz einen neuen hinzufügst! / Denn wenn ich sie sehe, glaube ich meine Frau zu sehen. / Sie lässt mein Herz schneller schlagen, aus den Augen strömen mir Tränen. Ich Unglücklicher, / wie eben erlitten spüre ich meinen Schmerz!“ (1161–1169) - „Götter, was soll ich sagen? Das ist ein unverhofftes Wunder. / Ist es wirklich meine Frau, die ich vor mir sehe?“
Euripides, Alkestis 1123–1124 (Übersetzung: Gustav Adolf Seeck)
Admetos: „O Auge und Gestalt meiner über alles geliebten Frau. / Ich halte dich unverhofft und meinte, dich nie mehr zu sehen.“
Euripides, Alkestis 1134–1135 (Übersetzung: Gustav Adolf Seeck)