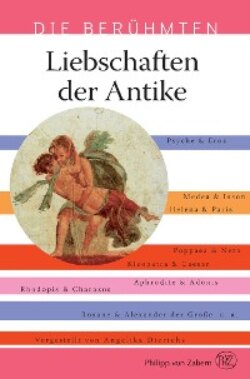Читать книгу Liebschaften der Antike - Angelika Dierichs - Страница 6
Оглавление[Menü]
Einleitung
Liebe lockt
Liebschaft, Liebespaare, Liebesbeziehung, Liebe … das sind Signalwörter, die in den unterschiedlichen Medienwerbungen erfolgreich locken, weil fast alle Menschen diverse Erfahrungen mit Liebe, Erotik, Sexualität sammelten. Die „Liebschaften der Antike“, was sie denn auch immer enthalten mögen, lassen hoffen, schmale Spuren vom eigenen Glück oder Unglück wiederzufinden und vage Anregungen für neues persönliches Liebesprozedere zu gewinnen. Somit reizt der Titel „Liebschaften der Antike“ in bewährtem, die Kauflust anregendem Muster. Das neue Buch ist ein ausgewogenes Produkt aus „Kultur und Kommerz“. Leser beiderlei Geschlechts werden sich auf ihre besondere Weise mit jenen Liebespaaren aus alter Zeit identifizieren und „einige allgemeine“ Tipps für den Umgang mit ihren aktuellen Liebesbefindlichkeiten erhalten. Selbstverständlich handelt es sich kaum um Paare/Liebespaare, die der heutigen romantischen Vorstellungskette entsprechen: erotische Anziehung, uneingeschränkte Verliebtheit, große Sehnsucht, wachsende Bindung, standesamtlich sanktionierte oder freie Partnerschaft, bis der Tod scheidet. Die ausgewählten Allianzen entstanden einst, gemäß den Regeln der Antike, unter männlichem Diktat und politischer Erwägung.
Vielfältig vernetzte Liebschaften
Der Titel „Liebschaften der Antike“ impliziert sehr unterschiedliche Nuancen von Liebe in den Paarbildern aus Mythologie und Historie. Es geht um sexuelle Leidenschaft und intensive Zuneigung, eingebettet in familiäre, freundschaftliche, soziale und politische Bezüge. Opportunismus der am Geschehen Beteiligten ist fast immer dabei. Aufschlüsse über Gefühle zwischen den Partnern, wie sie modern psychotherapeutisch anhand aufwendiger Analysen herausgearbeitet werden können, gibt es nicht wirklich. Sie lassen sich zwischen den Zeilen der tradierten Mythosversionen herauslesen oder sind aus literarischen Zeugnissen – Epen, Romanen, Tragödien, Komödien, Gedichten – zu erschließen. Und bei den historisch fassbaren Liebespaaren, zu denen begrenzt Fakten vorliegen – manchmal in Gerichtsreden, häufiger in Geschichtsabhandlungen – wird evident, dass solche Schriftquellen propagandistischen Gesetzen gehorchen. Demzufolge schenken sie Tendenziösem breiten Raum. Bis heute liest man wahrscheinlich mit kurzweiligem Genuss, wenn nicht nur von den Staatsgeschäften des Perikles berichtet wird, sondern auch von dem „durch eine Frau manipulierten großen Staatsmann“, der seine „Zärtlichkeiten“ jener so faszinierenden Ausländerin Aspasia geschenkt hat. Und besonders spannend ist es natürlich, wieder einmal einen Blick zu werfen auf die „angeblich beachtlich ausgeprägte Libido Kleopatras“, welcher sich die zwei im Kampf erfahrenen Römer Caesar und Marcus Antonius „derartig kampflos ergeben müssen“, dass sie zuweilen auf mitfühlendes Verständnis zählen können.
Schwierige Auswahl
In der griechischen und römischen Götter-, Helden- und Menschenwelt mit all den potentiellen und wirklichen Liebesbeuten agieren die Gottheiten, aufgrund des anthropomorphen Götterbildes, als seien sie „menschliche Verwandte“. Überaus reich ist das Tradierte. Folglich fiel die Auswahl der „Liebschaften der Antike“ schwer, zumal seitens des Verlages Vorgaben einzuhalten waren. So sollten Paare nicht nur aus der Mythologie, sondern auch aus der Historie vorgestellt werden. Konsequent entstand ein starkes, aber gut verträgliches Konzentrat aus Mythos, Religionsgeschichte, Quellenabhängigkeit und Forschungsfülle. Dass blutig-mörderische, erotisch-sexuelle und widerwärtig-skandalöse Facetten einflossen, ist selbstverständlich. Der Bezug zur Welt der Märchen – in einigen mythologischen Liebschaften aufgrund bestimmter Motive im Aktionsverlauf und durch Verhaltensweisen der Protagonisten durchaus aufzeigbar – wurde wegen zu großer Materialfülle unterlassen. Aus dem gleichen Grund fand homosexuelle Liebe keinen Raum in den hier präsentierten „Liebschaften der Antike“.
Weniger ist mehr
Gute Nachschlagewerke zur Mythologie enthalten üblicherweise mehrere Mythosversionen und zahlreiche antike Schriftquellen. So verirrt sich der Ratsuchende primär im Dickicht aus schwer durchschaubaren Stammbäumen, Namensgebungen, Handlungsentwicklungen und sekundär in jenen Verweisen auf literarische Zeugnisse, die sehr oft mehr erhoffen lassen, als sie dann wirklich aussagen. Die interpretatorische Fantasie, welche man antiken Zitaten überstülpt, hat zuweilen kaum noch etwas mit solider wissenschaftlicher Herangehensweise zu tun. Aufzählungen antiker Textstellen, die wenig hergeben für das Liebespaar, und ausufernde Informationen, hinter denen das Liebespaar fast verschwindet, gibt es im neuen Buch mit seinen „Liebschaften der Antike“ nicht. Sie sind so beschrieben, dass der Kern der mythologischen Liebschaft bzw. das, was man dafür hält, zügig gefunden wird, weil zumeist nur der klarste Mythenstrang gut lesbar gebündelt ist. Dabei zeigt sich überwiegend: Das eigentlich Harmonische der Liebschaft nimmt recht wenig Raum ein; Verwicklungen bei den mythologischen Liebschaften sind erzählend breit ausgeschmückt; Probleme bei den historischen Liebschaften lassen sich nur verstehen durch umfangreiche Hinweise zu den Wirrnissen der Geschichte.
Geschichte zur Beziehungsgeschichte
Personen in den historischen Liebschaften sind hundertfach erwähnt inmitten der Berichte von Kriegen, Aufständen und Gesellschaftsveränderungen. Bis man zum Persönlichen des Liebespaares kommt, heißt es, Sisyphos-Arbeiten zu leisten. Die neue Auswahl der „Liebschaften der Antike“ präsentiert die jeweilige Paarbeziehung „bequem“. Sie liefert durchaus die für das Verständnis der Liebesgeschichte notwendigen historischen Hintergründe mit und bezieht jüngere wissenschaftliche Beiträge ein. Aber all das liest sich nicht als lästiges Beiwerk zur „eigentlich interessanten Liebesgeschichte“, sondern als spannende Lektüre zu bedeutenden Stationen/ Ereignissen der antiken Welt. Es ist also durchaus gewollt, dass die Passagen zu den historischen „Liebschaften der Antike“ länger ausfallen, weil sie sich nur anhand ausführlicher geschichtlicher Informationen wirklich begreifen lassen: Die Ehe von Livia und Augustus ist nun einmal vernetzt mit der politischen Karriere des Octavian/Augustus und die Ehe von Theodora und Justinian ist in die Staatsräson des spätantiken Konstantinopel eingebunden.
Gut geordnete Gefühle
Wie gliedert sich die Untersuchung zu Frauen und Männern in heterosexuellen Zweierbeziehungen aus mythologischen oder historischen Personen? Jede Liaison – die Auswahl sehr berühmter und weniger berühmter Paare kommt dem Bedürfnis der Leserschaft nach Vertrautem und Neuem entgegen – besetzt ein eigenes Kapitel. Es beginnt mit kurzen persönlichen Daten zu Frau und Mann. Dieser manchmal lückenhafte Steckbrief ist erstellt aus mythologischen Versionen, religionsgeschichtlichen Marginalien, literarischen Zeugnissen und bildlichen Darstellungen, d. h. er verarbeitet Quellen, deren unterschiedliche Strukturen und Datierungen in der Kurzvorstellung selbstverständlich ausgespart werden müssen. Unter „Es war einmal …“ wird kontinuierlich beschrieben, welche Vorgeschichte zum Paar gehört, wie es zur ersten Begegnung der Liebenden kam, wie sich ihr Liebesglück oder ihr Liebeskummer anfühlten. Da die Phasen aus Harmonie oder Disharmonie bei den einzelnen Liebschaften unterschiedlich lang und verworren ausfallen, kann Erzähltes nach Abschnitten mit Zwischenüberschriften gegliedert sein. Der eigentlichen Story folgen „Nachantike Seitenblicke“. Sie fallen auf Details, die bis heute an große Emotionen erinnern. „Leseproben“ aus antiken Texten runden jede der „Liebschaften der Antike“ ab. Eingestreute Textfelder lockern das Layout auf und verraten, was man sonst noch so weiß von „ihr“ oder „ihm“. Die übersichtliche und kurzweilige Aufbereitung der Beziehungsgeschichten macht frisch verliebt in ein altes Thema.
Liebe verwirrt
Außer der „banalen“ Feststellung, alle Frauen/Göttinnen der hier behandelten Liebespaare seien schön und alle Männer/Götter beziehungsdominant, würde man bei den diversen Liebschaften gern einen roten Faden aufzeigen, durch Beantwortung der Fragen: Auf welche Weise wirbt man? Wem fällt die Liebe zu? Wie werden Hindernisse überwunden, um zueinanderzukommen? Ist stets Egoismus im Spiel? Was bewirken Gottheiten? Welchen Stellenwert hat der Nachwuchs? Aber es gibt zu wenig einheitliche Kriterien, um eine Systematik in all den erfundenen „Liebschaften der Antike“ des Mythos und den wirklichen der Historie zu erkennen. Nichts läuft stereotyp ab, obwohl fast durchgängig ein Ränkespiel der Menschen und der Götter mit beachtlichem Opportunismus beider Gruppen aufblitzt. Sicher sind die Liebesgeschichten aus Mythos und Historie allgemeingültige Beispiele für die Triebkräfte und das Verhalten der Menschen, welche sich „nach bestimmter moderner Filterung“ in Parallelen bis ins 21. Jahrhundert zeigen, so dass es scheint, Aphrodite/Venus und Eros/Amor werden niemals aufhören, ihr süß-bitteres Werk zu vervollkommnen.