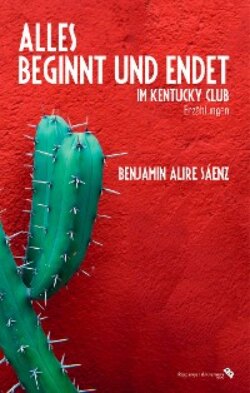Читать книгу Alles beginnt und endet im Kentucky Club - Benjamin Alire Saenz - Страница 14
7
ОглавлениеAm nächsten Sonntag stand er vor meiner Tür. Es war früh am Morgen. »Mein Onkel ist gestern Abend ins Krankenhaus gebracht worden.«
»Du siehst müde aus«, sagte ich. Und er sah wirklich müde aus. Müde und traurig, sein weißes Hemd zerknittert.
»Ich hab auf einem Stuhl in seinem Krankenzimmer geschlafen.«
Wir gingen die Treppe hoch zu meiner Wohnung.
»Ich mag deine Welt«, sagte er, während er das neue Bild ansah, an dem ich arbeitete. Dann bemerkte er die Worte auf meinem Computer. »Warst du gerade am Schreiben?«
»Ja.«
»Du schreibst am Sonntag?«
»Es ist wie zur Messe zu gehen.«
Er lächelte. »Das hier ist also das Abendmahl.«
»So ähnlich.«
»Was schreibst du?«
»Ein Gedicht.«
»Worüber?«
»Über das, was in Juárez passiert.«
»Warum ausgerechnet darüber?«
»Juárez lässt mich einfach nicht los.«
»Wieso?«
»Weil es ein Teil von mir ist.«
»Du lebst nicht dort.«
»Wir leben alle in einer Stadt, Javier.«
»Das ist Blödsinn, Carlos.« Ich mochte den Zorn, der in seiner Stimme mitschwang. »Spielt die verdammte Grenze für dich keine Rolle?«
Es gab so manches, was ich hätte sagen können, was ich gern gesagt hätte, aber die Grenze war nun einmal da und wir lebten auf verschiedenen Seiten davon. Was nützten schon utopische Ideologien über grenzenlose Welten von einem Verfasser politischer Gedichte? Was nützte ein Streit mit einem schönen Mann?
Er lächelte. »Ich bin nicht auf dich wütend.«
»Das weiß ich.«
»Schreib nicht über Juárez. Schreib über etwas Schönes.«
»Das ist nicht meine Arbeit, Javier.«
»Ich weiß. Deine Bücher werden immer trauriger.«
»Dafür gibt es eine Menge Gründe.«
»Das ist seltsam. Weil du kein trauriger Mensch bist.«
»Nein, eigentlich nicht.«
»Aber warum nicht?«
»Früher war ich traurig. Jetzt geht es mir besser.«
»Also bist du glücklich?«
»Im Moment schon.«
»Du bist kompliziert.«
»Erst war ich interessant und jetzt kompliziert?«
Er lachte. Dann legte er den Kopf auf meine Schulter. Und begann zu weinen.
»Er stirbt«, flüsterte Javier. »Ich habe niemanden mehr.« Seine Tränen durchnässten mein Hemd. Ich wollte sie schmecken, in ihnen baden, von ihnen überschwemmt werden. »Er stirbt.« Das wiederholte er ein ums andere Mal.
Ich wusste nie, was ich sagen sollte, wenn jemand weinte. Besonders wenn es ein Mann war. Bevor mein Vater starb, hatte ich oft bei ihm gesessen und seinem Schluchzen gelauscht. Manchmal hatte ich dabei seine Hand gehalten. Ich liebte dieses Bild in meinem Kopf: wie ich die Hand meines Vaters hielt. Also tat ich genau das. Ich nahm Javiers Hand und hielt sie fest. Ich führte ihn zu meinem Schlafzimmer. »Du solltest schlafen«, sagte ich. »Du bist müde.«
Er legte sich aufs Bett. Ich zog ihm die Schuhe aus.
Er starrte auf das kleine Wandgemälde, das ich in einer Ecke begonnen hatte. »Sehr schön. Gefällt mir.«
»Ich bin noch nicht fertig.«
»Lass es so.«
»Es ist nur ein Himmel.«
»Es ist schön. Nur ein Himmel. Lass es so.« Er war müde und er flüsterte.
»Schlaf jetzt«, sagte ich.
Draußen war es kalt. Der Wind frischte auf und die Wolken ballten sich zusammen wie ein Schwarm lästiger Krähen. Ich hasste Krähen. Sie waren gemein und eigennützig und tanzten mit hämischer Freude herum, wenn sie eine Eidechse gefangen hatten. Ich trat auf den Balkon und atmete tief durch. Der Gedanke an eine Zigarette schoss mir durch den Kopf – aber ich wollte nicht zurück zu jenen Zeiten. Ich war nicht mehr der Jüngste. Ich hatte viele Fehler gemacht. Rauchen war der geringste davon. Kein Zurück.
Wieder drinnen beschloss ich, Kartoffelsuppe zu kochen. Ich schälte ein paar Kartoffeln, würfelte sie, würfelte auch ein paar Zwiebeln, warf alles in einen Topf, fügte Salz, Pfeffer, Knoblauch hinzu, hackte Koriander. Eine Armeleute-Suppe. Nicht dass ich arm war, aber die Suppe erinnerte mich an meine Mutter. Ich liebte sie. Und ihre Suppe.
Ich ging ins Schlafzimmer und betrachtete den schlafenden Javier. Er hatte einen schlechten Traum. Er zitterte und murmelte, aber ich konnte die Worte nicht verstehen. Ich setzte mich aufs Bett und legte ihm eine Hand auf die Brust. »Es ist nur ein Traum«, flüsterte ich. Er wachte auf, erschrocken. In seinen Augen sah ich einen Ausdruck von Angst. Und dann einen ganz anderen Ausdruck, den des Loslassens.
»Es ist okay«, sagte ich.
Ich legte mich zu ihm ins Bett. Er schmiegte sich an mich. Es wurde dunkel. So sehr ich den Winter mochte, war er mir auch verhasst. Ich fühlte Javiers Atem an meinem Hals, fühlte die Worte, die er flüsterte: »Erzähl mir etwas von dir, das ich noch nicht weiß.«
Also erzählte ich. Davon, dass meine beiden älteren Brüder bei einem Autounfall umgekommen waren, und dass sie zusammen sieben Kinder hinterlassen hatten. Sieben Kinder und zwei trauernde, untröstliche Frauen, die sie sehr geliebt hatten. Darüber, dass mein Vater jahrelang an Depressionen, hohem Blutdruck, Parkinson und Diabetes litt und dann einen Schlaganfall hatte, der zum Hirntod führte, und dass ich die Maschine abgestellt hatte, die ihn atmen ließ. Von der Frau, die ich geliebt, verletzt und verlassen hatte. Von dem Mann, der mich geliebt hatte und dessen Liebe zu erwidern ich nie mutig genug war. Von einer jungen Frau, der ich in London begegnet war und die so blaue Augen hatte wie der Sommerhimmel, und dass ich mich in diesen Augen verloren hatte, als ich mir einbildete, ein Mann zu sein, wo ich doch nichts weiter war als ein dummer Junge. Von meiner Zeit als Helfer bei der Zwiebelernte, lange bevor ich alt genug war für einen richtigen Job, und wie ich davon geträumt hatte, mehr im Leben zu sein als ein Arbeiter mit krummem Buckel. Von der Narbe auf meiner Brust, wo mir, dem unbekümmerten Jungen, der ich war, der Stacheldraht die Haut aufgerissen hatte, als wäre sie nichts weiter als ein Fetzen Papier.
Ich merkte nicht einmal, dass ich weinte.
Aber ich spürte seine Hand auf meinem Gesicht. »Tränen schmecken wie das Meer. Wusstest du das?«
»Manchmal glaube ich, dass das Meer aus Tränen gemacht ist.«
Er legte mir einen Finger auf die Lippen. »Dein Leben ist besser als das, was deine Romane beschreiben.«
Ich nahm seine Hand, drehte sie nach innen, betrachtete sie. Ich richtete mich auf. »Meine Romane sind voll von schönen Männern. Männern, wie ich nie einer sein werde.«
»Du bist nicht traurig. Nur verletzt.«
»Wir sind alle schon mal verletzt worden.«
Dann zogen wir einander aus. Er fuhr mit einem Finger über meine Narbe und küsste sie. Ich betrachtete seinen vollkommenen Körper. Doch am meisten war ich in sein Gesicht verliebt, seine Augen, den Ausdruck von Verlangen, der über die banalen Begierden des Körpers hinausging. Ich führte ihn zur Dusche. Ich wusch ihm den Rücken, das Haar, die Füße, die Beine. »Jetzt lass mich«, sagte er. Das fiel mir schwer – mich von ihm waschen zu lassen. Mich von ihm berühren zu lassen. Aber ich ließ es zu.